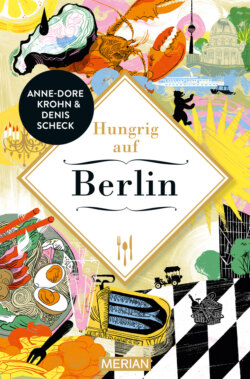Читать книгу Hungrig auf Berlin - Denis Scheck - Страница 11
SODOM UND BERLIN
ОглавлениеDiese Charakterisierung sitzt. Bis heute. Ähnliche Szenen tragen sich im Berlin der Gegenwart in zahllosen Kantinen, Metzgerimbissen oder auf günstigen Mittagstisch spezialisierten Res- taurants zu – auch wenn sich zum Glück inzwischen die frischere und vor allem leichtere vegetarische oder vegane Küche durchsetzt. Der Elsässer Yvan Goll zeichnet in seinem Roman »Sodom und Berlin« von 1929 ein Bild der deutschen Hauptstadt, das bis heute stimmig ist und auch deshalb unter die Haut geht: »Berlin. Bleiche Stadt. Stadt des fahlen Zements. Stadt der eisigen Winter. In angstvollen Nächten wird sie von einer Vorstellung geplagt: Das weiße Gesicht Rosa Luxemburgs blüht wie eine tragische Seerose im Eis des Landwehrkanals. Der ewig gejagte Schatten Karl Liebknechts flieht hinter die schwarzen Büsche des Tiergartens, aus denen die wilden Augen seiner Mörder herausleuchten.« Aber »Sodom und Berlin« ist letztlich ein satirischer Roman, in dem Goll seinen Helden Odemar Müller nach Eskapaden in Paris und Italien am Ende natürlich bei Aschinger landen lässt: »O Freude! O Vision eines Schlaraffenlandes! Plötzlich hatte er vor sich eine der Aschinger-Bierquellen mit ihren Wurstringen, ihren Bergen von Bratheringen, ihren Seen von Mayonnaisesauce und ihren Wolken aus Schlagsahne. Das war so recht eine deutsche Landschaft. Er hatte seine Heimat wiedergefunden. In der verrauchten Stehbierhalle floss der süffige schwere Triumphator schäumend wie eine Alpenquelle.« Präzise und psychologisch detailscharf zeichnet auch der Schweizer Robert Walser in seinem grandiosen Feuilleton Aschinger den Futtertrog der Hauptstadt der Weimarer Republik: »Bei Aschinger gewöhnt man sich rasch einen Ess- und Trink-Vertraulichkeitston an, man spricht dort nach einiger Zeit fast nur noch wie Wassmann im Deutschen Theater. (…) Mit dem zweiten oder dritten Glas Hellem in der Faust treibt’s einen dann gewöhnlich an, allerlei Beobachtungen zu machen. Man will gern recht exakt notiert haben, wie die Berliner essen. Sie stehen dabei, aber sie nehmen sich ganz nett Zeit dazu. Es ist ein Märchen, zu glauben, in Berlin haste, zische oder trabe man nur. Man versteht hier geradezu drollig, Zeit dahinfließen zu lassen, man ist eben auch Mensch. Es ist eine innige Freude, zu sehen, wie hier nach Wurstbrödchen und italienischen Salaten geangelt wird. Die Gelder werden meistens aus Westentaschen hervorgezogen, es handelt sich ja doch beinahe regelmäßig nur um einen Groschen. (…) Die Unbefriedigten finden rasch an der Bierquelle und am warmen Wurstturm Befriedigung, und die Satten springen wieder an die Geschäftsluft hinaus, gewöhnlich eine Mappe unter dem Arm, einen Brief in der Tasche, einen Auftrag im Gehirn, einen festen Plan im Schädel, eine Uhr in der offenen Hand, die sagt, daß es jetzt Zeit ist. Im runden Turm in der Mitte des Gemaches thront eine junge Königin; es ist die Beherrscherin der Würste und des Kartoffelsalates, sie langweilt sich ein wenig in ihrer köcherlichen Umgebung. Eine feine Dame tritt ein und spießt ein Kaviarbrötchen an zwei Finger auf, sofort mache ich mich ihr bemerkbar, aber so, als ob mir das Bemerktwerden Wurst wäre. Ich habe inzwischen Zeit gefunden, mich an einem neuen Hellen festzuhalten. Die feine Frau geniert sich ein bißchen, in die Kaviarherrlichkeit hineinzubeißen, ich bilde mir natürlich sogleich ein, das sei ich und kein anderer, wegen dem sie ihrer Zubeißesinne nicht so ganz völlig mächtig wäre. Man täuscht sich so leicht und so gern. (…) Würde und Selbstbewußtsein wirken behaglich, auf mich wenigstens, und deshalb stehe ich so gern in irgendeinem von unsern Aschingerhäusern, wo die Menschen zu gleicher Zeit trinken, essen, reden und denken. Wie viele Geschäfte sind hier schon ersonnen worden! Und das Schönste ist: Man kann stundenlang am Fleck stehen, das verletzt niemanden, das findet kein einziger von all denen, die kommen und gehen, auffällig. Wer hier an der Bescheidenheit Geschmack findet, der kann auskommen, er kann leben, es hindert ihn niemand. Wer keine gar so besondere Herzlichkeit beansprucht, der darf ein Herz haben, man erlaubt ihm das.«
Berlin in den 20er-Jahren: Das war das Labor der Avantgarde, das Testgelände der Utopien, das Paradies des Partyvolks. Vicki Baum, der wir in den kommenden Jahren eine große Renaissance prophezeien, arbeitete Mitte der 20er-Jahre als berühmte Romanautorin und Redakteurin für diverse Zeitschriften im Ullstein-Haus und hielt in ihrer Autobiographie »Es war alles ganz anders« fest, was für sie als Wienerin den Charme von Berlin in der Weimarer Republik ausmachte. Bemerkenswert dabei, mit welcher soziologischen Präzision sie den Wandel der Trinkgewohnheiten in der Hauptstadt analysiert: »Berlin war so herrlich lebendig, so geladen mit einer seltsamen Elektrizität. Bars – ich hatte, bevor ich nach Berlin kam, noch keine gesehen. Schrecklich, grollten die konservativen Älteren, wir werden immer amerikanischer. Cocktails – nicht mehr der edle deutsche Wein wie früher. Früher, das bedeutete ausnahmslos: vor dem Krieg. Kostümfeste in Privatwohnungen, mit Reizkostümen, die viel Fleisch sehen ließen, und wildem Treiben. Für unsern Geschmack reichlich frei, schnoben die Tapergreise. Für uns aber war es genau die Freiheit, die wir wollten und brauchten.« Das Berlin Vicki Baums war eine Stadt mit drei Opern, 49 Theatern, über 300 Kinos, gut 80 Varietés und Kabaretts und an die 60 Tageszeitungen, die morgens, mittags und abends erschienen. Und auch wenn die Presselandschaft Berlins im Vergleich dazu heute fast ausgelaugt wirkt, weist die deutsche Hauptstadt der Gegenwart immerhin vier feste Opernhäuser auf und rund 150 Theater und Bühnen, die Konzert- und Clubkultur ist weltberühmt, und gleich fünf (!) Literaturhäuser bieten Zugang zu deutschsprachiger und internationaler Dichtung. Auch für die Stadt heute gilt: Berlin tanzt. Berlin geht aus. Berlin trinkt. Berlin isst. Berlin feiert. Und Berlin spricht über nichts so gern wie über Essen und Trinken. Wenig liest sich denn auch so amüsant wie die Restaurantkritiken „Von Tisch zu Tisch“ im „Tagesspiegel“, über Jahre von Susanne Kippenberger und Bernd Matthies liebevoll auf hohem Niveau gestaltet.