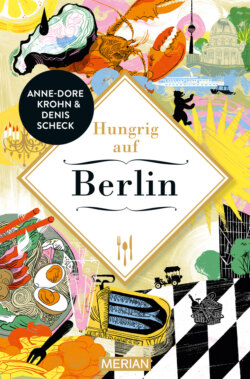Читать книгу Hungrig auf Berlin - Denis Scheck - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ALLE LEUTE KÖNNEN DOCH NICHT BEI IHRER MAMA ESSEN!
ОглавлениеWie viele 17-jährige erstmalige Besucherinnen und Besucher von Berlin werden wohl heute von ähnlichen Gefühlen und Gedanken umgetrieben wie einst Klaus Mann? Der US-Amerikaner Mel Gordon fängt in seinem Bildband »Sündiges Berlin« etwas von der »Verruchtheit« und erotischen Faszination des Berlins der 20er-Jahre ein. Man konnte als Lookalikes von Filmstars wie Lilian Harvey oder Marlene Dietrich zurechtgemachte »Telefonmädchen« bestellen oder Streifzüge durch die Treffpunkte der »Girlkultur« wie die »Kakadu-Bar«, die »Weiße Maus« oder die »Haller-Revue« unternehmen – so einem nicht der Sinn nach Lesbenlokalen wie dem »Café Domino« oder der »Verona-Diele« stand, Schwulenbars wie dem »Cosy Corner« oder der »Zauberflöte« oder Travestielokalen wie dem »Eldorado«.
Innerdeutsch mögen die Horrorgeschichten der dysfunktionalen Hauptstadt für eine gewisse Desillusionierung sorgen – die Wartezeit auf einen neuen Reisepass zermürbt genauso wie der Versuch, ein neues Auto anzumelden oder einen Einbürgerungsantrag zu stellen, was schon mal zwei Jahre dauern kann. Die internationale Attraktivität Berlins als Feiermetropole der Jugend und safe haven für Immobilienschnäppchenjäger ist aber trotz aller Bemühungen um Regulierungen für Airbnb, einen Mietendeckel und die Verstaatlichung der Wohnungskonzerne bis heute ungebrochen, und wenig deutet darauf hin, dass sich dies in absehbarer Zukunft ändert.
Das letzte Wort unserer Einleitung gebührt Kurt Tucholsky, dem Autor, der Presse und Literatur der Weimarer Republik wie kein anderer seinen Stempel aufdrückte. Tucholsky hat klarer als die meisten die Konsequenzen des Aufstiegs der Nazis erkannt. Zudem verdanken wir ihm die bis heute wahre Erkenntnis: »Der Mensch hat, neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken, zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören.« In seinem Aufsatz »Das Elend mit der Speisekarte« holt der unter seinem Pseudonym Peter Panter schreibende Tucholsky, dessen Jahre als Korrespondent in Paris seinen kulinarischen Horizont stark erweitert hatten, zur Generalabrechnung mit der deutschen Gastronomie aus. Wir haben uns immer wieder diesen vergleichsweise unbekannten Text Tucholsky angesehen und sind von seiner Analysestärke und Aktualität erstaunt und begeistert. Tucholskys gastrokritische Anmerkungen lesen sich wie von heute: »Erster Fehler: Es gibt viel zu viel Fleisch. Man braucht gar kein Lebensreformer oder Vegetarier zu sein, um das zu empfinden – jeder aufgeklärte Arzt empfiehlt dem scharf arbeitenden Menschen zum mindesten gemischte Kost. Bekommt er die in dem gewöhnlichen Restaurant? Also nicht im vegetarischen, nicht im besonders teuren, nicht in der berühmten Ausnahme, die es in jeder Stadt gibt – nein, im Restaurant Seeschlößchen? Bekommt er da eine gemischte Kost? Er bekommt sie mitnichten. Denn:
Zweiter Fehler: Die Gemüse sind nicht gut zubereitet und fast niemals frisch. Daß das Essen in den meisten Restaurants so schmeckt, als sei es abgestanden, liegt daran, daß es abgestanden ist. Die kulinarisch verderbliche Forderung des Deutschen, zwischen elf Uhr vormittags und vier Uhr nachmittags Mittag zu essen, wann es ihm paßt, hat zur Folge, daß das Essen halbfertig gemacht wird, sehr lange über Dampf steht … und was dann herauskommt, sind diese ausgelaugten Sachen, die auf dem Teller leise vor sich hin weinen. Draußen, in der Natur, haben sie noch vor Lebensfreude und Vitamin geknallt; nun sind es armselige Gummistrünke, die schöne Namen führen, ›Blumenkohl‹ oder ›grüne Bohnen‹ – aber es sind Gummistrünke. Preisfrage: wo bleibt eigentlich das frische deutsche Gemüse –? (›Da müssen Sie mal zu meiner Mutter kommen, Herr Panter, die kocht Ihnen ein Leipziger Allerlei …‹ – ›Liebe gnädige Frau, es ist so nett von Ihnen ... Aber alle Leute können doch nicht bei Ihrer Mama essen!‹)
Dritter Fehler: Die Portionen sind zu groß. Ich weiß schon, daß die ›Leute das verlangen‹ – aber ich weiß auch, daß es bereits eine Menge Esser gibt, die immerhin so etwas wie Eßkultur besitzen und die lieber vielerlei verschiedene Kleinigkeiten essen an Stelle dieser Enak-Speisen. Denn wenn man ein Filetsteak bestellt, dann kommt ein Trum von Fleisch und Ei und Gemüsen und gebackenem Brot und das alles mit einemmal, wie ein mit Tschinellen garnierter Paukenschlag; und wenn man ›Gulasch‹ sagt, dann kommt immerzu gar nichts wie Gulasch, eine ganze Badewanne voll, und sagt man ›Eierkuchen‹, dann kommt ein Bettvorleger … nein, die Portionen sind wirklich zu groß!
Vierter Fehler: Es gibt nicht genug Sommerspeisen und nicht genügend frisches Obst. Sich im heißen Sommer ein gedünstetes, faustgroßes Stück Fleisch in den Magen zu jagen, halte ich für eine immense Rücksichtslosigkeit gegen ebendenselben; eine Weile läßt sich das ja jeder Magen gefallen, aber eines Tages … nun, wir wollen uns nicht bange machen. Es gibt, besonders im Sommer, in den Restaurants viel zu wenig leichte Speisen – viel zu wenig gedünstetes Obst, viel zu wenig gutes, frisches Obst – denn was es gibt, das taugt meist nicht, und hier sind nun die Portionen viel zu klein: Da steht so ein kleines Kompott-Schälchen, und da liegt ein Löffelchen auf dem Tellerchen, und da liegen drei Pfläumchen … nein, die Portionen sind wirklich zu klein!
Ich habe an keiner Stelle meines Beschwerdebüchleins von den Preisen gesprochen, obgleich das ein weites Feld ist. Aber ganz abgesehen vom Geld: Selbst für Geld bekommt man fast niemals das zu essen, was man nach vernünftigen und hygienischen Ratschlägen essen sollte. Man bekommt es in Deutschland: in Familien, die wissen, was das heißt: kochen, essen, rationell leben; man bekommt es in Heimen, manchmal in Pensionen, in Vegetarierhäusern … aber man bekommt es fast niemals da, wo man es am allernötigsten braucht und erwartet: in Bahnhofrestaurants, in Hotels und in den Speisewagen, dieser untersten Stufe der deutschen bürgerlichen Ernährung. (Hier wird die Milch der guten Denkungsart sauer. Es ist aber auch zu schrecklich!) Nun, muß das sein –? (…) Es ist ein Elend mit der Speisekarte.«
Kurt Tucholsky, der Meister des tausendgesichtigen Feuilletons, war auch ein scharfzüngiger Gastrokritiker. Kein Wunder, schließlich war er gewohnt, über den Tellerrand hinauszublicken. Und täuschen wir uns, wenn wir spekulieren, dass Tucholsky mit besonderem Enthusiasmus den Abschied vom Quälfleisch, den Trend zur kulinarischen Regionalität, aber auch zur vegetarischen oder veganen Küche in der Hauptstadt begleitet hätte? Sein trauriges Ende in Schweden ermahnt uns jedenfalls, die Annehmlichkeiten des heutigen Berlin und die zahllosen Privilegien unserer deutschen Gegenwart nicht ganz so selbstverständlich zu nehmen.
Uns ist beim Schreiben dieses Buches klar geworden, dass es mit guten Restaurants nicht anders ist als mit guten Büchern. Wie die Literatur erzählt auch die Gastronomie immer Geschichten. Sosehr der Erfolg eines Restaurants an erstklassigen Produkten, tollen Köchinnen und Köchen, der Lage, freundlichem Service, überzeugender Inneneinrichtung und angemessenen Preisen liegt – letztlich zählt seine Geschichte.
Einige davon erzählen wir hier.