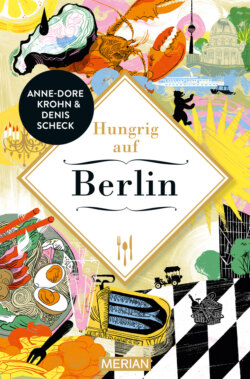Читать книгу Hungrig auf Berlin - Denis Scheck - Страница 9
SCHWIMMER ODER NICHTSCHWIMMER?
ОглавлениеVon solch bizarren historischen Kontinuitäten und Brüchen erzählt auch die extrem beliebte TV-Serie »Babylon Berlin«. Nicht erst durch den internationalen Erfolg dieser Serie, die auf den Romanen von Volker Kutscher basiert, erlebt die Ausgehkultur der 20er-Jahre ein keineswegs nur auf Berlin beschränktes Comeback in Gestalt von »Roaring Twenties«-Kostümbällen. In den 20er-Jahren existieren in Berlin über 300 Kinos, eines von ihnen war das Theater im Delphi in der Gustav-Adolf-Straße 2 in Weißensee. Das Delphi gibt es noch heute. Für »Babylon Berlin« wurde es selbst zur Kulisse. Hier spielt eine der mitreißendsten choreografierten Szenen, die je in Deutschland gedreht wurde: einmal so tanzen wie die Bubikopf-Kokotten und Halbwelt-Dandys im Moka Efti zum Song »Zu Asche, zu Staub / Dem Licht geraubt / Doch noch nicht jetzt / Wunder warten bis zuletzt / Ozean der Zeit / Ewiges Gesetz / Zu Asche, zu Staub / Zu Asche / Doch noch nicht jetzt …« Gesungen hat das mit hypnotischer Melancholie die litauische Schauspielerin Severija Janušauskaitė. Extra für die Serie komponiert haben den Song Nikko Weidemann, der Schweizer Mario Kamien und Regisseur Tom Tykwer. Ein Welthit – die ganze Tragik der Weimarer Republik blitzt in ihm auf.
Wo wir die Zeitmaschine zurück in die 20er-Jahre nun schon mal in Gang gesetzt haben, statten wir doch den berühmten Künstlerlokalen und Kaffeehäusern Berlins gleich einmal einen Besuch ab. Dem für seine schwäbische Küche bekannten Schlichter, Luther-/Ecke Ansbacher Straße. Oder dem Josty am Potsdamer Platz. Der Bierstube von Änne Maenz in der Augsburger-/Ecke Joachimsthaler Straße, wo wir Ernst Lubitsch, Fritzi Massary oder Billy Wilder antreffen. Oder dem für seine Premierenfeiern bekannten Schwanneke in der Rankestraße 4, das der Schauspieler Viktor Schwanneke 1921 eröffnet hat und das eigentlich nach seiner Frau Weinstube Stephanie heißt, doch so nennen es nur Uneingeweihte. Unbedingt wollen wir natürlich auch ins Romanische Café mit seiner berühmten Unterteilung: in den kleinen »Schwimmerbereich«, der prominenten Gästen wie Ruth Landshoff, Bertolt Brecht, Mascha Kaléko, Erich Maria Remarque oder Alfred Döblin vorbehalten ist, und dem bedeutend größeren »Bassin für Nichtschwimmer«, in den Worten Erich Kästners der Platz für »jene Leute, die hier seit zwanzig Jahren, Tag für Tag, aufs Talent warten«. Doch wehe dem, der sich am ersten Tisch nach der Drehtür im Nichtschwimmerbereich hinsetzte, dem für Granden wie Max Slevogt, Alfred Flechtheim, Emil Orlik, Bruno Cassirer oder Max Liebermann vorbehaltenen Künstlerstammtisch. Gabriele Tergit beschreibt in ihrem Bestseller »Käsebier erobert den Kurfürstendamm« von 1931 die Atmosphäre in diesem Künstlercafé, in dem Karrieren gemacht und beendet wurden: »Das Romanische Café befindet sich gegenüber der Gedächtniskirche und besteht aus einer Schwimmer- und Nichtschwimmerabteilung. Die Schwimmer sitzen links von der Drehtür. Die Nichtschwimmer rechts. Das Romanische Café ist sehr schmutzig. Erstens ist es trotz seiner großen Fensterscheiben so angeräuchert, wie es für eine Stätte des Geistes notwendig ist, zweitens ist es schmutzig durch die Manieren seiner Bewohner, die unausgesetzt Überreste ihrer Raucherei auf den Fußboden werfen. Drittens aber durch die ungeheure Frequenz. Denn dieses Café ist eine Heimat. Ungarn, Polen, Jugoslawen, Russen, Tschechen, Slowaken, Ruthenen, Dänen, Böhmen, Österreicher, Balten, Letten, Litauer, Serben, Rumänen und die große Schar der in Berlin dem Geist geöffneten, von Osten kommenden Juden, sie alle finden dort Landsleute. Denn so ist es mit Berlin: In der Fremdenstatistik interessiert man sich hauptsächlich für die Amerikaner, aber eigentlich kommen am meisten Völker von Osten nach Berlin, eventuell ein paar Holländer und Dänen. Darauf wird weniger Wert gelegt. Aber Berlin ist 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Berlin ist ein Vorort des Nordostens, wie Wien des Südostens. Berlin ist keine chice Hauptstadt, wie Paris oder Rom oder London, wo die Engländer und die Amerikaner, die Spanier und Franzosen hinfahren for sightseeing, im Frühling oder in der season als »Trip«. Nach Berlin kommt man vom Osten, um eine Stellung zu finden, um Musik zu machen, um zu filmen und um zu malen, Theater zu spielen, zu schreiben, Regie zu führen, zu bildhauern, um Autos zu verkaufen, Bilder, Grundstücke, Terrains, Teppiche, Antiquitäten, um Läden aufzumachen, Schuhläden, Kleiderläden, Parfümläden, um zu darben und zu studieren. Sie alle sitzen im Romanischen Café, erst im Nichtschwimmerbassin, später im Schwimmerbassin. Sie alle sprechen und schimpfen.« Die Küche im Romanischen Café war übrigens so berüchtigt schlecht, dass eigentlich nur Touristen auf die Idee kamen, dort irgendetwas anderes zu sich zu nehmen als zwei Eier im Glas.
Für unser Leben gern würden wir auch mal einen Abend lang im Haus Vaterland am Potsdamer Platz mit 8000 anderen Gästen in zwölf Themenrestaurants verbringen – eine Dimension von Eventgastronomie, die heute selbst Disneyland oder Las Vegas erblassen ließe. Zur Auswahl standen unter anderem die Wildwestbar Arizona, ein türkisches Café, ein Wiener Heurigenlokal, ein bayerischer Biergarten, eine japanische Teestube, eine spanische Bodega, eine italienische Osteria und das ungarische Restaurant Czardas. Zu den Hauptattraktionen des Hauses Vaterland zählten jedoch die »Rheinterrassen«, die alles an technischen Finessen aufboten, was man sich Ende der 20er-Jahre zur Unterhaltung der Gäste ausdenken konnte: Rheinromantik inklusive künstlicher Sonnenuntergänge und illuminierter Eisenbahn-, Flugzeug- und Schiffsmodelle. Vollends zum Wunder Berlins wurden die »Rheinterrassen« jedoch mit einem pünktlich zu jeder vollen Stunde inszenierten Wolkenbruch vor der Kulisse von St. Goar nahe der Loreley. Die furchtbar unterschätzte deutsche Autorin Irmgard Keun lässt in ihrem Roman »Das kunstseidene Mädchen« von 1932 diese frühe Form der Gästebespaßung im Haus Vaterland ihre Ich-Erzählerin Doris in ihrem atemlosen und dabei doch herrlich verquatschten Stakkatostil beschreiben: »Und im Vaterland toll elegante Treppen wie ein Schloß mit Gräfinnen, die schreiten – und Landschaften und fremde Länder und türkisch und Wien und Lauben von Wein und die kolossale Landschaft eines Rheines mit Naturschauspielen, denn sie machen einen Donner. Und sitzen, es wird so heiß, die Decke fällt – der Wein macht uns schwer – ›ist es denn nicht schön hier und wunderbar?‹ Es ist doch schön und wunderbar, welche Stadt hat denn sowas noch, wo sich Räume an Räume reihen und die Flucht eines Palastes bilden? Die Menschen sind alle so eilig – manchmal sind alle blaß im Licht, dann sehen die Kleider von den Mädchen nicht bezahlt aus, und die Männer können sich den Wein eigentlich nicht leisten – ob denn keiner glücklich ist?« Das Haus Vaterland fiel 1943 nach einem Bombenangriff einem Großbrand zum Opfer. Ein kulinarischer Notbetrieb in den unversehrten Teilen des Monumentalbaus als Wehrmachtsheim und HO-Gaststätte wurde mit Unterbrechungen bis 1953 fortgeführt. Natürlich hat sich auch Volker Kutscher diesen gigantischen Vergnügungsdampfer der Weimarer Republik nicht entgehen lassen: Sein vierter Gereon-Rath-Roman »Die Akte Vaterland« von 2012 spielt größtenteils hier.