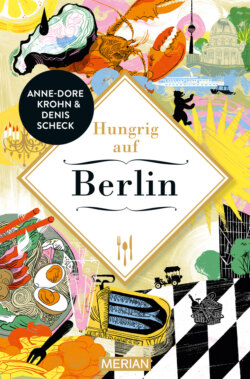Читать книгу Hungrig auf Berlin - Denis Scheck - Страница 12
BERLIN IST MULTIKULINARISCH
ОглавлениеAber manchmal hat man den Eindruck, die ganze kulinarische Pionierarbeit der vergangenen Jahrzehnte könnte umsonst gewesen sein. Im September 2021 kündigt die Lufthansa eine kulinarische Innovation für ihre Businessclass an. Unter dem Slogan »Tasting Heimat« werden sechs deutsche Großstädte mit ihren kulinarischen Spezialitäten vorgestellt, darunter Leipzig mit einem feinen Allerlei von Spargel, Morcheln und Flusskrebsen, Düsseldorf mit einem mürben Rheinischen Sauerbraten und Frankfurt mit der legendären Grünen Soße, die schon Goethe begeisterte. Nur für die deutsche Hauptstadt bleibt mal wieder nichts als die triste unvermeidliche Currywurst ...
Armes Berlin. Nichts gegen eine gut gemachte Currywurst – wenn man aber, wie wir, oft eher der Literatur vertraut, wurde die Currywurst sowieso nicht in Berlin erfunden, sondern in Hamburg. Das schreibt jedenfalls der Schriftsteller Uwe Timm in seiner tollen Novelle »Die Entdeckung der Currywurst«. Und wenn es schon um Berlin-typisches Fast Food geht, finden wir Falafel sowieso viel leckerer. Aber die reflexartige Reduktion der Hauptstadt in den Medien auf Currywurst, Bulette oder Falafel tut der vielfältigen gastronomischen Gegenwart Berlins bitter unrecht. Und erst recht seiner nicht minder bunten kulinarischen Vergangenheit. »Berlin ist multikulinarisch!«, jubelt etwa die Schriftstellerin Tanja Dückers, die 2018 die Schokoladenmanufaktur Preußisch süß – Berliner Stadtteilschokolade gründete. Man kann heute nirgendwo in Deutschland so gut und so abwechslungsreich essen und trinken wie in Berlin – und dies auf jedem Niveau. Gelebte Diversität lässt sich, auch kulinarisch, nirgendwo schöner, anregender und mitunter auch anstrengender erleben als in Berlin, und zwar auch für wenig Geld. Daran hat selbst die Pandemie wenig geändert. Gefahr droht allerdings von einer lange unterschätzten Nebenwirkung von Corona: Nach Auskunft der deutschen Sternekoch-Legende Dieter Müller, der als Ideengeber das Pots im Ritz-Carlton verantwortet, stehen in Berlin, während wir diese Zeilen zu Papier bringen, 18 000 Stellen im Gastro- und Hotelgewerbe offen, einfach weil die bisher dort Tätigen in andere, von den Auswirkungen Coronas sicherere Gewerbe abgewandert sind – was beim Service zum Teil schon spürbar ist. Und natürlich setzt das auch Grenzen für den kreativen Spielraum.
Berlin heute ist noch ein erfreuliches »Smörgåsbord« von Küchen unterschiedlichster Menschen, Länder und Kulturen. Aufregend, unberechenbar und mitunter auch herausfordernd. Zum Beispiel im neuen Automatenrestaurant Data Kitchen von Heinz »Cookie« Gindullis, das die öffentlich zugängliche Kantine des Berliner »SAP-Data Space« (heißt wirklich so) ist und dank kontaktloser Bestell- und Abholmöglichkeit zum unfreiwilligen Vorreiter der neuen Pandemiegastronomie wurde. Die per Smartphone-App auf eine bestimmte Uhrzeit georderten Gerichte lassen sich an einer »Food Wall« entnehmen. Automatenrestaurants waren eine Erfindung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, galten im Berlin der 20er-Jahre aber immer noch als der letzte Schrei. So denkt auch die uns schon aus dem Haus Vaterland bekannte 18-jährige Gelegenheitsprostituierte Doris aus Irmgard Keuns Roman »Das kunstseidene Mädchen«, die aus dem Rheinischen nach Berlin gekommen ist und in der Hauptstadt ihr Glück machen und »ein Glanz werden möchte«. Die meiste Zeit ist Doris aber vor allem eines – hungrig: »Ich bin in einem Automatenrestaurant in der Joachimsthaler und heißt ›Quick‹. Das ist so wahnsinnig, ich habe mir Krabben gezogen und einen westfälischen Speck – es gibt ja viele Essen, bei denen der Name von einem weiten Ort am schönsten schmeckt, weil sowas einem Deutschen immer ein Reisegefühl und was Überlegenes gibt, und ich kannte doch Männer, die wurden beim Sitzen durch ein unsichtbares Kissen unter ihrem Popo erhöht, wenn sie allein italienischen Salat bestellten – nur wegen dem italienisch. Ich konnte meine gezogenen Brote gar nicht essen – aber das ist mir das Märchen von Berlin – so ein Automat.« Irmgard Keuns den stream of consciousness einer jungen Frau abbildende Satzgirlanden zu lesen macht schlicht glücklich.
Genau denselben ungezügelten Appetit aufs Leben findet man bei Gabriele Tergit. Treffsicher wie in ihrer Beschreibung des Romanischen Cafés gibt sie einen facettenreichen Einblick in die Berliner Gastroszene der 20er und webt ein feines literarisches Beziehungsgeflecht zu »Irrungen und Wirrungen« von Theodor Fontane, dem Roman über die an den Standesgrenzen scheiternde Liebe zwischen der Schneidermansell Lene Nimbsch und Baron Botho von Rienäcker. Tergit schreibt: »Er ging an einem lichten Märzabend über den Kurfürstendamm. Der Asphalt spiegelte. Die Frühlingsbäume hatten einen hellen Schleier im Licht der Bogenlampen, aus dem Tiergarten drang die Sehnsucht der vielen Paare auf den Bänken. Vor dem Café saßen Damen in hellen neuen Kostümen, die kleinen Hüte um die kleinen Köpfe, sie saßen da und tranken aus den Röhrchen Eiskaffee und Eisschokolade. Sie waren herrlich manikürt und massiert und gesalbt und gerötet und geweißt. Lambeck roch diese Luft aus Freiheit, Frechheit und Benzin. Einbeinige saßen an der Steinterrasse des großen Hotels. Pavillon, Bar, Diele und Dachgarten, wo Lene Nimptsch wohnte und Dörrs Gärtnerei war. Irrungen, Wirrungen. Wanderschrift, Kirche und winkender Schutzmann. Autos, Autos, Weltanschauungscafés und stille Konditorei für Liebe. Kapitol in rosa, lila und rot. Kino, Café, Restaurant, d. h. Paläste, Marmor, Gloria und Königin, Sekt, elegante Kleider, Charleston und Jazz, Fraßgeschäfte mit bunten Salaten und Artischocken, Flipp und Cobler, rotes, grünes, gelbes Licht, Schlange und Krokodil, Feh und Zobel, Seide und Spitzen, lackierte Kojen, wo Schönheit fabriziert wird mit Dampf, gefetteter Hand und knisterndem elektrischen Strom für die Pelztiere, die rosa Beine, cotyfarbene Münder, suchende Portemonnaies und suchende Augen für die Herren haben, jetzt unter den Bäumen, den ausgedörrten vor winterslanger Sehnsucht nach dem Märze. Amerikanisches Restaurant, hell, freundlich, Abbild eines optimistischen Kontinents, hier etwas trinken, Strohröhrchen, Milch und Kaffee zum Beispiel, hier Frappee genannt.«