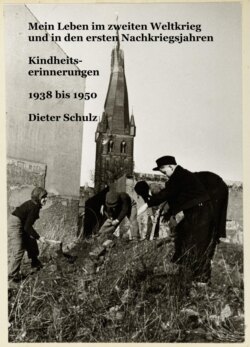Читать книгу Mein Leben im zweiten Weltkrieg und in den ersten Nachkriegsjahren - Dieter Schulz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Sicherheit in Düsseldorf war nicht sehr gut
ОглавлениеWenn man die Sicherheit zum Maßstab aller Dinge macht, so hatte ich mich mit der Heimkehr nach Düsseldorf nicht verbessert. Die Bombardierungen nahmen nämlich weiter zu und fast jede Nacht trieb uns der Fliegeralarm in den Keller. Der bot aber, wie ein Nachbar bemerkte, keinesfalls ausreichenden Schutz im Falle eines Volltreffers durch eine mittel- schwere Sprengbombe. Wie die meisten Keller der damaligen Häuser hatte auch unser Keller eine aus Ziegelsteinen gemauerte Gewölbedecke. Um deren Stabilität zu erhöhen, wurden Holzstützen, dick wie Baumstämme, eingesetzt.
Wenn es in der Nähe zu Bombeneinschlägen kam, wackelten in unserem Keller die Wände und von dem Deckengewölbe fielen Putz- und Mörtelstückchen herunter. Eine Frau, die neben mir saß, rief dann mit schriller Stimme: „Ich halte das nicht mehr aus! Ich halte das nicht mehr aus!“ In solchen Nächten zeigte es sich, dass die meisten Hausbewohner sehr fromm waren, denn immer wenn es in der Nähe einschlug, beteten sie laut. Da sie sich aber zuvor nicht abgestimmt hatten, beteten sie nicht die gleichen Gebete. Während die eine Gruppe das „Vater unser“ betete, sprach die andere das „Gegrüßt seist Du Maria“. Eine andere, nicht so fromme Frau, wiederholte dann immer den einen Satz: „Wenn wir einen Treffer kriegen, dann sind wir alle futsch!“ Damit fiel sie aber einem älteren Mitbewohner, der neben ihr saß, auf die Nerven. Er schnauzte sie an, sie solle gefälligst ihr dummes Mundwerk halten oder sie könnte was erleben. Ihr dummes Geschwätz wäre nämlich Wehrkraftzersetzung und was darauf stünde, das wüsste sie ja wohl.
Der Hinweis von dieser Frau, wonach wir bei einem Treffer alle futsch wären, bewog meine Mutter, beim nächsten Fliegeralarm mit uns Kindern Schutz in einem öffentlichen Luftschutzkeller zu suchen. Es war der Keller einer Schule auf dem Fürstenwall, der durch verschiedene Maßnahmen zu einem Luftschutzkeller ausgebaut wurde. Auch hier wurde meine Mutter, und zwar durch einen älteren Herrn, darauf hingewiesen, dass dieser Keller keineswegs sicher war. „Ja meinen Sie denn, dass uns hier eine Bombe treffen kann?“ fragte meine Mutter den Herrn. „Aber ja sicher, die Engländer, diese Verbrecher, wollen uns doch alle kaputt machen!“ lautete die überzeugende Antwort. Damit stand für meine Mutter fest, dass wir diesen Luftschutzkeller auch nicht mehr aufsuchen würden.
Mit diesem Entschluss rettete sie uns wahrscheinlich das Leben, denn schon beim nächsten Luftangriff, den wir im Luftschutzkeller der PROVINZIAL verbrachten, schlug eine schwere Bombe genau neben der Schule auf den Bürgersteig ein und riss ein großes Loch in die Hauswand und zerstörte dabei auch Teile des Luftschutzkellers. Es gab mehrere Tote und viele zum Teil schwer verletzte Menschen. Unter den Toten war auch jener Herr, der meine Mutter auf die unzureichende Sicherheit des Schulkellers aufmerksam machte. Später, wenn in meiner Familie über die Schrecken des vergangenen Krieges gesprochen wurde, stellte meine Mutter sich die Frage, warum dieser Mann denn trotz der ihm bekannten Sicherheitsmängel in diesen Luftschutzkeller ging. Mein Vater meinte dann, dass es aus der Sicht dieses Mannes wahrscheinlich egal war, da die meisten Luftschutzkeller nicht ausreichend sicher waren.
In der Folgezeit wechselte meine Mutter immer wieder den Luftschutzkeller und jedes Mal hatte sie richtig gewählt. Später, als mittlerweile Erwachsenem, ist mir klar geworden, dass meine Mutter in all den Fällen ihrem Instinkt folgte. Ihrem Instinkt hatten wir es zu verdanken, dass wir den Krieg überleben konnten. Und mein Vater? Der war erstens ein Phlegmatiker, zweitens aber ging er nur selten mit in den Luftschutzkeller, weil er der Wachbereitschaft zugeteilt wurde. Die Männer der Wachbereitschaft sorgten dafür, dass während eines Angriffs nicht geplündert wurde und sie sollten im Falle von Bränden versuchen, das Feuer zu löschen.
Eines Tages bzw. eines Nachts war wieder Fliegeralarm und wir eilten zur PROVINZIAL, um in deren Luftschutzkeller Schutz zu suchen. Während die meisten Menschen stumm und voller Angst auf den Bombenangriff warteten, sang eine junge Frau bzw. Fräulein, wie man damals sagte, plötzlich völlig unerwartet den Schlager „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, nach jedem Dezember folgt immer ein Mai!“ Das veranlasste eine andere Frau zu der Bemerkung: „Da hätten Sie aber mal die Toten vom letzten Angriff sehen sollen, dann würden Sie jetzt nicht so lustig singen!“
Dann kam auch schon der Angriff. Es krachte und rumste, die Wände wackelten. In der Nachbarschaft gab es einige Sprengbomben-Volltreffer. Viele Häuser brannten lichterloh. Die wurden aber nicht von Sprengbomben getroffen, sondern von solchen Stabbrandbomben, mit deren einer ich ja schon eine Erfahrung gemacht hatte. Das waren achteckige Stäbe mit einem Durchmesser von etwa 5 cm und einer Länge von etwa 70 cm. Diese mit Phosphor gefüllten Stabbrandbomben durchschlugen die Dachziegel der Häuser und setzten die Dachstühle in Brand, was von den Bewohnern, die sich ja während des Luftangriffs in den Schutzkellern aufhielten, zunächst nicht bemerkt wurde. Den Brand bemerkten sie erst nach der Entwarnung, als sie die Schutzkeller verlassen konnten und dann feststellen mussten, dass die Bemühungen der Männer von der Wachbereitschaft leider vergeblich waren. Dann standen meistens nicht nur die Dachstühle, sondern auch die darunter liegenden Obergeschosse in Flammen. Die Böden der meisten damaligen Häuser waren nämlich nicht aus Beton, sondern aus Holz. Die Feuerwehren konnten bei der Vielzahl der Brände nur wenige Brandstellen rechtzeitig erreichen, sodass fast immer die Hausbewohner zusammen mit den Wachbereitschaften die Feuer selbst löschen mussten. Das gelang aber nur in wenigen Fällen, sodass die Häuser vollständig ausbrannten, was die Menschen fast hilflos mit ansehen mussten. Nicht selten sind auch Menschen bei den Löschversuchen ums Leben gekommen oder sie erlitten schlimmste Verbrennungen.
Nun war es aber so, dass nicht jeder Fliegeralarm auch einen Luftangriff im Gefolge hatte. Die englischen Bombergeschwader, die im Gegensatz zu den Amerikanern, die sich später an den Bombardierungen beteiligten, grundsätzlich nur in der Nacht kamen, veranstalteten immer ihre Täuschungsmanöver, sodass die deutsche Luftabwehr nie genau sagen konnte, welche Stadt nun „dran“ war. Es konnte zunächst immer nur die ungefähre Angriffsrichtung erkannt werden. Danach konnte also Aachen, Köln, Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg oder irgendeine andere Stadt im Ruhrgebiet „dran“ sein. Die Alarmsirenen heulten dann über all den möglichen Angriffszielen und überall hasteten die Menschen in die Schutzräume, um voller Angst auf den Angriff zu warten. Die Angst ließ die Menschen erst los, wenn die Entwarnung kam. Einmal nach so einem „Gott sei Dank umsonst“ verbrachten Kelleraufenthalt, bekam eine Frau einen Lachanfall und rief laut mit singender Stimme: „Morgen gibt es neue Kartoffeln, neue Kartoffeln, die schmecken besser!“ Jemand antwortete: „Nun gehen Sie schon nach oben, Sie mit den neuen Kartoffeln!“
Eines Nachts, es war wieder ein „Gott sei Dank umsonst“-Aufenthalt im Luftschutzkeller der PROVINZIAL, da wurde über die Sicherheit dieses Kellers gesprochen. Dieser Keller sollte angeblich ein Höchstmaß an Sicherheit bieten und eigentlich war die PROVINZIAL ein echter Geheimtipp für Schutzsuchende. Besonders der Luftschutzwart, er trug einen dunkelblauen Feuerwehrhelm, betonte immer wieder, dass dieser Keller absolut sicher wäre. Für die letzten Zweifler hatte er ein besonders überzeugendes Argument: „Da kann sogar eine 10-Zentner-Bombe kommen, hier kann uns nichts passieren. Im Übrigen kommen die Tommies, diese Lumpen, gar nicht mehr bis hier her, wir haben nämlich die beste Flak der Welt! Damit holen wir die alle runter, bevor die Düsseldorf überhaupt erreicht haben!“
Nun stellte jemand eine Frage, die bei meiner Mutter sämtliche Alarmsysteme aktivierte. Sie bekam dann einen Blick, den ich später als „Hühnerblick“ bezeichnete. Es war der Blick einer Glucke, die ihre Küken in Gefahr sah. Die Frage, von einem beinamputierten Herrn gestellt, lautete: „Wenn aber doch ein feindlicher Flieger durchkommt und seine Bombe genau in den Luftschacht hier herein fällt, dann sind wir doch alle tot, oder?“ Der Hühnerblick meiner Mutter ließ den Luftschutzwart nicht los. Sie hatte ihn damit gewissermaßen fest genagelt. Er schaffte es dann, zu Boden zu blicken und so konnte er eine Erklärung abgeben, die für die Meisten möglicherweise zufrieden stellend war, nicht aber für meine Mutter. Er meinte nämlich, dass es erstens für die Engländer unmöglich wäre, an unserer Flak vorbei zu kommen und zweitens genauso unmöglich, unseren Luftschacht zu treffen. Das wäre etwa so, wie wenn man aus einer Entfernung von 500 Metern mit einem Gewehr einen Stecknadelkopf treffen wollte. Das sollte ihm doch bitte sehr erst mal einer vormachen. Nein, nein, dieser Luftschutzkeller wäre absolut sicher und er würde deshalb auch seine Tochter mit den Enkelkindern immer in diesen Keller schicken. Während der beinamputierte Herr nur sagen konnte: „Ihr Wort in Gottes Ohr!“, behielt meine Mutter den Hühnerblick und das bedeutete, dass der nächste Luftschutzkeller ein anderer sein würde. Das war auch gut so, denn bei einem der nächsten Luftangriffe, den unsere Luftabwehr nicht verhindern konnte, wurde der Stecknadelkopf getroffen. Die Bombe, die in den Luftschacht sauste, war zwar nur von der kleineren Sorte, aber es gab einige Tote und Schwerverletzte. Das Gebäude der PROVINZIAL wurde dabei erheblich beschädigt. Auf Seite 42 des Buches „Hurra, wir leben noch! Düsseldorf nach 1945“ ist das zerstörte PROVINZIAL-Gebäude auf einem Foto zu sehen.
Meine Mutter brauchte aber nicht selbst Ausschau nach einem anderen Schutzraum zu halten, denn der für uns zuständige Blockwart teilte ihr mit, dass für uns in dem neuen Bunker unter dem Carl-Platz ein Raum für eine ganze Woche reserviert war. Wie ich mich erinnere, befand sich der Raum im zweiten Untergeschoss des Tiefbunkers und als wir ankamen, wurden wir von einer NSV-Schwester zu unserem Raum geführt. Es war ein sehr kleiner Raum mit zwei Etagenbetten. Der Geruch in dem ganzen Bunker hatte etwas aufdringlich Chemisches. NSV war übrigens die Abkürzung für „National-Sozialistische Volksfürsorge“.
Unsere Nachbarin in dem Bunker, meine Mutter kannte sie vom Sehen, äußerte den Verdacht, dass wir wohl alle „Hopps“ gehen würden, wenn die Frischluftzentrale von einer Bombe getroffen würde. Aber sonst wäre der Bunker absolut sicher. An den Hühnerblick meiner Mutter erinnere ich mich auch heute noch ganz genau.
Wieso aber sollten wir nur für eine Woche Schutz in dem Bunker finden? Der Krieg würde doch voraussichtlich viel länger dauern! Ja, die betreffenden Familien wurden per Los ausgewählt, um die Überlebenschancen möglichst gerecht zu verteilen und im Übrigen konnten die Menschen sich ja auch evakuieren lassen. Das Wort „evakuieren“ bedeutet im eigentlichen Sinne, dass ein Vakuum, also ein leerer Raum hergestellt werden soll. Es wurde aber auch im Sinne von „entleeren“ gebraucht. Im Krieg wurde dieses Wort dann gebraucht, wenn eine Stadt oder ein anderes bedrohtes Gebiet von seinen Bewohnern vorübergehend geräumt wurde. So wurden dann aus den Verschickten die Evakuierten.
Seit Anfang der 50er Jahre befindet sich auf dem Carl-Platz der Düsseldorfer Marktplatz und dass sich darunter einer der größten Bunker befindet, wissen nur wenige. An den Bunker habe ich aber noch andere Erinnerungen: Zunächst erinnere ich mich daran, als er gebaut wurde:
Meine Mutter hatte mich mal wieder zum Einkaufen mit in die Altstadt genommen. Vor einem Cafe standen etliche Leute, um den Arbeitern zuzusehen. Es waren besondere Arbeiter, die sich deutlich von allen Arbeitern unterschieden, denen ich bisher bei ihrer Arbeit zusehen konnte. Sie trugen alle die gleichen, blau-weiß gestreiften Anzüge und jeder hatte eine aufgenähte Nummer auf der Jacke.
Mir, dem 6-jährigen, fiel das enorme Arbeitstempo auf, das sie an den Tag legten. Ja wirklich, sie arbeiteten wie um die Wette. Uns Kindern blieb auch nicht der gehetzte Ausdruck in den Augen der Arbeiter verborgen. Es waren aber auch Männer in schwarzen Uniformen da und die trieben die Arbeiter an. Sie waren mit dicken Knüppeln bewaffnet und damit schlugen sie auf die Arbeiter ein. Auch mit Fußtritten geizten die Bewacher nicht. Ob ich den Mund aufsperrte oder irgendeine andere Gefühlsregung zeigte, weiß ich nicht mehr. Aber es war da so eine bebrillte, alte Frau mit einem Affengesicht, die sich genötigt fühlte, mir das, was ich da sah, zu erklären. Sie sagte: „Dat sind janz böse Männer, die de kleine Kindersches de Fingersches abjeschnitte habe. Die müsse bestraft werde, damit die dat nit mehr machen tun! Jut, dat wir de Führer habe, de tut nämlisch aufpasse!“ Wer der Führer war, wusste ich ganz genau, denn in der Schule wurde vor einiger Zeit sein Geburtstag gefeiert und der Herr Rektor hat uns Schülern erzählt, dass der Führer uns alle gerettet hatte. Die größeren Schüler sangen ein Lied, an dessen Text ich mich allerdings nicht mehr erinnern kann. Nun erfuhr ich von dieser alten Frau, dass der Führer auf uns aufpassen würde.
Meiner Mutter war die Frau wohl nicht ganz geheuer, denn sie ließ sich im Gegensatz zu ihrer sonstigen Gewohnheit nicht dazu verleiten, mit der alten Frau ein Gespräch anzufangen. Wir gingen also weiter und dass wir in diesem Bunker einmal Quartier beziehen würden, daran dachte meine Mutter wohl nicht. Später erfuhr ich, dass die blau-weiß gestreiften Arbeiter KZ-Häftlinge waren. Die schwarz uniformierten Männer aber waren Mitglieder der SS.
Nun zu der zweiten Erinnerung, die mich mit dem Carl-Platz-Bunker verbindet: Nach dem Kriege, Anfang der 50er Jahre, wurde im nördlichen Teil des Bunkers auf der ersten Tiefgeschoss-Ebene ein Lichtspieltheater, also ein Kino, eröffnet. Der Eingang war ziemlich genau an der Stelle, wo meine Mutter und ich den KZ-Leuten bei der Zwangsarbeit zusahen. Das Kino, es hatte den schönen Namen „Kurbelkiste“, befand sich im vorderen Haupteingang des ersten Tiefgeschosses und war mit keinem anderen Kino vergleichbar. Es war ein Non-Stopp-Kino, das heißt, Eintritt war zu jeder Zeit. Die Eintrittskarten kosteten auf allen Plätzen 50 Pfennige, was etwa 25 EURO-Cent entspricht. In den meisten anderen Kinos kostete die billigste Eintrittskarte so um die 1 DM und darin lag der besondere Charme der Kurbelkiste, denn bei meinem monatlichem Taschengeld von 5,00 DM im ersten Lehrjahr als Technischer Zeichner konnte ich monatlich zehnmal ins Kino. Dafür nahmen meine Freunde und ich auch einige Nachteile in Kauf: Der erste Nachteil bestand in dem eher geringwertigen Angebot an Filmen. Es waren meist amerikanische Streifen aus den frühen 30er Jahren, die wohl in Amerika keiner mehr sehen wollte. Da wurden Filme wie „El Zorro“, „Dr. Fu-Man-Schu“, „Rauchender Colt“, „Lasst ihn baumeln“ und ähnliche cineastische Kostbarkeiten gezeigt. Den Ansprüchen von uns 15-jährigen wurde damit aber voll Genüge getan. Als Hauptnachteil musste aber die Bestuhlung angesehen werden. Während alle anderen Lichtspieltheater mindestens Klappsessel hatten, bestand die Bestuhlung der Kurbelkiste nur aus alten Gartenstühlen und nicht immer erwischte man einen solchen mit intakter Rückenlehne. Ein weiterer, auch nicht ganz unwesentlicher Nachteil, wurde aber angesichts der billigen Eintrittskarten ebenfalls vom Publikum toleriert. Das war der Toilettengeruch. Der umwehte diejenigen, die im Mittelparkett Platz genommen hatten. Dafür war die Belüftungsanlage verantwortlich, die im Krieg möglicherweise doch einen Treffer abgekriegt hatte. Ab meinem zweiten Lehrjahr verbesserte sich meine finanzielle Situation so deutlich, dass ich die Kurbelkiste links liegen lassen konnte, da ich mir nun den Besuch des EUROPA-Palastes leisten konnte. Meine Eltern hatten mir nämlich das monatliche Taschengeld auf immerhin 8,00 DM erhöht.
Nun aber zurück zu dem Bunkeraufenthalt: Während der ganzen Woche, die wir in dem Bunker verbrachten, gab es keinen einzigen Fliegeralarm für Düsseldorf. Hätten wir also in unserer Wohnung bleiben können? Theoretisch ja, aber praktisch musste man jeden Tag mit einem Luftangriff rechnen.