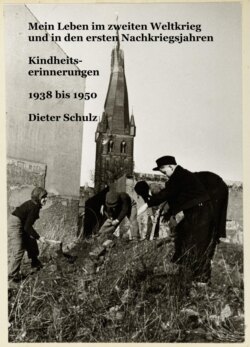Читать книгу Mein Leben im zweiten Weltkrieg und in den ersten Nachkriegsjahren - Dieter Schulz - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zurück in Düsseldorf
ОглавлениеJa, und dann standen wir, meine Mutter und wir drei Kinder mit viel Gepäck auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof. Unser Vater nahm uns in Empfang und da unsere Wohnung auf der Kronen-Straße bis dahin die Luftangriffe unbeschädigt überstanden hatte, gab es hinsichtlich unserer Unterbringung keine Probleme. Wir wohnten also wieder in Düsseldorf in unserer vertrauten Wohnung auf der Kronen-Straße Nr. 29. Bei Fliegeralarm suchten wir den Luftschutzkeller der Friedenskirche an der Flora-Straße auf und das wurde dann zur Routine. Einige Häuser weiter war übrigens die Druckerei Granderath. Hier hatte mein Vater seinen kriegswichtigen Posten. Er musste da irgendwelche Formulare für die Großdeutsche Wehrmacht herstellen. Sein Chef, der Herr Granderath, hatte einen riesengroßen Hund. Es war ein Bernhardiner mit dem Namen Barry. Mein Vater führte ihn öfters aus und ich durfte ihn hin und wieder dabei begleiten. Das war zwar wunderschön, aber Barry hatte eine richtige Sabberschnauze, die er auch schon mal gegen mein Gesicht drückte. Das nahm ich ihm aber nie besonders übel. Barry hatte auf dem Hof der Druckerei einen großen Zwinger mit einer Hütte, die wie das Hexenhaus aus dem Märchen von Hänsel und Gretel aussah. Dann gab es da noch einen Teich mit Goldfischen und mehrere Sträucher machten aus dem Zwinger ein kleines Hundeparadies. Ja, ja, der Herr Granderath hatte seinen Barry richtig lieb
Die schönen Spaziergänge mit Barry änderten aber nichts daran, dass wir uns im Kriege befanden und in den meisten Nächten in den Luftschutzkeller mussten, da feindliche Flieger im Anflug waren. So auch dieses Mal. Wie immer eilten wir zur Friedenskirche an der Flora-Straße und in deren Keller warteten wir auf die Detonationsgeräusche der feindlichen Bomben. Es blieb aber ruhig und der Luftschutzwart meinte, dass bald die Entwarnung käme, weil das Geschwader abgedreht hätte. Die Engländer würden wohl Köln bombardieren. „Gott sei Dank Köln“ dachte wohl der eine oder andere und die Meisten erhoben sich schon von ihren Stühlen, als eine mittlere Detonation den Luftschutzkeller erzittern ließ. Danach war erst mal eine Totenstille und dann kam doch noch der langgezogene Heulton der Entwarnung.
Was war geschehen? Nachdem wir den Luftschutzkeller verlassen hatten, erfuhren wir es: Ein einzelner englischer Flieger, der sich wohl verirrt hatte und den Anschluss zu seinem Geschwader nicht mehr fand, hatte seine Bombenfracht über Düsseldorf ausgeklinkt. Eine der Bomben, es war eine kleinere, fiel in den Hof der Druckerei Granderath, ganz nahe bei Barry`s Zwinger. Das Fatale aber war, dass Barry in dieser Nacht, während dieses Bombenabwurfs in seinem Zwinger war. Herr Granderath kannte nämlich jemanden von der Luftabwehr und der hatte ihn schon früh darüber informiert, dass diesmal nicht Düsseldorf, sondern Köln „dran“ sei. Also glaubte Herr Granderath, seinen Barry unbesorgt im Zwinger lassen zu können, anstatt ihn mit zu sich in seinen persönlichen Luftschutzkeller zu nehmen. Dass da so ein englischer Flieger sich verirren könnte und seine Bomben über Düsseldorf abwerfen würde, damit hatte Herr Granderath nicht gerechnet. Mein Vater meinte, dass Barry ohne Schmerzen sofort tot gewesen sei und dass das gut für ihn war. Ich lernte sehr früh, dass der Tod als solcher nicht unbedingt das Schlimmste ist. Es gab schlimmeres, und das waren die körperlichen und seelischen Schmerzen, die der Krieg den Menschen zufügte.
Vor dem evangelischen Krankenhaus auf dem Fürstenwall standen zwei Omnibusse, die uns Kindern deshalb auffielen, weil auch die Fenster schneeweiß gestrichen waren. Die Busse waren durch große, rote Kreuze als Krankenwagen gekennzeichnet. Wir gingen da hin, um zu sehen, was los war. Zu sehen war zunächst nichts. Der erste Bus hatte beide Türen geschlossen. Aber die Fenster standen auf „Kipp“. Dann hörten wir Töne, die wir zunächst nicht als menschliche Laute erkannten. Uns wurde dann aber schnell klar, dass hier Menschen große Schmerzen hatten und dass ihnen die Kraft fehlte, um laute Schmerzensschreie ausstoßen zu können. Es war ein quengelndes Stöhnen, Wimmern, Japsen, Bibbern und Winseln, was wir da hörten.
„Ihr geht jetzt mal schön nach Hause, Ihr habt hier nichts verloren!“ Der das sagte, war einer der Bus-Fahrer, er trug eine Sanitäter- Uniform. Wir gingen zum nächsten Bus und da war eine Tür geöffnet. Zu sehen waren wie Etagenbetten übereinander angeordnete Tragbahren. Die Menschen, die darauf lagen, konnten als Menschen nur vermutet werden, denn sie waren wie Mumien mit Verbandmaterial verpackt. Es waren aber keine Mumien, denn sie stießen die gleichen Laute aus, wie die Menschen im vorderen Bus. Auch hier wurden wir fort geschickt. Natürlich gab es auch erwachsene Neugierige und aus deren Gesprächen hörten wir Kinder heraus, dass es sich bei den Unglücklichen in den beiden Bussen um Bombenopfer handelte, die allerschlimmste Verbrennungen durch Phosphor erlitten hatten und dass das evangelische Krankenhaus sie nicht aufnehmen konnte, da es bereits überfüllt war.
Außer den Luftschutzkellern und Bunkern, die Schutz gegen Bomben bieten konnten, gab es noch so genannte Splitterschutzgräben. Das waren etwa 1,5 Meter breite und 2,5 Meter tiefe Gräben, deren Wände mit Holzpalisaden abgestützt wurden. Die Decken bestanden ebenfalls aus Holzstämmen, die mit einer etwa 1,0 Meter hohen Erdschicht abgedeckt wurden. Die Böden bestanden aus fest gestampftem Lehm.
Da drinnen konnte man also Schutz vor Bombensplittern und Stabbrandbomben finden. Im Ernstfall hätten die Schutzsuchenden sich aber sehr geekelt. Warum? Wegen der Exkremente! Irgendwelche Leute benutzten diese Schutzgräben als Toiletten. Bei uns in der Nähe, auf dem Fürstenwall / Ecke Kronprinzen-Straße, war so ein Splitterschutzgraben und wir Kinder gingen da mal rein. Es stank schlimmer als in der Schultoilette.
Ich glaube, es war auf dem Nachhauseweg von der Schule, als Rike mich aufforderte, mit ihr doch in den Splittergraben zu gehen. Weil ich den Gestank da drinnen kannte, hatte ich zwar zunächst keine Lust, ging dann aber doch mit. Drinnen hob Rike ihren Rock hoch, um mir zu zeigen, was sie da hatte. Da sie keine Hose trug, sah ich sofort, dass bei ihr etwas anders war als bei mir. Rike hatte mir gegenüber offensichtlich einen Wissensvorsprung, allerdings schien sie sich im Konkreten nicht ganz sicher zu sein, deshalb wohl forderte sie mich auf, mich meinerseits frei zu machen. Dieser Situation war ich nicht gewachsen, und ich rannte so schnell ich konnte nach Hause, um meiner Mutter einen lückenlosen Bericht abzustatten. Was zuerst kam, war der Hühnerblick. Dann zog sie sich den Mantel an und eilte zu Rikes Mutter. Dabei durfte ich sie nicht begleiten und danach hat Rike, die übrigens richtigerweise Friederike hieß, meine Nähe nicht mehr aufgesucht.
Es kam der Herbst 1942, es kam das Weihnachtsfest und es kam der Winter 1942/43. Der Winter war sehr kalt und brachte auch viel Schnee. Obwohl das Weihnachtsfest doch ein Fest der Freude sein sollte, waren die Menschen sehr ernst, ja, es machte sich sogar eine gedrückte Stimmung bemerkbar, die auch uns Kindern nicht verborgen blieb. Das lag aber nicht daran, dass es kaum noch etwas zu kaufen gab, um das Weihnachtsfest schön ausrichten zu können. Nein, der Grund war die Katastrophe von Stalingrad. Stalingrad, dieses Wort fiel öfters, wenn die Erwachsenen sich unterhielten. Es hatte etwas Geheimnisvolles und wenn darüber gesprochen wurde, dann mit einer besonderen Vorsicht. Es wurde darauf geachtet, dass wir Kinder nicht allzu viel mitbekamen. Was das für eine Katastrophe war, erfuhr ich erst nach dem Kriege, und auch, dass die Väter mehrerer meiner Mitschüler in Stalingrad gefallen waren.
Das war wohl auch der Grund dafür, dass die russischen Zwangsarbeiter immer schlechter behandelt wurden. Die meisten von ihnen hatten nur Sommerkleidung und litten unter der Kälte besonders schlimm. Als wenn das nicht genug gewesen wäre, wurden sie auch noch mit der Lederpeitsche geschlagen. Der Aufpasser fand immer einen Grund, um auf die Russen einzuschlagen. Das geschah auch vor den Augen von uns Kindern.
Was war der Aufpasser für ein Mensch, der so etwas machte? Der Mensch war ein alter Mann, der einen grünen Lodenmantel, so eine Art Jägermantel, trug. Der ebenfalls grüne Hut war mit einer pinselähnlichen Bürste verziert und dass er wie ein richtiger Jäger aussah, dafür sorgten die Schaftstiefel, die er trug. Sein Gesicht war stets gerötet. Wahrscheinlich hatte er permanent große Hassgefühle und die ließ er an den Russen aus. Einmal schlug er besonders brutal zu. Das war, als er zwei Russen dabei erwischte, wie sie aus einer Mülltonne Kartoffelschalen heraus nahmen. Danach hatte er die Frau, die ihre Abfälle in die Tonne geworfen hatte, aufs Heftigste beschimpft. Angeblich hatte sie Lebensmittel verschwendet und er drohte ihr mit einer Anzeige. Sie würde dort hinkommen, wo sie selbst nichts mehr zu fressen bekäme. Von meinen Eltern erfuhr ich später, dass die Frau tatsächlich gegen eine Verordnung verstoßen hatte, die darin bestand, dass Kartoffeln wegen der knappen Ernte nicht mehr geschält werden sollten. Die staatlich verkündete Parole lautete daher: „NUR PELLKARTOFFELN“. Aus diesem Grund bekam die Frau auch tatsächlich eine Verwarnung.
Die Russen wurden übrigens zum Beseitigen des Schuttes der durch die Bomben zerstörten Häuser eingesetzt. Sie mussten aber auch die einsturzgefährdeten Mauern und Hauswände der ausgebrannten Häuser beseitigen. Wie gefährlich das war, wurde auch uns Kindern klar, wenn wir sahen, dass so ein armer Russe hoch oben über dem fünften Stock ungesichert auf der Mauerkrone stand und mit einem schweren Vorschlaghammer die Ziegelsteine und ganze Mauerstücke unter seinen Füßen abschlug, die dann nach unten fielen. Er schlug damit buchstäblich den Boden unter seinen Füßen weg. Dass dabei nicht wenige Russen tödlich verunglückten, weiß ich von meinem Vater. Der erklärte mir später, dass im Grunde genommen jeder Unfall eines Russen ein tödlicher war, weil jede Verletzung, die einen Russen arbeitsunfähig machte, dessen Tod bedeutete. Die ärmsten wurden nämlich nur notdürftig medizinisch versorgt und die Lebensmittel wurden so drastisch gekürzt, dass sie verhungern mussten.
Am 8. April 1943 hatte ich Geburtstag. Ich wurde acht Jahre alt. Mein Geburtstagsgeschenk war kriegspädagogisch wertvoll. Es war ein zweiteiliges Geschenk, bestehend aus einem großen Schlachtschiff und einem kleinen Torpedoboot. Schokolade gab es nicht. Aber die von meiner Mutter gebackenen Plätzchen waren auch sehr lecker. Das etwa 40 cm lange Schlachtschiff war ein englisches und demzufolge ein feindliches. Ein solches Schlachtschiff durfte ein deutscher Junge also nur besitzen, um es zu vernichten. Der Vorteil dieses Kriegsschiffes lag nun darin, dass man es sehr oft vernichten konnte. Es bestand aus etwa 20 hölzernen Einzelteilen, die lose zusammen zu setzen waren. Das schöne aber war, dass es von dem deutschen Torpedoboot zerstört werden konnte. Wie das ging?
Das Schlachtschiff hatte in seinem Rumpf eine Vorrichtung, die aus einer Stahlfeder und einem Wippbrettchen bestand, ähnlich wie bei einer Mausefalle. Bevor man die Einzelteile des Schlachtschiffes zusammensetzte, musste zuvor die Feder gespannt werden, also ganz genau so, wie bei einer Mausefalle. Nun aber kam das Raffinierte: Der Schiffsrumpf hatte an einer Seite ein rundes Loch in Linie mit einem kleinen Hebelchen, mit dem die Stahlfeder ausgelöst werden konnte. Damit das aber zu bewerkstelligen war, musste ein Holzbolzen mit etwa 1,5 cm Durchmesser vorsichtig in das seitliche Loch des Schlachtschiffes hinein geschoben werden, aber wirklich vorsichtig, damit man die Feder im Schiffsrumpf nicht vorzeitig auslöste.
Und jetzt war das Torpedoboot dran. Auch hier war eine Stahlfeder das wichtigste Teil, allerdings keine Mausefallenfeder, sondern eine so genannte Schraubenfeder, die in dem Bug des Torpedobootes untergebracht war. Bugseitig hatte das Torpedoboot eine entsprechende Bohrung, in welche man das Torpedo einschieben musste und dabei die Schraubenfeder vorspannte. Das Torpedo war ein rot lackierter, etwa 6 cm langer Holzbolzen mit etwa 1,5 cm Durchmesser. Auch hier war es wieder ein Holzhebelchen, mit dem die Schraubenfeder ausgelöst und dadurch das Torpedo heraus katapultiert wurde. Das spannende Spiel bestand nun darin, das Torpedoboot so in Position zu bringen, dass der in dem Schlachtschiff eingesetzte Bolzen getroffen wurde. Wenn das gelang, wurde das Schlachtschiff durch die Mausefallenfeder in alle 20 Einzelteile auseinander gerissen. Dabei flogen die Teile etwa einen Meter hoch und verteilten sich im ganzen Wohnzimmer. Den richtigen Treffer zu machen, war aber gar nicht so leicht, und anfangs betrog ich mich selbst, indem ich mit dem Finger auf den Holzbolzen des Schlachtschiffes drückte. Im Laufe der Zeit erreichte ich aber ein hohes Maß an Treffsicherheit, so dass mein Torpedoboot das feindliche Schlachtschiff aus einer Entfernung von 1,5 Metern mit größter Sicherheit treffen und vernichten konnte. Ich kann mich nicht erinnern, in der Folgezeit jemals ein schöneres Spielzeug besessen zu haben. Dabei war beides gleichermaßen schön: Das Schlachtschiff zu zerstören und es wieder aufzubauen.
Es wurde bald sommerlich warm und meine Freunde und ich erfrischten uns gerne mit Brausepulver. Normalerweise machte man damit Limonade, indem man das Brausepulver zuerst in ein Glas gab und danach das Glas mit Wasser füllte. Das Wasser schäumte dann auf, bekam eine gelbe Färbung wie Zitronenlimonade und schmeckte auch so. Das war uns aber zu umständlich. Wir schütteten das Pulver auf den Handteller und leckten es auf. Das Prickeln auf der Zunge war dann ein echter Hochgenuss. Das Brausepulver konnte man üblicherweise im Feinkostgeschäft Oeser kaufen. Eines Tages hatte Herr Oeser kein Brausepulver mehr und erklärte uns, dass es für die Soldaten gebraucht würde. Wir sollten es doch mal in der Drogerie dahinten versuchen, da wäre bestimmt noch etwas zu haben. Also ging ich mit meinem Freund Karl-Heinz zur Drogerie an der Ecke Flora-Straße.
Mit großer Freude sahen wir den Karton mit den vielen kleinen Brausetütchen auf der Theke. Vor uns wurde gerade noch älterer Herr bedient. Als der alles hatte und schon gehen wollte, drehte er sich noch mal um und sagte: „Ach, können Sie mir noch zehn Brausetütchen geben, die möchte ich meinem Sohn schicken, wissen Sie, der ist nämlich im Afrikacorps!“ „Oh“, sagte der Drogist, „in Afrika, da ist mein Neffe auch. Der lässt sich auch immer etwas von dem Brausepulver zuschicken. Mein Bruder hat ihm vorige Woche einen ganzen Karton zugeschickt. Wissen Sie was, ich gebe Ihnen hier den Karton mit, da sind noch mehr als fünfzig Stück drin. Die brauchen Sie mir nicht zu bezahlen. Grüßen Sie Ihren Sohn recht herzlich von mir. Tja, leider gibt es kein Brausepulver mehr, wegen der Kriegsbewirtschaftung, Sie wissen ja!“ Karl-Heinz und ich konnten unsere Enttäuschung kaum verbergen und leise schimpfend verließen wir die Drogerie.