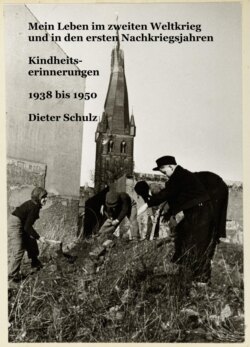Читать книгу Mein Leben im zweiten Weltkrieg und in den ersten Nachkriegsjahren - Dieter Schulz - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bad Kissingen
ОглавлениеEs war wieder Abend, als der Zug los fuhr und unser Ziel war diesmal Bad Kissingen. „Bad Kissingen“, erklärte mein Vater, „ist eine sehr vornehme Stadt, da durften früher nur die reichen Leute hin. Bad heißt es deshalb, weil es ein Heilbad ist und weil kranke Menschen da wieder gesund werden können. Euch wird es da bestimmt gut gefallen!“
Zu uns ins Abteil kamen ein Mann und eine Frau, die nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Eltern und meinen sechsjährigen Bruder Günter einen sonderbaren Eindruck machten. Befremdlich war zunächst, dass sie nicht grüßten. Die Frau fiel durch ihre enorme Größe und Leibesfülle auf. Dass der extrem dicke Bauch ein Indiz für eine fortgeschrittene Schwangerschaft war, konnte ich damals nicht wissen. Der Mann, es war ihr Ehemann, war im Vergleich zu ihr ausgesprochen klein und mager. Er trug eine Soldatenuniform. Das Käppi legte er während der Reise nicht ab. Zu diesen äußerlichen Auffälligkeiten kam eine sprachliche Besonderheit: Die beiden sprachen ein Platt, das auch in meinen Ohren ziemlich vulgär klang. Das hörte sich beispielsweise so an, als die Frau, offensichtlich eine starke Raucherin, ihren Mann um eine Zigarette bat: „Donn misch een Zijarett!“ Wahrscheinlich waren die aus Neuss. Trotz meines kindlichen Alters von acht Jahren fiel mir die Unterwürfigkeit des Mannes auf, als er ihr das Päckchen mit den Zigaretten hinhielt und lächelnd sagte: „He, nimm Disch een!“ Sie nahm sich eine Zigarette und bat um, nein, sie verlangte Feuer mit folgenden Worten: „Donn misch Fuer!“
Schnell stand das Abteil unter dichtem Zigarettenqualm und dass meine Eltern mit drei Kindern in dem Abteil saßen, störte die Herrschaften nicht. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass es mich auch nicht störte. Meine Eltern haben später sehr negativ über diese Menschen gesprochen. Während der Fahrt sagten meine Eltern aber nichts, jedoch als die beiden einmal das Abteil verließen, um sich auf dem Gang die Beine zu vertreten, raunte mein Vater meiner Mutter zu, dass es sich bei diesen Leuten bestimmt um Kommunisten handeln würde. Diese Vermutung meines Vaters wirkte sich bei mir dahin gehend aus, dass ich für mindestens das nächste Jahrzehnt eine feste Vorstellung davon hatte, wie Kommunisten aussahen. Na ja, die beiden kamen bald wieder zurück ins Abteil, und die Frau setzte ihre Raucherei fort. Der Mann war wohl Nichtraucher und er beschränkte sich darauf, die Zigaretten parat zu halten. Dabei erkannte ich die Marke. Es waren Eckstein-Zigaretten! Woher ich die kannte? Ich war doch eifriger Sammler der Eckstein-Schecks. Das waren kleine Gutscheine mit mehrstelligen Zahlen. Wenn man eine bestimmte Anzahl zusammen hatte, konnte man die einreichen und man bekam etwas dafür.
Genaueres weiß ich zwar nicht mehr, jedoch erinnere ich mich sehr genau an die erste Geschäftstransaktion, die ich mit diesen Schecks machte. Ich zeigte dem Werner, einem Jungen aus der Nachbarschaft, meine Zigarrenkiste, die mit Schecks gefüllt war. Er bat mich um ein paar Schecks und am liebsten hätte er die ganze Kiste genommen. Nun hatte Werner eine richtige Dampfmaschine. Wie sie genau funktionierte, wusste ich zwar nicht, aber ich hätte sie gerne besessen. Wir waren uns deshalb schnell handelseinig: Er bekam die Zigarrenkiste mit den Schecks und ich die Dampfmaschine.
Beide waren wir überzeugt davon, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Werners Mutter sah das wohl etwas anders. Sie kam noch am Nachmittag desselben Tages, um den Deal rückgängig zu machen. Sie guckte mich vorwurfsvoll an und schüttelte missbilligend den Kopf. Meine Mutter, die zunächst nicht wusste, worum es ging, musste ich erst einmal über den Tausch informieren. Sie war dann sofort damit einverstanden, das Geschäft rückgängig zu machen, dennoch machte Werners Mutter so eine Bemerkung vom Übervorteilen. Ich nahm also meine Zigarrenkiste in Empfang und händigte dem Werner seine Dampfmaschine aus. Der Verdacht, dass Werner ein paar Schecks entwendet hatte, hat mich nie los gelassen. Das war aber egal, denn die Zigarrenkiste war ja mit all den anderen Spielsachen auch verbrannt, oder?
Nun aber zurück zu unserem Abteil mit der großen, dicken, rauchenden Frau und dem kleinen Mann. Zwischen diesen Leuten und meinen Eltern kam es zu einem Gespräch über den „verdammten Krieg“, der ja wohl hoffentlich bald beendet sein würde. Trotz der Aufregung, die für mich damals mit jeder Reise verbunden war, wurde ich vom Schlaf übermannt. Irgendwo mussten wir den Zug wechseln und ich schlief sofort wieder ein. Ich wachte erst wieder auf, als der Zug in den Bahnhof von Bad Kissingen einfuhr. Das war vielleicht ein kleiner Bahnhof! Der war viel kleiner, als der Düsseldorfer Hauptbahnhof, ja, er war noch kleiner als der Bahnhof in unserem Stadtteil Bilk.
Wie wir ins HAUS GLEISSNER gekommen sind, weiß ich nicht mehr. Sehr genau erinnere ich mich aber an das Streitgespräch in unserem Zimmer, kurz, nachdem wir dieses zugewiesen bekamen. Der Verursacher des Streites war ein Exkrement. Es ging um einen Köttel, über dessen Herkunft erst leise, dann laut gestritten wurde. Schwester Jutta von der NSV behauptete mit unerschütterlicher Sturheit, dass der Köttel, der unterhalb unseres Fensters gefunden wurde, von uns stammen müsste. Nun befand sich unser Zimmer auf der zweiten Etage und angesichts der Fallhöhe wäre der Köttel, sofern er von uns stammen sollte, ziemlich verformt worden. Auf keinen Fall hätte er diese makellose Würstchenform beibehalten. So jedenfalls argumentierte mein Vater. Schwester Jutta ließ sich aber nicht überzeugen und wohl im Hinblick auf die Abmessungen des Köttels hatte sie mich im Verdacht. Allerdings sah sie auch in meinen Bruder Günter einen möglichen Täter. Mein Vater gab dann noch zu bedenken, dass das hellbraune Würstchen möglicherweise gar nicht von einem Menschen stammte, sondern tierischen Ursprungs sein könnte. Da käme doch sicherlich auch ein Hund in Betracht. Eine solche Möglichkeit kam für Schwester Jutta überhaupt nicht in Frage. Nein, nur einer von uns könnte das gewesen sein, das wüsste sie ganz genau. Nun hatte meine Mutter eine Art, die man als undiplomatisch bezeichnen könnte und etwas spitz fragte sie Schwester Jutta, ob das Ding da nicht von ihr selbst sein könnte. Mein Vater, der feinfühliger war, wollte wohl besänftigen, als er sagte: „Nein Martha, dafür ist das Würstchen zu klein!“ Schwester Jutta eilte mit plötzlicher Hast davon.
Leider war Schwester Jutta im Hause GLEISSNER die für alle Belange zuständige NSV-Vertreterin und das ließ sie uns in der Folgezeit spüren. Tja, Schwester Jutta hatte etwas sehr unsympathisches an sich, was aber nicht an den matt geschliffenen Brillengläsern lag, die sie trug. Ihre Augen waren es, die sie so unsympathisch erscheinen ließen. Selbst wir Kinder fanden den Blick dieser kalten Augen als sehr unangenehm.
Meine Mutter war aber nicht dumm und verstand es, sich aus der Abhängigkeit von Schwester Jutta zu lösen. Sie ging zur Hauptgeschäftsstelle der Bad Kissinger NSDAP. Beim ersten Besuch machte sie wohl einen Fehler, denn sie begrüßte den braun uniformierten Herrn in der Anmeldung mit einem „Guten Morgen!“. „Kennen Sie nicht den deutschen Gruß?“ wurde sie mahnend gefragt. „Ach ja, Heil Hitler!“ sagte meine Mutter und milde lächelnd meinte der Herr: „Na also, warum nicht gleich so!“ Was meine Mutter denn für ein Anliegen hätte? Ihr Großer, das war also ich, brauchte ein Paar neue Schuhe und dafür musste sie einen Bezugsschein haben. Das wäre aber nur das vordringlichste, denn wir wären ja total ausgebombt und hätten alle nur das, was wir auf dem Leibe trügen. Die ganze Familie müsste komplett neu eingekleidet werden. Ja, Bezugsscheine! Ohne die ging gar nichts. Ob Hemd, Hose oder Jacke, für alles brauchte man einen Bezugsschein. Dafür war aber nicht die NSDAP zuständig, sondern die NSV, die im selben Gebäude war. Da ging aber alles sehr unbürokratisch über die Bühne, nur ein paar Formulare mussten ausgefüllt werden und meine Mutter bekam alles, was sie brauchte.
Wenn wir nach dem Kriege über unsere Erlebnisse sprachen, meinte meine Mutter, dass die Beamten von der NSV sich deshalb immer großzügig verhielten, weil wir Ausgebombte waren. Auch ihre deutlich erkennbare Schwangerschaft tat ihr übriges. Wir taten den Herren leid. Von dem Streit mit Schwester Jutta wussten sie ja nichts.
Für fast alle Lebensmittel brauchten brauchte man Lebensmittelmarken. Die standen uns aber nicht zu, weil wir im Hause GLEISSNER mit allem versorgt wurden. Dennoch bekam meine Mutter einige Marken für Zucker, Mehl und Marmelade, damit sie uns hin und wieder ein paar Süßigkeiten oder Gebäck kaufe konnte.
Und wie war Bad Kissingen? Wäre ich ein paar Jahre älter gewesen, hätte ich das halbe Jahr in dieser wunderschönen kleinen Stadt sicherlich etwas bewusster erlebt. Zunächst beeindruckten mich die vielen Pferdekutschen, die wohl die einzigen innerstädtischen Verkehrsmittel waren. Autos, die zu dieser Zeit auch in Düsseldorf selten zu sehen waren, schien es in Bad Kissingen nicht zu geben. Dann die vielen Frauen mit den dicken Bäuchen! Mein Bruder Günter, obwohl fast zwei Jahre jünger als ich, wusste in vielen Dingen besser Bescheid. So konnte er mir sagen, dass diese Frauen bald ein Kind bekommen würden. Auch meine Frage, wie das denn vor sich gehen sollte, wusste er zu beantworten. Die Frauen hätten da zwischen den Beinen so ein Ding, und da kämen die Kinder heraus. Ich eilte sofort zu meiner Mutter, um sie zu fragen, ob Günter mir die Wahrheit gesagt hatte. Günter, wohl neugierig darauf, wie unsere Mutter reagieren würde, kam grinsend hinter mir her. Das hätte er aber nicht tun sollen! Möglicherweise war es sein wissendes Grinsen, das meine Mutter veranlasste, ihm eine Ohrfeige zu geben. Damals galten Kinder, die über solche Dinge Bescheid wussten, als verdorben. Aber nicht nur die vielen schwangeren Frauen fielen auf. Mehr noch waren es die verwundeten Soldaten, die durch ihr Erscheinungsbild auffielen. Damit meine ich Soldaten, die ein und manchmal beide Beine verloren hatten, anderen fehlte ein Arm und wiederum andere hatten den Kopf bis unterhalb der Augen verbunden. Die wurden von Rot-Kreuz-Schwestern geführt. Bad Kissingen war damals ein riesiger Kreißsaal, in dem die vielen schwangeren Frauen aus den Städten, denen die Bombardierung drohte, oder die bereits ausgebombt waren, ihre Kinder zur Welt bringen konnten. Zugleich war es ein riesiges Lazarett für die vielen, im Krieg verwundeten Soldaten.
Mein Vater, der uns ja auf der Fahrt nach Bad Kissingen begleitete, blieb noch eine Woche bei uns. Er ging oft mit uns durch den Kurpark, der nach seiner Ansicht zu den schönsten der Welt gehörte. In der riesigen Trinkhalle konnten wir so viel Heilwasser trinken, wie wir wollten. Weder mein Bruder Günter, noch ich machten von dieser Möglichkeit allerdings ausgiebigen Gebrauch. Von den verschiedenen Wassersorten probierten wir nur jeweils einen Schluck und hatten dann genug davon. Besonders das Wasser aus dem Rakoczy-Brunnen war für uns nicht gerade eine Offenbarung des Wohlgeschmacks. Günter und ich stimmten darin überein, dass es nach Erbrochenem schmeckte. Auch meine Mutter fand es ekelhaft. Nicht so mein Vater, der fand alle Wässer sehr schmackhaft, weil sie so gesund waren. „Bedenkt doch einmal“, sagte er, „wie viel Geld all die Leute ausgeben, um diese wertvollen Heilwässer trinken zu können!“ Besonders beliebt und viel besucht war aber der Marx-Brunnen außerhalb des Kurparks. Dessen Wasser schmeckte auch uns Kindern sehr gut. Nach meiner Erinnerung hatte dieses Wasser einen pikant säuerlichen Geschmack. Es gab Leute, die sich große Gefäße abfüllten und mit nach Hause nahmen.
Zum Ludwigsturm gingen wir auch zwei oder dreimal und stiegen die enge Wendeltreppe nach oben, von wo wir eine herrliche Aussicht hatten. Im Stadtkern, es war wohl die Altstadt, gab es ein Spielwarengeschäft, welches mein ganz besonderes Interesse fand. Mein Favorit unter den ausgestellten Spielsachen war die Kinderpost. Der Postschalter trug die Aufschrift DEUTSCHE REICHSPOST. Das schönste daran waren die vielen Stempel und ein echtes Stempelkissen. Mein Vater, der ja wieder zurück nach Düsseldorf zu seiner kriegswichtigen Arbeit musste, schenkte mir zum Abschied so eine Kinderpost und dem Günter ein „Mensch ärgere Dich nicht“- Spiel. Günter musste mit anderen Kindern spielen, da ich mit meiner DEUTSCHEN REICHSPOST voll ausgelastet war. Am liebsten füllte ich Formulare aus, die in der Kinderpost reichlich enthalten waren. Ich hatte mir auch eine streng amtliche Unterschrift zugelegt.
Ein oder zwei Tage vor der Abreise meines Vaters gingen wir alle in die Altstadt, um „lecker“ zu essen. Unser Ziel war das „Bratwurstglöckle“, ein Restaurant, welches auch uns Kindern gut gefiel, weil es da so gemütlich war. Nach dem Essen machten wir noch einen kleinen Bummel durch die verwinkelten Gassen. In einem großen Gebäude, vielleicht war es das Rathaus, war etwas los. Ja, da war Musik und drinnen im Saale wurde getanzt. Der Grund? Es wurden wieder junge Männer verabschiedet, die zum Militär mussten. Einige Leute hatten sich wohl sehr lieb, denn sie küssten sich besonders inniglich. Das fiel sogar mir, dem Achtjährigen auf, dass diese Küsse mehr waren, als normale Abschiedsbusserl.
Dann machte meine Mutter eine Entdeckung. Sie stieß meinen Vater an und sagte Halblaut: „Nun guck Dir doch mal die Schwester Jutta an, nein, ist das ein Geknutsche“ „Ja“, sagte mein Vater dazu, „aller Abschied ist schwer!“ Schwester Jutta hatte wahrscheinlich bemerkt, dass sie bei dem „Geknutsche“ von meinen Eltern beobachtet wurde. Sie war in der Folgezeit besonders freundlich zu uns. Dann hatte sie sich eines Tages im Speisesaal von HAUS GLEISSNER von allen verabschiedet. Sie wurde in ein Wehrmachts-Lazarett versetzt, um sich den im Krieg verwundeten Soldaten widmen zu können. Sie war anscheinend doch nicht so unbeliebt, denn etliche Frauen konnten ihre Tränen nicht zurück halten.
Und was war mit der Schule? Ja natürlich, ich musste wieder zur Schule gehen. Ich war zwar im dritten Schuljahr, aber an einen geregelten Schulbesuch davor kann ich mich nicht erinnern. Sicher, ich bin da mal vor langer, langer Zeit in Düsseldorf eingeschult worden und es gab auch eine große Schultüte. Aber dann? Lauter Schulunterbrechungen, lauter Schulwechsel! Hatte ich bis dahin eigentlich etwas gelernt? Ich weiß es nicht.
Nun kam ich also in Bad Kissingen wieder einmal erneut in die Schule. Die stand irgendwo am Stadtrand. Der Weg dahin führte durch die Altstadt, vorbei an dem Spielwarengeschäft. Das Schulgebäude war ein moderner, heller Bau. Dahinter waren Felder und Wiesen. Der Klassenraum befand sich im ersten Stockwerk. Oder war es der dritte Stock? Das weiß ich nicht mehr so genau. An den Lehrer aber erinnere ich mich sehr gut, obwohl ich seinen Namen nicht mehr weiß. Im Vergleich zu den anderen Lehrern war er kleinwüchsig. Mit den langen, nach hinten gekämmten schwarzen Haaren, der fliehenden Stirn und den schwarzen Augen wirkte sein Gesicht auf mich sehr unsympathisch. Nie zuvor und nie danach hatte ich einen Lehrer, der im Unterricht einen braunen Kittel trug. Was lernten wir Schüler bei diesem Lehrer? Sehr viel über den Führer. Der Führer war im ersten Weltkrieg ein Meldeläufer. Das war etwas ganz wichtiges. Der Führer hatte später die Franzosen aus unserer Heimat vertrieben. Der Führer hatte dafür gesorgt, dass die Juden uns nichts mehr tun konnten. Die Juden wollten uns Deutschen nämlich das Blut aussaugen, was der Führer aber Gott sei Dank verhindert hatte.
Was lernten wir sonst? Wir Deutschen hatten das beste Wappentier, das war nämlich der Adler! Die Franzosen hatten den Hahn als Wappentier, was ja wohl zum Lachen war. Dann erst mal die Engländer. Die hatten zwar einen Löwen, aber wie sah der denn aus? Am lächerlichsten aber war der plumpe Bär, den die Russen hatten. Als Deutsche waren wir natürlich besser als alle anderen, weil unser Blut am besten war. Sicher, die Franzosen und die Engländer waren zwar auch nicht schlecht, aber wir, die Deutschen, waren viel besser. Die Russen hingegen waren fast wie Tiere, was man an deren Gesichtern auf dem Bild, welches der Lehrer uns zeigte, ganz genau erkennen konnte. Besonders abscheulich sahen die Juden aus, die der Lehrer uns auf einem anderen Bild zeigte. Er meinte sogar, die Juden wären Ungeziefer.
Was der Lehrer da über die Russen und Juden erzählte, erschien mir unglaubwürdig, da ich ja schon echte Russen und echte Juden gesehen hatte, und die waren ganz anders. Die einen sahen nicht wie Tiere aus, die anderen nicht wie Ungeziefer. Ob ich dem Lehrer meine Skepsis zeigte? Er meinte einmal, ich röche nach schlecht gewordener Milch.
Es gab auch Bilder, da waren nur schöne Menschen zu sehen. Das waren alles deutsche Soldaten. Wir sollten auch solche Soldaten werden. Darum mussten wir ganz früh kämpfen lernen. Dazu war der Sportunterricht am besten geeignet. Zu diesem Zweck mussten wir uns in zwei Reihen gegenüber aufstellen. Sobald der Lehrer auf seiner Trillerpfeife pfiff, sollten wir aufeinander los stürmen und jeder musste versuchen, sein Gegenüber, der ja sein Gegner war, nieder zu ringen und sich dann auf den am Boden Liegenden zu werfen.
Spezielle Wettläufe gab es auch. Dabei mussten jeweils zwei Schüler um die Wette laufen. Wer zuerst das Ziel erreichte, bekam zwar einen Punkt, gewonnen hatte er aber noch nicht. Er musste nämlich den, der nach ihm das Ziel erreichen wollte, daran hindern. Das lief dann jedes Mal auf einen Ringkampf hinaus. Wenn es beim Boxen zu blutigen Nasen kam, meinte der Lehrer, dass das nicht schlimm wäre. Wir sollten kämpfen lernen, damit der Führer stolz auf uns sein konnte. Der Lehrer selbst sah aber ganz anders aus, als die schönen deutschen Soldaten. Nachdem er uns immer wieder erklärt hatte, wie ein richtiger Deutscher aussehen musste, kam er mir doch sehr undeutsch vor. Er kam übrigens aus Krefeld. Ob wohl alle Krefelder so waren?
Was lernten wir sonst noch? Ich kann mich nicht entsinnen, bei diesem Lehrer Deutsch, Rechnen oder etwas anderes gelernt zu haben. Doch, er zeigte uns eine große Landkarte. Darauf konnte man sehen, welche Länder unsere Soldaten schon für unser deutsches Vaterland erobert hatten. Ich konnte zwar den Ausführungen des Lehrers nicht ganz folgen, weil ich mit Landkarten nichts anfangen konnte, aber ich war trotzdem sehr stolz auf unsere Soldaten.
Der Lehrer machte übrigens keinen Hehl daraus, dass ihn meine beim Kampfsport gezeigten Leistungen nicht zufrieden stellten. Er fand mich wohl auch sehr unsympathisch und dass sich seine Aversion gegen mich noch steigerte, daran hat möglicherweise meine Mutter eine gewisse Schuld. Sie hatte nämlich mittlerweile einen guten Draht zu den Herren von der NSDAP, und denen erzählte sie das von der Bemerkung des Lehrers, wonach ich nach schlecht gewordener Milch riechen sollte. Die Herren fanden das übereinstimmend unerhört und einer von ihnen wollte den Lehrer zur Rede stellen.
Hatte der Mann von der NSDAP meinen Lehrer zur Rede gestellt? Wenn ja, so ließ der sich zunächst nichts anmerken. Die gesteigerte Aversion gegen mich zeigte er aber nach dieser Flugschau. Die HJ, das war die Hitlerjugend, veranstaltete auf den Saalewiesen eine Sportschau und der krönende Höhepunkt sollte die Flugschau mit einem Segelflugzeug sein. Weiträumig waren Fahnenmasten aufgestellt und es war schön zu sehen, wie die Hakenkreuzfahnen im Winde flatterten. Ja, mir gefielen die Hakenkreuzfahnen. Die ganze Schule hatte frei und die Schüler von der dritten Klasse an aufwärts sollten aktiv mitmachen. Bei der Flugschau sollte das aktive Mitmachen ein Schleppdienst sein, denn das Segelflugzeug hatte keinen Propeller und konnte deshalb nicht selbstständig starten. Da es leider keine Zugmaschine gab, sollten wir Schüler den Segelflieger anschleppen. Dazu war vorne an dem Segelflieger ein etwa 60 Meter langes Seil befestigt und daran sollte eine Gruppe von Schülern, die von ihren Lehrern ausgewählt wurden, ziehen und den Segelflieger in Bewegung setzen, damit er abheben konnte.
Angeführt wurde die Schleppmannschaft von zwei älteren Hitlerjungen, die voran liefen und anfeuernd „schneller, schneller, schneller“ riefen. Zunächst kamen die Schlepper nicht auf die erforderliche Geschwindigkeit, weshalb deren Anzahl erhöht wurde. Die dann erreichte Geschwindigkeit genügte, um den Segler abheben zu lassen. Nach dem Abheben klinkte der Pilot das Schleppseil aus, sodass es nach unten fiel. Weit kam der Segler aber nicht, nach etwa 250 Metern musste er landen. Jetzt waren die Schüler wieder gefordert. Sie mussten zu dem gelandeten Segelflieger laufen und einer von den großen Hitlerjungen machte das Schleppseil erneut an der Spitze des Seglers fest. Der Pilot verlangte von den beiden Hitlerjungen, dass die Schlepper noch schneller laufen sollten. An dem Gespräch beteiligten sich auch einige Lehrer, darunter auch der meinige. Die Zahl der Schlepper wurde nochmals erhöht und diesmal sollte ich dabei sein.
Was mich betrifft, so hatte ich mir schon als Kind angewöhnt, mich an körperlich anstrengenden Aktivitäten nicht zu beteiligen und stattdessen lieber die Rolle eines Beobachters einzunehmen. Instinktiv suchte ich mir dafür Standorte aus, die etwas versteckter lagen. Hier, bei dieser Flugschau war es eine Gruppe von erwachsenen Zuschauern, hinter denen ich mich aufstellte, um im Verborgenen beobachten zu können. Wahrscheinlich war denen die Sache aber zu langweilig, denn sie entfernten sich bald und ich stand ohne Deckung da. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich von meinem Lehrer entdeckt wurde. Sein Blick war stechend. Trotz seiner Kleinwüchsigkeit kam er mir nun doch ziemlich groß vor, und seinem bellenden „Komm mal her!“ kam ich unverzüglich nach. Die erwartete Ohrfeige bekam ich nicht. Stattdessen zeigte er mit erhobener Hand in Richtung der Schüler, die bereits das Schleppseil in ihren Händen hielten und mit nervöser Spannung auf das Kommando warteten. Freudlos lief ich zu den Schleppern, um als letzter das Seil in die Hand zu nehmen. Einer der Hitlerjungen rief „Achtung, fertig los!“ und wir setzten uns in Bewegung.
War ich ein Trottel? War ich dumm wie Bohnenstroh? Keinen Schuss Pulver wert? Nach Meinung meines Lehrers traf das alles auf mich zu und aus seiner Sicht hatte er auch möglicherweise recht damit, denn ich hatte ihn durch mein Verhalten zu diesen Werturteilen provoziert! Als sich nämlich die Schlepper, zu denen ich ja jetzt auch gehörte, in Bewegung setzten, bewegte ich meine Beine so ungeschickt, dass ich stolperte und meinen Vordermann mit zu Boden riss. Auch dieser Startversuch missglückte also und zwar durch meine Schuld! Ich brauchte nicht mehr mitzumachen. Der Lehrer schickte mich nach Hause. Ich ging zwar, aber nicht nach Hause, sondern ich suchte mir in einer größeren Entfernung einen schattigen Platz unter einem Baum aus und sah mir das Schauspiel noch eine Weile an. Ja, irgendwann klappte es und der Segelflieger stieg auf, und drehte ein paar Runden. Nach der Landung wurde der Pilot von einem dickleibigen Herrn von der NSDAP, der natürlich seine braune Uniform trug, beglückwünscht. Ich war zu weit weg, um zu verstehen, was er sagte.
Hatte ich denn in Bad Kissingen wirklich nur diesen Nazi-Lehrer? Hatte ich nicht noch andere Lehrer? Bis zu den Ferien hatte ich nur diesen. Er bekam bald einen Grund, um seine ganze Gehässigkeit über mich ausbreiten zu können. Meine Mutter und wir Kinder mussten mit anderen Evakuierten ins HAUS HOHENZOLLERN umziehen, weil das HAUS GLEISSNER für verwundete Soldaten benötigt wurde. Vor dem HAUS HOHENZOLLERN stand eine Litfaßsäule. Einige Plakate hatten sich losgelöst und hingen lose herab. Zusammen mit anderen Kindern entfernte ich die als wertlose Papierfetzen angesehenen Plakate. Was wir nicht wissen konnten, war, dass es Propagandaplakate waren. Ein besonders guter Nazi hatte deshalb Anzeige erstattet. Die Polizei hatte zwar erkannt, dass unser Vergehen nicht politisch motiviert war, dennoch wurde ich von meinem Lehrer, der wieder seinen braunen Kittel trug, zur Rede gestellt. Mein gezeigtes Schuldbewusstsein reichte ihm wohl nicht, denn er brüllte plötzlich los und fragte mich, ob ich denn nicht wüsste, dass meine Mutter dafür den Kopf abkriegen könnte. Ja, dieser Lehrer war wirklich ein vorbildlicher Nationalsozialist. Was hätte der nur für eine Karriere im Falle eines Sieges der großdeutschen Wehrmacht machen können. Nun wäre aber das, was ich da mit anderen Kindern angestellt hatte, tatsächlich ein schlimmes Verbrechen gewesen, hätte ich es als Erwachsener getan. Später erfuhr ich, dass Menschen tatsächlich zum Tode verurteilt wurden, weil sie derartige Plakate entfernt hatten. Propaganda war für den Reichs-Propaganda-Minister Dr. Josef Göbbels etwas sehr wichtiges und wehe dem Bedauernswerten, der es wagte, Propagandamaterial mutwillig zu beschädigen.
Der Lehrer, wüsste ich doch nur seinen Namen, ließ in der Folgezeit keine Gelegenheit vergehen, ohne mich zu schikanieren. Bei den Kampfsportveranstaltungen suchte er für mich immer die stärksten Gegner aus und machte sich über mich lustig, wenn ich erwartungsgemäß verlor. Damals hatte ich die böse Absicht des Lehrers nicht durchschaut. Erst später, schon als Erwachsenem, kam mir die Erkenntnis, was für ein mieser Mensch dieser Nazi-Pädagoge doch war. Dieser miese Mensch schaffte es aber, mir die Schule so zu verleiden, dass ich nicht mehr hin ging. Von irgendeinem Zeitpunkt an blieb ich der Schule fern. Ich verließ zwar morgens das HAUS HOHENZOLLERN, aber dann folgte ich nicht mehr dem Schulweg, sondern ich ging auf dem Promenadenweg des Kurparks spazieren, der zu so früher Stunde noch fast menschenleer war.
Fast menschenleer, habe ich gesagt und damit meine ich, dass es doch einige wenige Menschen gab, die sich auf dem Promenadenweg bewegten. Dazu gehörte ein gewisser Peter Perdelius. Er war etwas größer als ich und auch ein Jahr älter. Genau wie ich, hätte er längst in der Schule sein müssen. Peter kam direkt zur Sache und fragte ohne Umschweife, ob ich auch keine Lust hätte, zur Schule zu gehen. Nachdem ich seine Frage bejahte, gingen wir eine Zeit lang wortlos nebeneinander her. Kurz vor 9 Uhr kamen die Besitzer der Geschäfte und Kioske, um sich auf den Geschäftsbetrieb vorzubereiten. Da waren die Tabakwaren- und Ansichtskartenkioske, deren Rolläden hoch gezogen wurden. Die Buchhändler legten die Schaustücke aus. Die Geschäfte der Andenken- und Geschenkartikelhändler öffneten die Türen. Es dauerte nicht mehr lange und auf dem Promenadenweg flanierten die Spaziergänger. Das war alles so schön und an die Schule dachte ich genau so wenig wie Peter.
Peter kam aus Köln und seine Mutter war im achten Monat. Die Frage, im wievielten Monat meine Mutter war, konnte ich ihm nicht beantworten. Das machte ihm aber nichts aus. Das Wort „Köln“ sprach er komisch aus. Er sagte „Köllen“ dazu und machte mir klar, dass „Köllen“ besser als Düsseldorf war. Als Grund nannte er mir den „Köllener Duum“. Ich hielt ihm entgegen, dass Köln auf keinen Fall besser als Düsseldorf sein konnte, da wir in Düsseldorf doch den Rhein hatten. Sein Grinsen verriet mir, dass ich ihn mit dem Rhein nicht übertrumpfen konnte. „Köllen“ läge nämlich auch am Rhein und der wäre da viel schöner. Wir haben uns trotzdem prima vertragen und trafen uns nun jeden Morgen an dieser Stelle, das heißt, direkt hinter dem Marx-Brunnen.
Die Ansichtskartenkioske übten auf Peter eine große Anziehungskraft aus und sobald wir uns einem solchen näherten, wurde Peter von einer seltsamen Unruhe erfasst. Zielstrebig zog er mich zu einem der drehbaren Ständer mit den vielen Ansichtskarten und schnell bemerkte ich, dass Peter sich sehr stark für ganz bestimmte Karten interessierte. Das waren Fotos der Führungselite des Großdeutschen Reiches. Darunter waren auch großformatige Ansichtskarten, die aber dem Führer Adolf Hitler und seinem Stellvertreter, dem Reichsmarschall Hermann Göring, vorbehalten waren.
Bald konnte auch ich mich der Faszination, die von diesen Bildern ausging, nicht entziehen. Obwohl der Führer mir sehr imponierte, besonders auf dem einen Bild, wo er mit der zum deutschen Gruß erhobenen Hand da stand, mit dem Reichsadler im Hintergrund, gefiel mir der Reichsmarschall mit seinem Marschallstab bedeutend besser. Das kam auch daher, weil der Reichsmarschall immer so freundlich lachte. Das hatte auch später, nach dem Kriege mein Vater so gesehen, denn er meinte, dass Göring so übel nicht gewesen wäre. Na ja, da hat er sich wohl auch durch das joviale Gehabe dieses Mannes, der einer der ganz großen Kriegsverbrecher war, täuschen lassen.
Nun zurück zu dem Ansichtskartenkiosk: Im Gegensatz zu mir war Peters Favorit der Führer. Von dem konnte er nicht genug sehen, und so kam es, dass wir meistens sehr lange vor den ausgestellten Ansichtskarten stehen blieben. Dass wir dabei voller Hingabe die Gesichter von Massenmördern bewunderten, war uns natürlich nicht bewusst. Bald interessierte ich mich auch für die anderen Größen des deutschen Reiches, und besonders die heldenhaften Soldaten hatten es mir angetan. An die meisten Namen dieser Helden kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber einige Namen weiß ich noch. Zum Beispiel galt mein besonderes Interesse dem Feldmarschall Rommel, dann auch dem Admiral Dönitz sowie dem Feldmarschall Keitel. Dass Keitel nach dem Kriege gehängt werden würde und Dönitz ins Zuchthaus kommen würde, das hätte zur damaligen Zeit sicherlich auch kein Erwachsener für möglich gehalten.
Da wir beide nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügten, auch nur eine dieser herrlichen Karten zu erwerben, immerhin kosteten sie 20 Reichspfennige das Stück, blieb uns nur das Gucken. Nur Ansichtskarten gucken ging natürlich nicht, und so stromerten wir nicht nur durch Bad Kissingen und erforschten diese Stadt bis zum letzten Winkel, sondern wir durchwanderten auch die Saaleauen hinter dem Kurpark. Die Saale, gemeint ist übrigens die fränkische Saale, ist ein so schöner Fluss, dass er sogar uns Kindern gut gefiel, obwohl Kinder sich durch Naturschönheiten seltener beeindrucken lassen. Wir saßen auf einer Bank, und nachdem wir unsere Pausenbrote verzehrt hatten, warfen wir kleine Steine in den Fluss. Leider waren es keine flachen, sondern kugelige, eiförmige und anders geformte Steine, die man nicht zum Hüpfen bringen konnte. Sie gingen sofort unter und erzeugten Ringe auf dem Wasser, die größer und größer wurden und dabei neue, konzentrische Ringe nach sich zogen. Wir konnten uns das Entstehen der Ringe nicht erklären.
Peter hatte sich wohl vorgenommen, mich zu überraschen und mit dem, was er jetzt tat, gelang ihm sein Vorhaben total. Er öffnete seinen Tornister, in Bad Kissingen sagte man Schulranzen bzw. Ränzle dazu, und zeigte mir etwas, was mich den Mund mit einem Ausruf des Erstaunens aufreißen ließ. In dem Tornister befanden sich zwei Hefte, ein Lesebuch und die große Überraschung: Mindestens 2/3 des Tornisters waren mit Ansichtskarten ausgefüllt. Da waren sie alle: Der Führer, Hermann Göring, der Minister Dr. Josef Göbbels, Rommel, Dönitz, Keitel und all die anderen Helden. Vom Führer war sogar eine großformatige Karte dabei. Da waren aber auch Ansichtskarten, die keine Menschen, sondern die schönsten Waffen zeigten: Kampfflieger, Panzer, Schlachtschiffe, U-Boote, Kanonen, Maschinengewehre und anderes. Besonders beeindruckt war ich von einer Ansichtskarte, die einen lachenden Soldaten zeigte, der solch ein Maschinengewehr bediente.
Zufrieden grinsend nahm Peter meine Überraschung zur Kenntnis. „Hab´ ich alle von meiner Oma!“ sagte er und ich glaubte ihm. Ich durfte keine einzige Karte anfassen, aber ansehen durfte ich alle. Im Rückblick muss ich anerkennend sagen, dass damals schon die Farbfotografie weit entwickelt war. Wie bereits gesagt, glaubte ich dem Peter, als er mir sagte, dass die Karten von seiner Oma waren. Deshalb war einige Tage später meine Verblüffung sehr groß, als ich etwas Befremdliches zur Kenntnis nehmen musste. Es geschah vor einem Kiosk, der Tabakwaren und Ansichtskarten verkaufte.
Beide bewunderten wir die Ansichtskarten, als Peter mich bat, den Kaufmann zu fragen, ob er Lakritze hätte. „Ich hab´ kein Geld!“ gab ich zu bedenken. Peter meinte, ich sollte trotzdem gehen. Ich ging hinein, aber der Kaufmann bediente gerade einen Herrn, sodass ich nicht zum Fragen kam. „Komm, wir gehen!“ rief Peter und ich ging zu ihm. Die hastige Bewegung, mit der Peter etwas in seinem Hemd verschwinden ließ, entging mir nicht und auch, was er da versteckte, blieb mir nicht verborgen: Es war eine Ansichtskarte mit einem besonders schönen Abbild des Führers.
Mein erstauntes Gucken beantwortete Peter mit einem Grinsen, das ich heute als verschlagen bezeichnen würde. Dass Peter ein Dieb war, stand ja wohl ohne Zweifel fest. Hätte ich deswegen den Umgang mit ihm abbrechen sollen? Vielleicht ja, aber der Peter war mir sehr sympathisch und so blieb unsere Freundschaft erhalten. Das Schlimme war nur, dass Peter weiter klaute. Dass ich dabei indirekt mitmachte, indem ich die Verkäufer durch dumme Fragen ablenkte, will ich nicht verschweigen. Peter hatte übrigens sehr bald mit einem Grinsen zugegeben, dass seine Oma mit seinem großen Bestand an Ansichtskarten nichts zu tun hatte. Egoistisch, sogar äußerst egoistisch, fand ich Peters Geiz. Er kam nie auf die Idee, mir doch gefälligst hin und wieder eine Ansichtskarte abzugeben. Bei einem unserer nächsten Beutezüge fand ich dann die Karte, die ich um alles in der Welt haben wollte. Es war eine Karte mit der wunderbaren Abbildung von Feldmarschall Rommel. Auf dem Foto waren mehrere deutsche Panzer hinter dem Feldmarschall zu sehen und dahinter war der gelbbraune Wüstensand. Ich zeigte dem Peter diese Karte und ließ ihn nicht im Unklaren darüber, dass es meine Karte wäre und zwar auch dann, wenn er sie klauen würde. Peter brachte die Karte in seinen Besitz und wir entfernten uns von dem Geschäft. Er war wirklich mit allen Wassern gewaschen und kannte etliche Tricks, um unser plötzliches Verschwinden nicht auffällig erscheinen zu lassen. In dem aktuellen Fall hatte er sich einen besonderen Vorwand ausgedacht, bei dem aber meine Mitwirkung erforderlich war. Ich sollte laut, mit freudiger Stimme rufen: „Ach, sieh´ doch mal das Rotkehlchen da drüben! Oh, ist das schön!“ Ich hatte meine Rolle wohl sehr gut gespielt, denn der Diebstahl ist nicht aufgefallen. Immer noch redete ich mir ein, dass ich kein Dieb war, denn Peter hatte die Karte ja gestohlen.
Ich versuchte Peter klar zu machen, dass er mir die Karte geben müsste und ich ihm das ja auch gesagt hätte. Meine Argumente waren wohl nicht stark genug, um ihn zu überzeugen, denn er lachte nur. Na ja, wir gingen irgendwann zurück und kurz bevor wir den Kiosk erreichten, von dem Peter „meine“ Karte entwendet hatte, eilte ich vor, um dem Kaufmann, einem älteren Herrn, von dem Diebstahl zu berichten. Peter war kaltblütig genug, um nicht davon zu laufen. Er blieb einfach stehen, sodass er von dem Kaufmann befragt werden konnte. Es kam zu einem Gespräch, das ich hiermit „originalgetreu“ wiedergebe:
Der Kaufmann: „Hast du eine Postkarte gestohlen?“
Peter: „Nee, dat is nit wahr!“
Der Kaufmann, mir zugewandt: „Hat er die Karte?“
Ich: „Ja sicher, er hat sie im Hemd versteckt!“
Der Kaufmann, Peter zugewandt: „Du hast sie also doch, ich hole die Polizei!“
Peter: „Oh, habe ich vergessen, zu bezahlen!“
Der Kaufmann: „Gut, das macht dann 20 Pfennige!“
Peter, greift in seine Tasche: „Oh, habe ich meine Groschen verloren!“
Der Kaufmann: „Gut, dann gib die Karte zurück!“
Peter, holt die Karte aus seinem Hemd, reicht sie dem Kaufmann und sagt „Hier!“
Der Kaufmann nimmt die Karte und sagt: „Lasst Euch hier nicht mehr sehen, Ihr Diebespack!“
Erschrocken hörte ich von dem Kaufmann das Wort „Diebespack!“. War ich denn auch ein Dieb? Ich hatte doch keine Karte gestohlen, das hatte doch der Peter gemacht, oder?! Man könnte nun sagen, dass ich mich mit der Wiedergabe dieses Gesprächs, das so oder so ähnlich, tatsächlich stattgefunden hatte, als Denunziant, als Verräter oder eben als Neidhammel zu erkennen gegeben habe. Ob Peter mich damals auch so einstufte, weiß ich nicht. Er nahm mir mein Verhalten aber nicht übel und wir blieben gute Freunde. Den Promenadenweg mussten wir aber in der nächsten Zeit meiden. Einige Geschäftsleute jagten uns mit bösen Worten davon. Es hatte sich wohl herum gesprochen, dass wir so harmlos aussehenden Buben doch üble Spitzbuben waren.
Dann hielt Peter sich eines Tages nicht mehr an die Verabredung und erschien morgens nicht mehr an der vereinbarten Stelle hinter der Saalebrücke. Da musste ich mich halt alleine herumtreiben. Am nächsten Tag trafen wir uns aber doch noch, was aber mehr dem Zufall geschuldet war. Peter war aufgeregt. Seine Mutter war im Krankenhaus. „Ich hab´ ein Brüderchen gekriegt!“ rief er, „gestern Nacht ist es losgegangen!“ Er meinte dann noch, dass seine Mutter wohlauf wäre und dass sein Brüderchen so und so viele Pfund und Gramm wöge und dass es so und so viele Zentimeter groß wäre. Das schönste aber war, dass sein Vater da war. Weil sein Brüderchen kam, hatte er Urlaub von der Front bekommen. Die Front war nämlich ganz weit weg in Russland. Peters Aufregung steigerte sich: „Ich muss jetzt zum Krankenhaus, wo meine Mutter liegt, die darf ich nämlich besuchen. Komm´ doch mit, dann kannst Du auch mein Brüderchen sehen!“ Klar ging ich mit, obwohl ich mich schon damals kaum für neu geborene Kinder interessierte.
Das Krankenhaus war nicht weit entfernt vom HAUS HOHENZOLLERN und als erstes fielen mir die vielen Kinder auf, die sich gegenüber von dem Krankenhaus aufhielten. Einige saßen auf den Bordsteinen. Es stellte sich heraus, dass die Kinder zwar ihre neu geborenen Geschwisterchen sehen wollten, aber keinen Zugang zum Krankenhaus hatten. Sie mussten draußen bleiben und darauf warten, dass ihre Mütter sich am Fenster zeigten. Hin und wieder zeigte sich tatsächlich eine Mutter und dann gab es ein freudiges Zurufen. Ein größeres Mädchen, so etwa 14 Jahre alt, rief nach oben in Richtung des vierten Stockwerks, wo ihre Mutter am Fenster stand. „Mammi, Mammi, wann ist es denn losgegangen?“ Kinder gehen also los, wenn sie zur Welt kommen, dachte ich. Dann öffnete sich im dritten Stockwerk ein Fenster und Peters Eltern zeigten sich. Auffällig war das strahlende Lachen von Peters Vater. Er schien sich sehr zu freuen. Peters Mutter lächelte zwar auch, aber nicht so strahlend. Peter fragte mit lauter Stimme, alle mussten laut schreien, da ja die Straße und die Stockwerkshöhe akustisch zu überwinden waren, wo denn sein Brüderchen wäre. Die Antwort bekam er von einigen älteren Kindern, die ihn darauf aufmerksam machten, dass die Babys zu klein wären, um am Fenster gezeigt zu werden. Dann verschwanden Peters Eltern und es erschien eine andere Mutter, von ihren beiden unten wartenden Kindern mit lauten „Mammi, Mammi“- Rufen freudig begrüßt.
Peter und ich setzten uns auch auf die Bordsteine und wir beteiligten uns an den Gesprächen, die da geführt wurden. Fast alle sprachen über ihr neu geborenes Geschwisterchen. Die Gespräche kamen mir irgendwie sehr fachmännisch vor und das Detailwissen dieser Kinder imponierte mir sehr. Da war viel von Gewichten in Pfund und Gramm die Rede, von Körperlängen in Zentimetern sowie von Augen- und Haarfarben. Ich sah mich außerstande, mich an den Gesprächen qualifiziert zu beteiligen.
Dann kam einer, der wurde politisch! Er war 1-2 Jahre älter als ich und sprach davon, dass der Krieg doch hoffentlich bald zu Ende gehen würde, denn der Krieg dauerte doch mittlerweile fast vier Jahre. „Der Krieg wird doch hoffentlich nicht noch ins fünfte Jahr gehen!“ sagte er. Ich erinnere mich ganz genau daran, wie misstrauisch und vorsichtig ich wurde. Woher kam das Misstrauen? Warum die Vorsicht? Obwohl meine Mutter mich nie ermahnte, bei solchen Fragen zurückhaltend oder gar vorsichtig zu sein, antwortete ich ausweichend und meinte, dass ich dazu nichts sagen könnte. Später erfuhr ich, dass es eine beliebte Methode der Nazis war, die Kinder von Leuten, die der Nazi-Gegnerschaft verdächtig waren, auszuhorchen. Diese Methode wurde übrigens später von den Kommunisten in der DDR übernommen.
Natürlich blieb es nicht aus, dass meine Mutter alles über mein Fernbleiben von der Schule erfuhr. Es war an einem Nachmittag, als meine Mutter mich mit in die Stadt nahm. Auf dem Rückweg sahen wir uns die Bilder in der Kassenhalle des Kinos an. Ich glaube, dass der Film „Münchhausen“ mit Hans Albers auf dem Programm stand. Die Bilder zeigten eine für mich fremde Welt, mit der ich kaum etwas anfangen konnte. Meine Mutter meinte, dass es ein Märchenfilm wäre. Wir wollten gerade die Kassenhalle verlassen, als ein Junge, den ich nicht kannte, von der anderen Straßenseite herüber eilte. Es war ein typischer Schlauberger mit Brille und so. Von mir wollte er nichts. Er guckte mich auch nicht an, als er meine Mutter fragte, warum ich nicht mehr zur Schule käme.
Was kam jetzt? Der Hühnerblick kam! Der Hühnerblick traf erst den Jungen, der es plötzlich mit der Angst bekam, denn er trat einen Schritt zurück und blickte dabei verlegen zu Boden. Dann traf mich der Hühnerblick und das darin liegende ungläubige Erstaunen ließ auch mich verlegen zu Boden blicken. Die Frage kam wie aus weiter Ferne: „Ist das wahr, Dieter?“ Ich erwog schon zu lügen und alles abzustreiten, als ich dem Jungen, der nun nicht mehr zu Boden blickte, in die Augen sah. Der Junge machte solch einen ehrlichen Eindruck, dass mir schnell klar wurde, dass meine Mutter dem mehr glauben würde als mir. Ich nickte also bestätigend mit dem Kopf. Der Junge, wohl weil er seine Aufgabe als erfüllt sah, eilte davon. Meine Mutter war sprachlos und sie blieb es auch während des ganzen Weges bis zum HAUS HOHENZOLLERN. Zum ersten Mal nahm ich bewusst die große Wölbung ihres Bauches zur Kenntnis und dumpf grübelnd überlegte ich, ob ich nicht auch bald mit einem Geschwisterchen rechnen könnte. Die anderen Kinder sprachen nämlich immer von den dicken Bäuchen, die ihre Mütter hatten, bevor die Geschwisterchen kamen. Ich versuchte mir auch vorzustellen, wie meine Mutter ohne den dicken Bauch aussehen würde.
Mein Fernbleiben von der Schule empfand meine Mutter wohl als peinlich, denn auch im HAUS HOHENZOLLERN stellte sie mich nicht zur Rede. Die anderen Mütter und Kinder brauchten ja nicht zu wissen, dass ich ein übler Schulschwänzer war. Abends, als wir allein in unserem Zimmer waren, bekam ich dann doch einiges zu hören. Das, was ich da gemacht hatte, war ja schon schlimm genug, aber meine Lügen waren das Schlimmste. Der Papa, der bald käme, würde mir dann einiges erzählen. Ich horchte auf! Der Papa? Ja, der Papa würde kommen, denn sie müsste für etwa drei Wochen ins Krankenhaus, weil der Klapperstorch ein Geschwisterchen vorbei bringen würde. Meine Mutter sagte wirklich, dass der Klapperstorch das Baby bringen würde und ich fragte mich, weshalb sie dafür ins Krankenhaus musste. An den Klapperstorch glaubte ich zwar nicht, aber wie das mit dem Geschwisterchen richtig ablaufen würde, war für mich doch ziemlich nebulös. Das Geschwätz meines Bruders Günter, wonach die Frauen da so ein Ding haben, wo die Kinder rauskommen, nahm ich natürlich nicht für voll.
Vorrangig in diesem Moment war aber, dass meine Mutter mir eine Entschuldigung für die Schule schreiben musste. Sie fragte mich, ob ich wirklich, wie der Junge gesagt hatte, drei Wochen von der Schule fern geblieben bin. Beschämt nickte ich mit dem Kopf. Am nächsten Tag ging ich mit sehr gemischten Gefühlen zur Schule. War es Zufall? Hinter der nächsten Ecke traf ich Peter wieder. Er war in Gesellschaft von vier oder fünf anderen Jungen. Auch bei ihm ist die Schulschwänzerei aufgedeckt worden, jedoch auf eher bürokratische Art und Weise. Die Schule hatte einen Brief geschickt, der aber von der NSV-Betreuerin in Empfang genommen wurde, da seine Mutter ja noch im Krankenhaus war, um sich von den Strapazen der Geburt zu erholen. „Gut, dass mein Vater den Brief nicht gesehen hat!“ sagte Peter zufrieden grinsend. Von der NSV-Betreuerin musste er sich aber einige böse Worte anhören. Was ihn aber wirklich beunruhigte, war die Drohung, dass alles dem Führer gemeldet würde, wenn er sich nochmals unterstehen sollte, die Schule zu schwänzen. Auf dem Schulhof trennten sich dann unsere Wege. Er ging in die vierte Klasse, ich in die dritte.
„Ach, sieh mal einer an! Da ist ja unser lieber Hans Dieter Schulz vom Tode auferstanden! Da ist die Freude aber groß!“ Ja, es war mein Lehrer, der mich so hohnlachend begrüßte. Er lachte mich vermeintlich freundlich an, aber aus seinen Augen funkelte der blanke Hohn. Dass er es nicht gut mit mir meinte, erkannte ich an der Frage, die er mir stellte: „Hast Du auch eine Entschuldigung für Dein Fehlen in den letzten drei Wochen?“ Unter den kritischen Blicken meiner Mitschüler suchte ich in meinem Tornister nach der Entschuldigung, die meine Mutter mir geschrieben hatte. „Natürlich vergessen!“ höhnte mein Lehrer, und dann fand ich den Brief. Er öffnete ihn, warf einen kurzen Blick auf die Entschuldigung und gab sie mir zurück. „Bei solch einer langen Krankheit verlange ich ein ärztliches Attest, anderenfalls kommt ins Zeugnis, dass Du drei Wochen unentschuldigt gefehlt hast!“
Ich kann mich nicht erinnern, meiner Mutter von der Forderung des Lehrers berichtet zu haben. Auch erinnere ich mich nur sehr ungenau an den weiteren Verlauf meiner schulischen Laufbahn in Bad Kissingen. Dann waren ja auch Sommerferien und die Schule konnte fürs Erste vergessen werden. Ja, es waren Sommerferien, aber richtige Ferien waren es auch wieder nicht, denn wir mussten für unsere Soldaten Kräuter und Beeren sammeln. In der Umgebung von Bad Kissingen gab es an den Wegrändern Unmengen von Kamille - und Pfefferminzpflanzen, die wir, jedes Mal in Gruppen von 6 bis 8 Schülern, sammelten. Ich hatte mich dann auf eine bestimmte Beerensorte spezialisiert. Das waren fast kirschgroße, dunkelblaue Beeren, die an großen Sträuchern wuchsen. Ich war mit großem Eifer dabei, weshalb ich mehrmals gelobt wurde. Was das aber für Beeren waren und was man daraus machte, das weiß ich bis heute nicht. Essen konnte oder sollte man sie jedenfalls nicht.
Im Hause HOHENZOLLERN gab es einen Eklat, der jedoch von uns Kindern als interessante Abwechslung betrachtet wurde. Dieser Eklat war genau genommen die Folge eines Vorgangs, an dem ich zunächst schuldlos war. Peter, die anderen Jungen und ich bildeten so eine Art Jungschar, die sich zu gemeinsamen Spielen zusammen fand. Aus der Sicht mancher Erwachsener spielten wir meistens dumme Streiche. Der größte von uns, seinen Namen weiß ich leider nicht mehr, war unser Anführer und der bestimmte stets, was wir machen wollten. Übelmeinende hätten uns auch als eine Kinderbande bezeichnen können. An dem Tag, an dem sich alles abspielte und zum Eklat führte, sollte unser Anführer angeblich für seinen kleinen Bruder ein Buch kaufen. Gutgläubig folgten wir ihm. Die Buchhandlung war direkt hinter der Saalebrücke. Wir gingen alle hinein. Im Laden waren so viele Kunden, dass wir nicht beachtet wurden. Alle sechs interessierten wir uns für die wunderbaren Bildbände, die in einem der seitlichen Regale standen. Ein besonderes Buch war es dann, welches die Blicke von uns allen auf sich zog. So etwas hatten wir noch nie zuvor gesehen: Ein toller Bildband über Dinosaurier! Gab es solche Tiere wirklich? Der Laden wurde immer voller und wir wurden weder vom Verkaufspersonal noch von der Kundschaft beachtet.
Nach einiger Zeit hatten wir genug gesehen und ohne dass unser Anführer für seinen kleinen Bruder das Buch gekauft hätte, verließen wir die Buchhandlung. Gemächlich bummelnd gingen wir zurück und benutzten den Weg, der direkt neben dem Saaleufer lag. Ja und dann? Dann hatte einer von uns den Bildband mit den Dinosauriern! Poah! Mann eh! Wieso hatten wir das Buch dabei? Wer von uns hatte es gekauft? Keiner hatte es gekauft! Dann hatte es doch einer geklaut! Wer? Keiner hatte es geklaut! Aber es war doch da! Ja, ja, das stimmte zwar, aber geklaut hatte es niemand von uns! Das Buch gehörte also uns allen, oder? Klar doch, dass es uns allen gehörte. Und wohin sollten wir mit dem Buch, das uns allen gehörte? Unser Anführer meinte, dass wir damit am besten zum HAUS HOHENZOLLERN sollten, also da, wo ich wohnte. Ich wusste nicht so recht, was ich zu diesem Vorschlag sagen sollte und guckte unseren Anführer fragend an. Der begründete seinen Vorschlag mit dem Pavillon im Garten von HAUS HOHENZOLLERN. Da konnte man sich hinsetzen und die Bilder mit den Dinosauriern in aller Ruhe bewundern. Das Schöne an dem Pavillon war aber, dass man dahinter das Buch sehr gut verstecken konnte, weil da dieser Kasten war. Also gingen wir alle zum HAUS HOHENZOLLERN. Es ging eine etwa achtstufige Treppe hoch und dann waren wir im Garten dieses Kurhauses, welches ja mein Zuhause war. Einige Mütter saßen auf den Bänken und sahen dem Spiel der Kinder zu. Auch Günter und Karl-Heinz, meine beiden Brüder spielten mit. Unsere Mutter war aber nicht zugegen. Sie fühlte sich seit einiger Zeit immer sehr müde und machte wohl oben in ihrem Zimmer ein Nickerchen. Das kam wahrscheinlich von dem neuen Geschwisterchen, das der Klapperstorch bald bringen würde.
Wir gingen sofort nach rechts zum Pavillon. Aus dem Pavillon hatte man einen schönen Blick auf die Hauptstraße, die zum Bahnhof führte. Der „fließende“ Verkehr bestand nur aus einigen Pferdekutschen und einigen Fußgängern. Unser Interesse galt aber dem wunderbaren Buch mit den vielen Bildern. So vier oder fünf Bilder waren sogar farbig. Einer von uns fing plötzlich damit an, ein Bild aus dem Buch heraus zu reißen. Sofort fand er einen Nachahmer, der aber zwei Bilder heraus riss. Es gab erfreulicherweise keinen Streit, da es noch viele Bilder in dem Buch gab. Jeder konnte sich zwei Bilder nehmen und mir gelang es, zwei farbige Bilder zu ergattern. Danach konnte sich jeder noch einige Bilder nehmen, bis nur noch der Textteil übrig blieb, für den sich aber niemand interessierte. Wie viele Bilder ich zum Schluss hatte, weiß ich nicht mehr. Den Textteil ließen wir achtlos liegen, bis dann einige Kleinkinder, zu denen auch mein Bruder Karl-Heinz gehörte, damit spielten. So kam es dann, dass der Textteil Seite für Seite auf der Straße landete. Das hatte eine Beschwerde zur Folge und die Verwalterin des HAUSES HOHENZOLLERN verlangte von den Müttern, dass sie die Buchseiten von der Straße entfernten. Die Frage, wie wir an das Buch gekommen waren, beantwortete Peter mit der Behauptung, dass wir es gefunden hätten. „Gefunden? Wo denn?“ Diese Doppelfrage kommentierte unser Anführer mit einem schlichten „dahinten“ und damit schienen zunächst alle zufrieden.
Dann kam es aber doch zu einem Streit, weil einer aus unserer „Jungschar“, es war Harald, mir die Farbbilder nicht gönnte. Er wollte mir eines davon abnehmen. Es entstand eine Rangelei, in deren Verlauf ich ihm ins Gesicht schlug. Er lief sofort zu seiner Mutter, um ihr das zu melden. Sie hatte zwar genau so einen dicken Bauch wie meine Mutter, aber sie war nicht so schläfrig. Sie weilte bei den anderen Frauen und nahm regen Anteil an der Unterhaltung. Hurtig sprang sie auf und war ganz schnell im Pavillon, um mir eine leichte Ohrfeige zu geben.
Die Ohrfeige war wirklich von der leichten Sorte, denn sie tat nicht weh. Es war mehr so ein Streicheln. Dennoch eilte ich zu meiner Mutter, die gerade im Halbschlaf auf dem Kanapee lag. Sie lag auf dem Rücken und die Wölbung ihres Bauches war enorm. „Mama“, rief ich, „die Mutter von dem Harald hat mich geschlagen!“ Mit Staunen sah ich, wie aus meiner schläfrigen Mutter ein hochsportliches Wesen wurde. Die Müdigkeit abschütteln? Nein, das brauchte sie nicht! Schwups stand sie neben dem Kanapee, zupfte an ihrem dunkelbraunen Umstandskleid herum, stieg in ihre Schuhe und dann ging es hinaus aus dem Zimmer. Dabei zeigte ihr Gesicht eine wilde Entschlossenheit. Ob ich mitkommen sollte? Davon hatte sie zwar nichts gesagt, aber ich lief hinterher. Zielstrebig eilte sie zu Harald´s Mutter. Der Eklat war wohl nicht mehr abzuwenden.
„Sie haben meinen Dieter geschlagen!“ fauchte meine Mutter ihre Gegnerin an. Die konterte: „Dazu hatte ich auch allen Grund, liebe Frau Schulz, denn sie sollten wissen, dass ihr Dieter meinen Harald blutig geschlagen hat!“ Meine Mutter sah mich prüfend an und wollte wissen, was ich dazu zu sagen hätte. Ich druckste erst etwas herum und sagte dann, dass der Harald mir meine Bilder klauen wollte. „Was?“, rief Haralds Mutter, „Bilder stehlen? Mein Harald stiehlt nicht!“ Nun ließ Harald sich zu einer bodenlosen Gemeinheit hinreißen: „Der Dieter hat ja auch das Buch mit den Dinosauriern gestohlen!“ Diese ungeheure Lüge veranlasste eine andere Frau dazu, eine eigene Beurteilung abzugeben: „Ach so ist das gewesen, dachte ich mir doch, dass die das Buch gestohlen haben, von wegen dahinten gefunden, so etwas gibt es doch gar nicht!“
Haralds Mutter aber riet meiner Mutter, mit mir doch mal ein ernstes Wörtchen zu reden. Natürlich war meine Mutter sprachlos und konnte mich nur fragend ansehen. Jetzt zeigte sich, was für ein feiner Kerl doch Peter war. Er flüsterte mit unserem Anführer und einem anderen Jungen aus unserer Jungschar, und trat dann mit einem triumphierenden Grinsen nach vorne. Auf Harald zeigend rief er laut: „Von wegen, der Dieter soll das Buch gestohlen haben! Der Dieter war das nicht! Du warst das! Wir alle haben gesehen, wie Du das Buch gestohlen hast! Und wenn Du noch mal sagst, dass das der Dieter war, dann gehen wir zur Polizei!“
Laut schreiend bestritt Harald den Diebstahl und seine Mutter unterstützte ihn darin. „Mein Harald hat noch nie gestohlen, der weiß genau, dass man nicht stehlen darf!“ „Und mein Dieter hat das Buch erst recht nicht gestohlen!“, rief meine Mutter laut dazwischen. Die Verwalterin wollte den Streit nicht eskalieren lassen, und bat die Damen, wie sie sagte, sich doch wieder zu vertragen. Was aber das Buch beträfe, das sicherlich gestohlen worden sei, so sollten doch die beiden Mütter zur Buchhandlung gehen und die Sache im Guten regeln, da man sonst mit einer Anzeige bei der Polizei rechnen müsste. Haralds und meine Mutter gaben sich die Hand und bedauerten zutiefst, dass es zu diesem Missverständnis kommen konnte. Sie versprachen auch der Verwalterin, die Angelegenheit mit der Buchhandlung zu klären. Ich dachte mir nichts dabei, als ich Peter grinsen sah.
Noch am Abend des gleichen Tages rief mein Vater bei der Hausverwaltung an und teilte mit, dass er zwei Tage später kommen würde. Eine andere Frau erhielt von ihrem Mann die gleiche frohe Botschaft. In beiden Familien war die Freude groß und beneidet wurden meine Brüder und ich von den anderen Kindern, deren Väter nicht kommen konnten. Meine Mutter erklärte mir auch, warum die nicht kommen konnten. Das lag angeblich an den Müttern, die noch nicht so weit waren. Wieso das an den Müttern liegen sollte, dass die Väter nicht kommen konnten, war für mich keine schlüssige Erklärung, und ich fragte mich, was da wohl an den Müttern liegen sollte. Zwei Tage später kam also mein Vater, und zwar morgens ganz früh. Meine Mutter, meine Brüder und ich gingen zum Bahnhof, um ihn abzuholen. Begleitet wurden wir von der anderen Frau mit ihren beiden Mädchen, deren Vater mit demselben Zug kam. Die beiden Väter hatten sich bereits während der Eisenbahnfahrt kennen gelernt und so verließen sie fröhlich lachend den Zug und begrüßten uns.
Die Zeit in Bad Kissingen mit meinem Vater war prima. Wir machten ausgedehnte Spaziergänge in der näheren Umgebung, an denen auch mein Bruder Günter teilnahm. Hin und wieder gingen auch meine Mutter und mein jüngster Bruder Karl-Heinz mit. Letzterer aber in einem kleinen, offenen Kinderwagen. Abends, nach dem Abendbrot, blieben die meisten Mütter noch eine Zeit lang zusammen, um zu erzählen oder auch um Lieder zu singen. Nun waren aber die beiden Väter da und die Frauen wollten wissen, ob die Engländer immer noch die deutschen Städte so schlimm bombardieren würden. Was Düsseldorf betraf, so hätte mein Vater einiges erzählen können. Er sagte aber sehr wenig, denn wenn man zu viel über den Krieg erzählte, konnte man der Wehrkraftzersetzung bezichtigt werden. Wie ich später erfuhr, war auch Vorsicht geboten, denn es gab überall Denunzianten und wegen Feindpropaganda oder gar Wehrkraftzersetzung belangt zu werden, war keine Kleinigkeit. Da ist schon manch einer vor dem Volksgerichtshof gelandet.
Der andere Vater kam nicht aus Düsseldorf. Die Wohnung seiner Familie wurde bei einem der letzten Luftangriffe völlig zerstört, und er wohnte nun in einem Wohnheim der Fabrik, in der er arbeitete. Er erzählte, dass es in der Nachbarschaft der ehemaligen Wohnung seiner Familie noch einige nicht zerstörte Häuser gab, deren Bewohner aber auch evakuiert wurden. Tja, und da wollte er eine Wohnung für seine Familie haben. Das Wohnungsamt war aber dagegen, weil seine Familie doch in Bad Kissingen bestens aufgehoben wäre. Hau, da hätten die ihn aber einmal kennen lernen können. Er hätte den Nichtstuern vom Wohnungsamt damit gedroht, die Wohnung notfalls aufzubrechen, um darin einziehen zu können. Die hätten vielleicht dumm geguckt. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten einige Frauen den Mann bewundernd angeschaut. Mir erschien aber das, was er da gesagt hatte, irgendwie befremdlich. Wie sollte das denn gehen, eine Wohnung aufzubrechen, um darin zu wohnen? Mein Vater äußerte sich später sehr negativ über diesen Mann. Er hielt ihn für einen Angeber.