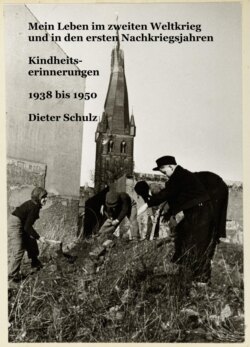Читать книгу Mein Leben im zweiten Weltkrieg und in den ersten Nachkriegsjahren - Dieter Schulz - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der 11. Juni 1943
ОглавлениеDer 11. Juni 1943 sollte für mich und meine Familie alles ändern. Wieder unterbrach das Auf und Ab des durch Mark und Bein gehenden Heultons der Sirene unsere Nachtruhe, und mit der gewohnten Routine eilten wir zur Friedenskirche, um in deren Luftschutzkeller Schutz vor den Bomben zu finden.
Diesmal hatten die Tommys es wohl auf Düsseldorf-Bilk, das war unser Stadtteil, abgesehen. Die Bombeneinschläge waren in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das Donnern und Rumsen war schon für sich allein genommen beängstigend. Wenn aber so eine Zehnzentnerbombe in der Nähe ihr Ziel fand, schien selbst der Keller unter der Kirche zu wackeln, und fing dann jemand an zu beten, beteten fast alle mit. Ein alter Mann, fast alle Männer waren alt, konnte oder wollte nicht beten. Stattdessen schimpfte er über die „verdammten Schweine, diese Drecksäue“. Der Luftschutzwart wollte Mut machen. Mit lauter Stimme rief er: „Keine Angst Leute, die Kirche wird nicht getroffen, die werfen nämlich keine Bomben auf Kirchen!“ „Was?“, meldete sich ein anderer zu Wort, „da hätten Sie mal Sankt Josef in Oberbilk sehen sollen. Von wegen, keine Kirchen. Die sind doch in der Nacht überhaupt nicht zu erkennen!“ Das Donnern und Rumsen ging weiter, und oft genug wackelte der Luftschutzkeller, wobei auch Putz von der Decke fiel. Eine Frau neben mir rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, und ihr Magen gab knurrende Laute von sich. Dabei schnitt sie eigenartige Grimassen und stieß auch unverständliche Töne aus, die sich wie „Uck, uck“ anhörten. Ob sie wohl vor Angst in die Hose machte? Ja, tatsächlich, es roch sehr unangenehm.
Dieses „Uck, uck“ übte auf mich eine nachhaltige Wirkung aus: Etwa vier Jahre später, ich war im sechsten Schuljahr in der Schule an der Hermann-Straße und es wurde eine Klassenarbeit geschrieben. Wie damals bei einer Klassenarbeit üblich, war es nahezu absolut still. Der Lehrer, Herr Füsser, stand plötzlich neben mir und fragte: „Was machst du denn da?“ Ja, was machte ich? Voller Scham hörte ich, was ich da machte: Ich stieß das „Uck, uck“ aus. Dass mich niemand meiner Mitschüler auslachte, finde ich im Rückblick bemerkenswert. Nach der Stunde fragte mich der Lehrer nach dem Grund für mein sonderbares Verhalten. Ich berichtete ihm von meinen Luftschutzkeller-Erlebnissen. Er sah mich nur an und nickte vor sich hin. Dieser Tick hat mich bis heute nicht verlassen und oft genug stoße ich dieses „Uck, uck“, für andere allerdings kaum hörbar, aus. Ja, irgendwelche Macken hat wohl jeder von uns behalten.
Aber zurück zum Luftschutzkeller: Hin und wieder fiel auch die elektrische Beleuchtung aus, und dann kam es bei einigen Frauen zu Panikattacken. Eine Frau rief mit schriller Stimme: „Wir sind getroffen, wir sind getroffen!“ Meistens konnte die Beleuchtung aber wieder eingeschaltet werden. Notkerzen gab es natürlich auch, aber ich konnte einmal einem Gespräch zwischen zwei Männern entnehmen, dass Kerzen dann lebensgefährlich waren, wenn aus der Gasleitung Gas entwichen war. In solch einem Falle drohte auch ohne Bombeneinschlag eine Explosion.
Da die Luftschutzkeller meistens verschlossen wurden, um das Eindringen von Rauchgasen zu verhindern, traten nicht selten Probleme mit der Frischluftversorgung auf. Da bekam dann jemand Atemnot und rief mit krächzender Stimme: „Ich kriege keine Luft, keine Luft!“ Das veranlasste wiederum einen anderen Mann zu der Forderung, endlich die Frischluftversorgung zu betätigen. Der dafür zuständige Luftschutzwart, es war diesmal nur einer, und zwar ein kleiner Mann, versuchte daraufhin eine der beiden Kurbeln der Frischluftanlage zu betätigen. Das gelang ihm aber nicht, da er zu schwach war. Es meldete sich ein zweiter Mann und mit vereinten Kräften schafften sie es, die Maschine in Gang zu setzen. Das ging zunächst aber sehr langsam und erst nachdem die Drehzahl gesteigert wurde, kam die ersehnte Frischluft. Weshalb die Frischluft so säuerlich roch, konnte mein Vater mir nicht erklären.
Die Bombeneinschläge wurden allmählich weniger, und endlich kam der langgezogene Heulton der Entwarnung. Als wir danach den Luftschutzkeller verließen, empfing uns draußen eine rauchgeschwängerte Luft, und dichte Staubwolken erschwerten das Atmen zusätzlich. Die Gefahr war vorbei und die durch die Angst bewirkten Verkrampfungen lösten sich. Nun erkannte ich etwas, was sich bei mir bei späteren Bombenangriffen aber auch bei anderen schlimmen Gefahrensituationen wiederholen sollte. Meine Hose war durchnässt! In den Momenten höchster Angst hatte ich in die Hose gemacht, ohne dies zu bemerken.
Der Heimweg war diesmal gut beleuchtet. Das kam von den brennenden Häusern, deren Flammen aber nicht nur Licht spendeten, sondern auch eine große Hitze ausstrahlten. Der Brandgeruch verstärkte sich und das ließ nichts Gutes erwarten. Als wir uns der Kronen-Straße näherten, wurde schnell klar, dass hier einiges herunter gekommen war. Ja, so war es auch und das Haus Nr. 29, unser Haus, brannte lichterloh. Wie feurige Zungen flackerten die Flammen aus den Fensteröffnungen. Stabbrandbomben und Phosphorkanister hatten ihre volle Wirkung entfaltet. Die Feuerwehr konnte sich nicht um unser Haus kümmern, denn sie war voll mit der Bergung von Menschen aus dem von einer Sprengbombe schwer getroffenen Haus auf der Ecke Kronen-Straße/Kirchfeld-Straße beschäftigt. Das war schräg gegenüber von unserem Haus. Die Frau, die immer wieder „Helene, Helene“ schrie und in das brennende Haus hinein wollte, wurde von zwei Rot-Kreuz-Schwestern fortgeführt. Bei uns war nichts mehr zu machen, unser Haus brannte wie eine riesige Fackel, wir waren ausgebombt. So verzweifelt meine Eltern auch waren, ich wartete fast mit der Neugier eines Unbeteiligten darauf, wie es nun weiter gehen würde. Ich glaube, ich fand es sogar interessant, ausgebombt zu sein. Das war doch etwas Besonderes, oder? Etliche meiner Klassenkameraden waren auch ausgebombt.
Meine Eltern folgten den Anweisungen eines SA-Mannes, der mit dem Führer, den ich ja von vielen Bildern her gut kannte, sehr viel Ähnlichkeit hatte. Mit seiner braunen Uniform und seiner zackigen Stimme imponierte er mir sehr. Eine Frau rief mit gellender Stimme: „So eine bodenlose Gemeinheit! Das sind doch die reinsten Verbrecher, diese Mörder!“ „Keine Sorge“ antwortete der SA-Mann, „das kriegen die Schweine alles doppelt und dreifach zurück, unsere Bomben sind nämlich bedeutend besser als die von den Engländern!“
Zusammen mit vielen anderen Ausgebombten wurden wir vorbei an brennenden Häusern zur Schule an der Jahn-Straße geführt und bekamen dort einen Klassenraum als vorläufige Wohnung zugewiesen. Den Klassenraum mussten wir uns aber mit zwei anderen Familien teilen. In dem Raum standen Etagenbetten mit Matratzen und Bettzeug. Mit Vorhängen aus Wolldecken wurden drei getrennte Bereiche gebildet, so dass jede Familie quasi eine eigene Wohnung hatte. Am frühen Morgen kam die NSV und brachte Butterbrote und Pfefferminztee. Wir Kinder fanden diese Situation gar nicht so dramatisch, im Gegenteil, es war sogar irgendwie schön. Der Schulbetrieb war eingestellt und so konnten wir wunderbar spielen. Das Treppenhaus wurde unser Lieblingsspielplatz.
Meine Eltern gingen mit meinen Brüdern und mir noch mal zur Kronen-Straße, um zu sehen, ob da nicht doch noch etwas zu retten war. Die Hausfassade stand noch und von weitem sah man nicht sofort, dass das Haus völlig ausgebrannt war. Wir durften aber nicht zu nah heran kommen, da Arbeiter damit beschäftigt waren, die Wände abzustützen. Russen mussten den auf dem Bürgersteig liegenden Schutt forträumen. Zu retten gab es da nichts mehr!
Als wir zurückgingen, weinte meine Mutter. Ich wurde ebenfalls sehr traurig, als sie mir mitteilte, dass auch mein schönes Schlachtschiff und das Torpedoboot verbrannt waren. Dass das Sparkonto meines Vaters, das heißt, sein Zigarettendepot auch verbrannt war, bezeichnete er als kleineres Übel und meinte, dass wir noch großes Glück gehabt hätten. Diese Bemerkung war typisch für meinen Vater, der selbst in diesem Moment, wo wir doch alles verloren hatten, etwas Positives in dieser Situation fand. „Die Hauptsache ist, dass wir noch am Leben sind!“ sagte er wie zur Begründung für seinen Optimismus.
Der Aufenthalt in der Schule an der Jahn-Straße dauerte nicht lange und dann stand da ein Bus auf dem Schulhof. Der brachte uns und die anderen Ausgebombten zu Bahnhof. Niemand hatte nennenswerte Habseligkeiten dabei. Meistens, wie bei uns, nur ein kleines Köfferchen mit den allerwichtigsten Sachen. Das waren die Papiere und ein paar Kleinigkeiten.