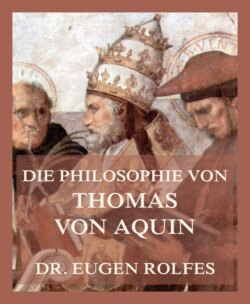Читать книгу Die Philosophie von Thomas von Aquin - Dr. Eugen Rolfes - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление§ 4. Objektivität der Erkenntnis.
1. Es scheint, dass die von den Phantasmen abstrahierten Gedankenbilder sich zu unserem Verstände verhalten wie das, was gedacht wird. Denn das aktuell Gedachte ist in dem Denkenden, weil das aktuell Gedachte der aktuelle Verstand selbst ist. Aber von dem gedachten Ding ist in dem aktuell denkenden Verstände nur das abstrahierte Gedankenbild. Also ist dieses Bild das aktuell Gedachte selbst.
2. Außerdem, das aktuell Gedachte muss in etwas sein, sonst wäre es nichts. Es ist aber nicht in dem Ding, das außerhalb der Seele ist, weil, da das extramentale Ding stofflich ist, nichts, was in ihm ist, aktuell gedacht sein kann. Es bleibt also nur übrig, dass das aktuell Gedachte in dem Verstände ist, und so ist es nichts anderes als das vorerwähnte Gedankenbild.
3. Außerdem, der Philosoph sagt 1 Perihermenias 16 a 3, dass „die Laute Zeichen der in der Seele hervorgerufenen Vorstellungen sind". Die Laute bezeichnen aber die gedachten Dinge; denn wir bezeichnen durch die Laute das, was wir denken. Also sind es eben die Vorstellungen der Seele, die Gedankenbilder, die aktuell gedacht werden.
Aber dagegen ist: das Gedankenbild verhält sich zum Verstand wie das Sinnenbild zum Sinn. Das Sinnenbild ist aber nicht das, was sinnlich wahrgenommen wird, sondern vielmehr das, wodurch der Sinn wahrnimmt. Also ist das Gedankenbild nicht das, was aktuell gedacht wird, sondern das, wodurch der Verstand denkt.
Ich antworte, man müsse sagen, dass nach der Behauptung einiger Philosophen die erkennenden Vermögen, die in uns sind, nichts anderes erkennen als ihre eigenen Affektionen (passiones), dass z. B. der Sinn nur die Affektion seines Organs wahrnimmt. Und hiernach denkt der Verstand nichts als seine Affektion (Vorstellung), d. h. das Gedankenbild, das er in sich aufgenommen hat. Und hiernach ist dieses Bild eben das, was man denkt.
Aber diese Meinung erweist sich klar als falsch aus zwei Gründen. Erstens, weil es dasselbe ist, was wir denken und worauf die Wissenschaften gehen. Wenn also das, was wir denken, nur die Bilder wären, die in der Seele sind, so folgte, dass alle Wissenschaften nicht auf die Dinge gingen, die außerhalb der Seele sind, sondern nur auf die Gedankenbilder, die in der Seele sind, wie nach den Platonikern alle Wissenschaften auf die Ideen gehen, die sie als aktuell gedacht setzten. 14 Zweitens, weil sich folgerichtig der Irrtum der Alten ergäbe, dass „alles wahr ist, was so scheint" (vgl. Aristot. 4 Metaphys. 6. 1011a 18; Plat. Theätet. K. 8, 152A), und so, dass kontradiktorische Sätze zugleich wahr wären. Denn wenn das Vermögen nur die eigene Affektion erkennt, so urteilt es nur über sie. Etwas scheint aber so, wie das erkennende Vermögen affiziert wird. Immer also wird das Urteil des erkennenden Vermögens auf dasjenige gehen, worüber es urteilt, d. h. auf die eigene Affektion, je wie sie ist; und so wird jedes Urteil wahr sein. Wenn z. B. der Geschmack nur die eigene Affektion wahrnimmt, so wird einer mit gesundem Geschmack, wenn er urteilt, dass der Honig süß ist, richtig urteilen; und ebenso wird einer mit infiziertem Geschmack, wenn er urteilt, dass der Honig bitter ist, richtig urteilen. Denn jeder von beiden urteilt nach der Art, wie sein Geschmack affiziert wird. Und so folgt, dass jede Meinung gleich wahr sein wird, und überhaupt jede Auffassung. 15
Und deshalb muss man sagen, dass das Gedankenbild sich zum Verstände verhält wie das, wodurch der Verstand denkt, was auf folgende Weise einleuchtet. Da es eine zweifache Tätigkeit gibt, wie es 9 Metaphys. 8. 1050 a 30 ff. heißt, eine, die in dem Tätigen bleibt, wie Sehen und Denken, und eine andere, die auf ein äußeres Ding geht, wie Wärmen und Schneiden, so geschieht jede von beiden einer gewissen Form gemäß. Und wie die Form, gemäß der die auf ein äußeres Ding zielende Tätigkeit erfolgt, das Bild des Objekts der Tätigkeit ist, wie die Wärme des Wärmenden ein Bild des Gewärmten ist, so stellt die Form, gemäß der die im Tätigen bleibende Tätigkeit erfolgt, ebenfalls ein Bild des Objekts dar. Daher ist es das Bild des sichtbaren Dinges, gemäß dem das Gesicht sieht, und ist das Bild des gedachten Dinges, welches das Gedankenbild ist, die Form, gemäß der der Verstand denkt.
Aber weil der Verstand auf sich selbst reflektiert, so denkt er gemäß derselben Reflexion sowohl sein eigenes Denken, als auch das Bild, durch das er denkt. Und so ist das intellektuelle Bild (species intellectiva) sekundär das, was gedacht wird. Aber das, was primär gedacht wird, ist das Ding, dessen Bild die gedankliche Form ist.
Und das erhellt auch aus der Meinung der Alten, die behaupteten, dass „Gleiches durch Gleiches" erkannt wird". Denn sie behaupteten, dass die Seele durch die Erde, die in ihr sei, die Erde erkenne, die außer ihr sei, und entsprechend redeten sie von den anderen Elementen (vgl. Arist. de Anima I, 2. 404b 17 ff. und 5. 409b ff.; Thomas lect. 4 et 12). Nehmen wir nun statt der Erde das Bild der Erde nach der Lehre des Aristoteles de Anima (3, 8. 431b 29; Thomas lectio 13), der erklärt, nicht der Stein sei in der Seele, sondern das Bild des Steines, so wird folgen, dass die Seele durch die Gedankenbilder die' Dinge erkennt, die außerhalb der Seele sind.
Auf das Erste ist also zu sagen, dass das Gedachte! durch sein Bild in dem Denkenden ist Und in diesem Sinne heißt es, dass das aktuell Gedachte der aktuelle Verstand ist, sofern das Bild des gedachten Dinges die Form des Verstandes ist, so wie das Bild des sinnlichen! Dinges die Form des aktuellen Sinnes ist. Daher folgt' nicht, dass das abstrahierte Gedankenbild das sei, was aktuell gedacht wird, sondern dass es dessen Bild sei.
Auf das Zweite ist zu sagen, dass der Ausdruck „aktuell gedacht" zweierlei besagt: das gedachte Ding und das Gedachtwerden selbst. Und ebenso versteht man unter dem Ausdruck „abstrahiertes Allgemeines" zweierlei: die Natur des Dinges selbst und die Abstraktion oder Allgemeinheit. Die Natur selbst also, der das Gedachtwerden oder das Abstrahiertwerden oder der Begriff (intentio) der Allgemeinheit mitfolgt, ist nur in den Einzeldingen, aber das Gedachtwerden oder Abstrahiertwerden selbst oder der Begriff der Allgemeinheit ist in dem Verstände. Ein gleiches können wir bei dem Sinne sehen. Das Gesicht sieht die Farbe des Apfels ohne seinen Geruch. Fragt man also, wo die Farbe sei, die ohne den Geruch gesehen wird, so leuchtet ein, dass die Farbe, die gesehen wird, nur an dem Apfel ist Dass sie aber ohne den Geruch wahrgenommen wird, folgt ihr von Seiten des Gesichtes mit, sofern in dem Gesichte das Bild der Farbe ist, und nicht des Geruchs. Ebenso ist die Menschheit, die gedacht wird, nicht anders als in diesem oder in jenem Menschen vorhanden, dass aber die Menschheit ohne die individuellen Zutaten vorgestellt wird, was sie abstrahieren heißt, ein Prozess, an den sich der Begriff der Allgemeinheit knüpft, folgt der Menschheit mit, sofern sie mit dem Verstände aufgefasst wird, in dem das Bild der Artbeschaffenheit und nicht der individuellen Prinzipien ist
Auf das Dritte ist zu sagen, dass sich in dem sensitiven Teile eine doppelte Tätigkeit rindet: eine, die nur auf der Veränderung beruht, und so kommt die Tätigkeit des Sinnes dadurch zustande, dass er durch das Sinnliche verändert wird. Die andere Tätigkeit ist die Gestaltung (formatio), sofern die Einbildungskraft sich ein Bild (idolum) eines nicht gegenwärtigen oder auch niemals gesehenen Dinges bildet. Und diese beiden Tätigkeiten sind in dem Verstände verbunden. Denn zuerst kommt die Affektion (passio) des intellectus possibilis in Betracht, sofern er nämlich mit dem Gedankenbild informiert wird. Mit ihm informiert, bildet er dann zweitens entweder die Begriffsbestimmung oder die Trennung oder Verbindung, die durch die Laute ausgedrückt werden. Daher ist der Begriff, den das Nennwort (nomen) bezeichnet, die Definition, und 'die Aussage bezeichnet die Verbindung und Trennung des Verstandes. Die Laute bezeichnen also nicht die Gedankenbilder, sondern das, was der Verstand sich bildet, um über die äußeren Dinge zu urteilen. Summa Theol. p. 1, qu. 85, art. 2; vgl. 4 Cont Gent. c. 11; De Verit. qu. 10, art. 9; De Spiritualibus Creat. art. 9 ad 2; Comp. Theol. 85; 3 De An. lect. 8.
Das in den intellectus possibilis aufgenommene Bild verhält sich nicht wie das, was gedacht wird. Denn da alle Künste und Wissenschaften ihr Objekt an dem haben, was gedacht wird, so würde folgen, dass alle Wissenschaften auf die in dem intellectus possibilis vorhandenen Spezies gingen, was offenbar falsch ist. Denn keine Wissenschaft stellt über sie irgendeine Betrachtung an, als nur die Physik und Metaphysik. Das in den intellectus possibilis aufgenommene Bild verhält sich mithin beim Denkprozess wie das, wodurch man denkt, wie auch das Bild der Farbe im Auge nicht das ist, was man sieht, sondern das, wodurch man sieht. Dasjenige dagegen, was man denkt, ist nichts anderes als das Wesen (ratio) der außerhalb der Seele existierenden Dinge, wie man auch die außerhalb der Seele existierenden Dinge (nicht aber ihr Wesen) mit dem körperlichen Gesichte sieht. Denn die Künste und Wissenschaften sind zu dem Ende erfunden worden, damit die Dinge in ihren Naturen erkannt werden.
Wenn aber die Wissenschaften auf das Allgemeine oder die Universalien gehen, so brauchen gleichwohl die Universalien nicht außerhalb der Seele für sich sul sistierend zu sein, wie Plato behauptet hat (nach der unzutreffenden Darstellung bei Aristoteles). Denn obgleich es zur Wahrheit der Erkenntnis erforderlich ist, dass die Erkenntnis dem Ding entspricht, so braucht doch die Weise der Erkenntnis und des Dinges nicht dieselbe zu sein. Denn was in dem Ding verbunden ist, wird zuweilen getrennt erkannt. So ist z. B. ein und dasselbe Ding weiß und süß zugleich, aber das Gesicht erkennt nur die Weiße, der Geschmack nur die Süße. So denkt auch der Verstand die in dem sinnlichen Stoffe existierende Linie ohne den sinnlichen Stoff (d. h. ohne den Stoff mit seinen unter die Sinne fallenden Eigenschaften, die Farbe, die Härte usw.), obschon er sie auch mit dem sinnlichen Stoff denken könnte (z. B. als Grenzlinie der Flächen eines Zuckerpolyeders). Diese Verschiedenheit tritt aber entsprechend der Verschiedenheit der in den Verstand aufgenommenen Gedankenbilder auf, die zuweilen nur die Quantität darstellen, zuweilen aber die quantitative sinnliche Substanz. Ebenso aber denkt der Verstand, obgleich die Natur der Gattung und der Art nie anders als in diesen Individuen ist, gleichwohl die Natur der Art und der Gattung, ohne die individuierenden Prinzipien zu denken, und das heißt die Universalien, das Allgemeine denken. Und so widersprechen sich diese beiden Dinge nicht, dass die Universalien nicht außerhalb der Seele subsistieren, und dass der Verstand, die Universalien denkend und erkennend, die Dinge denkt und erkennt, die außerhalb der Seele sind.
Dass aber der Verstand die Natur der Gattung oder Art entblößt von den individuierenden Prinzipien denkt, kommt von der Beschaffenheit des in ihn aufgenommenen Gedankenbildes, das durch den wirkenden Verstand immateriell geworden ist, sofern er es des Stoffes und der stofflichen, individuierenden Bestimmungen entkleidet (davon abstrahiert) hat. Und deshalb können die sinnlichen Vermögen das Allgemeine nicht erkennen, weil sie keine immaterielle Form aufnehmen können, da sie (ihre Objekte) immer in ein körperliches Organ aufnehmen. Cont Gent üb. 2, cap. 75.