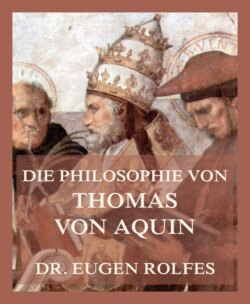Читать книгу Die Philosophie von Thomas von Aquin - Dr. Eugen Rolfes - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. Teil. Naturlehre.
§ 1. Hoher Wert der Naturerkenntnis
a) für die gläubige Betrachtung.
Das Nachdenken über die göttlichen Werke ist notwendig, damit der menschliche Glaube über Gott unterwiesen werde.
Erstens darum, weil wir durch das Nachdenken über die Werke Gottes in den Stand gesetzt werden, seine Weisheit, wie unvollkommen auch immer, zu bewundern und zu betrachten. Denn die Erzeugnisse der Kunst stellen uns die Kunst selbst vor Augen, da sie nach ihrem Bilde hergestellt sind. Gott hat aber die Dinge durch seine Weisheit ins Dasein gerufen, weshalb es heißt: „Alles hast du mit Weisheit gemacht", Ps. 103, 24. Wir können daher, vermöge der Betrachtung der Werke, die göttliche Weisheit erschließen, als welche den erschaffenen Dingen wie durch eine Mitteilung ihres Bildes aufgeprägt ist Denn es heißt: „Er hat sie ausgegossen über alle seine Werke", Sirach 1, 10. Da deshalb der Psalmist sagte: „Wunderbar kommt mir vor dein Wissen: gar hoch ist es, ich kann es nicht erreichen", Ps. 138, 6, und zusätzlich der hilfreichen göttlichen Erleuchtung gedachte, da er spricht: „Die Nacht mein Licht in meiner Wonne", ebenda V. 11, so bekennt er, dass ihm die Betrachtung der göttlichen Werke zur Erkenntnis der göttlichen Weisheit verholfen habe, indem er spricht: „Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt sie gar wohl", ebenda V. 14.
Zweitens. Diese Betrachtung führt zur Bewunderung der höchsten Macht Gottes und erweckt als deren Folge in den Herzen der Menschen die Ehrfurcht vor ihm. Denn die Macht des Erschaffenden muss über die erschaffenen Dinge erhaben gedacht werden, und deshalb heißt es: „Haben sie über die Kraft und Wirkung dieser Dinge", des Himmels, der Sterne und der kosmischen Elemente, „sich verwundert", die Philosophen nämlich, „so hätten sie erkennen sollen, dass der, so sie erschaffen, noch stärker sei", Sap. 13,4, und heißt es ferner: „Das Unsichtbare an Gott ist in den erschaffenen Dingen erkennbar und sichtbar, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit", Rom. 1, 20. Aus dieser Bewunderung Gottes geht aber die Furcht und die Ehrerbietung hervor, weshalb es heißt: „Groß ist dein Name in der Macht: wer sollte dich nicht fürchten, o König der Völker?" Jerem. 10,6f.
Drittens. Diese Betrachtung entzündet die Gemüter der Menschen zur Liebe der göttlichen Güte. Denn was immer von Güte und Vollkommenheit in den verschiedenen Kreaturen einzeln verteilt ist, ist alles in ihm als dem Urquell aller Güte universell vereinigt, wie oben Buch 1, Kap. 28 gezeigt worden ist. Wenn daher die Güte, die Schönheit und der Liebreiz der Geschöpfe die Gemüter der Menschen so sehr einnimmt, so wird der Born der Güte Gottes selbst, andachtsvoll verglichen mit den Bächlein der Güte, die man in den einzelnen Geschöpfen findet, die Gemüter der Menschen entflammen und gänzlich an sich ziehen. Daher* heißt es: „Du hast mich, o Herr, durch deine Schöpfung erfreut, und über alle Werke deiner Hände frohlocke ich", Ps. 91, 5; und anderswo heißt es von den Kindern der Menschen: „Sie werden trunken werden von der Fülle deines Hauses" d. i. der ganzen Schöpfung, „und" so „wirst du sie mit dem Strome deiner Wonne tränken, weil bei dir die Quelle des Lebens ist", Ps. 35, 9 f. Und wider gewisse Menschen heißt es: „Aus den sichtbaren Gütern", den Geschöpfen, die durch eine Art Teilnahme gut sind, „konnten sie den nicht erkennen, der ist", Sap. 13, 1, nämlich wahrhaft gut, ja, die Güte selbst, wie gezeigt worden, 1, 37 f.
Viertens. Diese Betrachtung erhebt die Menschen zu einer Art Ähnlichkeit mit der göttlichen Vollkommenheit. Denn es ist gezeigt worden, dass Gott, indem er sich selbst erkennt, in sich alles andere schaut, Buch 1, K. 48 f. Da nun der christliche Glaube den Menschen an erster Stelle über Gott unterweist und ihn im Lichte der göttlichen Offenbarung die Geschöpfe erkennen lässt, so entsteht im Menschen sozusagen ein Bild der göttlichen Weisheit. Und darum spricht der Apostel: „Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesichte die Herrlichkeit des Herrn, und werden in dasselbe Bild umgewandelt." 2 Korinth. 3, 18.
So erhellt denn hieraus, wie wichtig es für die Unterweisung im christlichen Glauben sein muss, das Geschaffene aufmerksam zu betrachten. Und darum sagt der weise Mann : „Ich will der Werke des Herrn gedenken, und verkünden, was ich gesehen. Durch das Wort des Herrn entstanden seine Werke." Sirach 42, 15. Cont. Gent. 2, 2.
b) Wert der Naturerkenntnis für die Widerlegung theologischer Irrtümer.
Die Betrachtung der Kreaturen ist auch notwendig, nicht bloß für die Unterweisung in der Wahrheit, sondern auch zur Fernhaltung und Abwehr von Irrtümern. Denn die Irrtümer, die auf die Schöpfung Bezug haben, führen hin und wieder von der Wahrheit des Glaubens ab, insofern sie der wahren Gotteserkenntnis zuwiderlaufen, ein Fall, der auf mehr als eine Weise vorkommen kann.
Einmal so, dass man aus Unkenntnis der geschöpflichen Eigenart sich so weit verirrt, solches, was nur durch ein anderes da sein kann, zur ersten Ursache und zu Gott zu machen, indem man für nichts als für die Kreaturen, die man sieht, eine Schätzung besitzt. Aus dieser Zahl waren diejenigen, die jeden beliebigen Körper für Gott ansahen, von denen es heißt: „Sie halten entweder das Feuer, oder den Wind, oder die schnelle Luft, oder den Kreis der Sterne, oder das große Gewässer, oder Sonne und Mond für Götter.'' Sap. 13, 2.
Zweitens so, dass man solches, was nur Gott zukommt, bestimmten Geschöpfen zuschreibt, was ebenfalls wegen falscher Vorstellungen von den Geschöpfen geschieht. Denn was die Natur oder Eigenart eines Dinges nicht zulässt, wird ihm nur beigemessen, wenn man seine Natur nicht kennt wie wenn man z. B. dem Menschen den Besitz dreier Füße zuschriebe. Was aber nur Gottes ist, lasst die Natur des Geschaffenen nicht zu, wie auch die Natur eines anderen Dinges nicht zulässt, was nur des Menschen ist. So verfällt man denn dem gedachten Irrtum deshalb, weil man die Natur des Geschaffenen nicht kennt. Und gegen diesen Irrtum richtet sich das Wort der Heil. Schrift: „Den unmittelbaren Namen legten sie Steinen und Holz bei." Sap. 14, 21. In diesen Irrtum verfallen diejenigen, die die Erschaffung von Dingen oder die Erkenntnis von Zukünftigem oder das Wirken von Wundern anderen Ursachen als Gott beilegen.
Drittens aber so, dass etwas der göttlichen, auf das Geschaffene wirkenden Macht entzogen wird, weil man die geschöpfliche Natur nicht kennt, wie man an denen sieht, die zwei Prinzipe der Dinge aufstellen und die die Dinge nicht vermöge des göttlichen Willens, sondern vermöge natürlicher Notwendigkeit von Gott kommen lassen, und auch an denen, die entweder alle oder einige Dinge der göttlichen Vorsehung entziehen oder ihr das Vermögen absprechen, abweichend von dem gewöhnlichen Laufe der Natur zu wirken; denn alles dieses tut der göttlichen Macht Eintrag. Und gegen sie richtet sich das Wort der Schrift: „Sie achteten den Allmächtigen, als ob er nichts tun könnte." Job. 22, 17. Und: „Du zeigest deine Macht, an dessen Allmacht man nicht glaubt." Sap. 12, 17.
Viertens. Weil der Mensch, der durch den Glauben zu Gott und damit zu seinem letzten Ziele geführt wird, die Naturen der Dinge und infolgedessen seine eigene Rangstufe im Universum nicht kennt, so glaubt er, bestimmten Geschöpfen, über denen er steht, unterworfen zu sein, wie man an denen sieht, die die menschlichen Entschließungen unter den beherrschenden Einfluss der Gestirne stellen, gegen die gesagt wird: „Fürchtet euch nicht vor den Zeichen des Himmels, vor denen die Heiden sich fürchten", Jer. 10, 2, sowie auch an denen, die die Engel für die Schöpfer der Seelen, und die Seelen der Menschen für sterblich halten, und an anderes solches glauben, was der Würde des Menschen abträglich ist.
Demgemäß ist es also offenbar falsch, wenn es für die Wahrheit des Glaubens nichts austragen soll, was man von dem Geschaffenen denkt, wofern man nur richtig von Gott denkt, wie nach Augustin De origine animae (von der Seele und ihrer Entstehung) Kap. 4 und 5 (?) hin und wieder behauptet worden ist. Denn der Irrtum über das Geschaffene schlägt in eine falsche Wissenschaft von Gott aus und lenkt die Herzen der Menschen von Gott, auf den der Glaube sie hinzurichten strebt, ab, indem er sie bestimmten anderen Ursachen unterwirft und dienstbar macht. Und deshalb droht die Schrift denen, die in dem Geschaffenen irren, Strafen wie Ungläubigen an, indem sie spricht: „Denn sie haben die Werke des Herrn nicht erkannt, die Werke, die aus seiner Hand hervorgegangen, und darum wirst du sie zerstören, und nicht aufbauen." Ps. 27, 5. Und: „So denken sie und gehen irre", Sap. 2, 2\, und wird hinzugesetzt: „Und anerkennen nicht den Ehrenpreis heiliger Seelen" vers. 22. C. Gent. 2, 3.