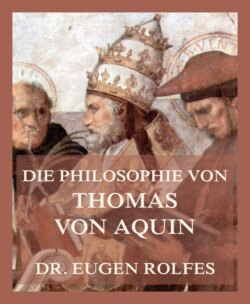Читать книгу Die Philosophie von Thomas von Aquin - Dr. Eugen Rolfes - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Teil. Erkenntnislehre. § 1. Passivität und Aktivität beim menschlichen Denken. Aufnehmender und wirkender Verstand.
ОглавлениеMan spricht von Leiden in dreifacher Weise. Einmal, und im eigentlichen Sinne, wenn einem etwas entzogen wird, was ihm nach seiner Natur oder nach seiner eigentümlichen Neigung angemessen ist, wie wenn das Wasser durch Erwärmung seine Kälte verliert oder der Mensch erkrankt oder betrübt wird. — Zweitens sagt man, weniger im eigentlichen Sinne, von jemanden, dass er leidet, wenn er eines Dinges entledigt wird, mag es ihm angemessen oder nicht angemessen sein, und hiernach leidet nicht nur wer erkrankt, sondern auch wer genest, und nicht nur wer traurig, sondern auch wer froh wird, oder wie immer man qualitativ verändert oder bewegt werden mag. — Drittens sagt man gemeinhin von etwas, dass es leidet, bloß darum, weil das, was in der Potenz zu etwas ist, das, wozu es in der Potenz war, aufnimmt, ohne etwas zu verlieren, und nach dieser Weise kann man von allem, was von dem Vermögen in die Wirklichkeit übergeht, sagen, dass es leidet, auch wenn es vervollkommnet wird. Und so ist unser Denken ein Leiden.
Dieses wird in folgender Weise deutlich. Der Verstand bewegt sich, wie oben (qu. 78, art 1) erklärt worden ist, in seiner Tätigkeit um das Seiende im allgemeinen Es lässt sich also durch Betrachtung der Weise, wie der Verstand sich zu dem allgemeinen Sein verhält, beurteilen, ob er aktuell oder potenziell ist. Es findet sich nämlich ein Verstand, der sich zu dem allgemeinen Sein als Aktus (Wirklichkeit) des ganzen Seins verhält, und so ist der göttliche Verstand beschaffen, der Gottes Wesenheit ist, in der dem Ursprünge und dem Vermögen nach das ganze Sein als in seiner ersten Ursache präexistiert, und deshalb ist der göttliche Verstand nicht in der Potenz, sondern ist reiner Akt (lautere Wirklichkeit). — Kein erschaffener Verstand aber kann sich gegenüber dem ganzen universalen Sein als Akt verhalten, weil er so ein unendliches Seiendes (Wesen) sein müsste, und daher ist jeder geschaffene Verstand, durch eben das, was er ist (Vermögen, das Seiende in sich aufzunehmen), nicht Akt alles Intelligibeln, sondern er verhält sich zu dem Intelligibeln selbst, wie die Potenz zum Akt.
Die Potenz hat aber ein zweifaches Verhältnis zum Akt. Es gibt eine Potenz, die immer durch den Akt vollendet ist, wie wir es (qu. 58, art. 1) von der Materie der Himmelskörper gesagt haben. 7 Aber eine Potenz gibt es, die nicht immer aktuell ist, sondern von der Potenz zum Akt fortschreitet, wie sie sich in den Dingen findet, die entstehen und vergehen. — Der Verstand des Engels nun ist gegenüber seinen intelligibeln Objekten immer aktuell, wegen seiner nahen Verwandtschaft mit dem ersten Verstände, der reiner Akt ist, wie eben gesagt wurde. Der menschliche Verstand aber, der in der Ordnung der Intellekte zu unterst steht und am weitesten von der 'Vollkommenheit des göttlichen Verstandes entfernt ist, ist in der Potenz zum Intelligibeln, und er ist im Anfang „wie eine leere Tafel (tabula rasa), auf der nichts geschrieben ist", wie der Philosoph 3 de Anima (4. 429 b 31— 430a 2) sagt. Und das geht klar daraus hervor, dass wir im Anfang nur potenziell denkend sind, hernach aber aktuell denkend werden. — So erhellt denn, dass unser Denken ein Leiden ist, nach der dritten Weise des Leidens; und mithin ist der Verstand ein passives Vermögen. Summa Theol. p. 1, qu. 79, art. 2, in corpore artic; vgl. 3 Sent. dist. 14, art. I, qu 1 2; de Verit. qu. 16, art. 1 ad 13; 3 de Anima, lect 7, 9.
(Mit der Frage aber, ob man eben deshalb noch einen wirkenden Verstand annehmen muss) wird es so angegangen.
1. Es scheint, dass man keinen wirkenden Verstand anzunehmen hat. Denn wie der Sinn sich zum Sinnlichen verhält, so verhält sich der Intellekt zum Intelligibeln. Man nimmt aber nicht, weil sich der Sinn in der Potenz zum Sinnlichen befindet, einen wirklichen Sinn an, sondern nur den leidenden Sinn. Also scheint, weil unser Intellekt in der Potenz zum Intelligibeln ist, kein wirkender Verstand gesetzt werden zu müssen, sondern nur der mögliche.
2. Außerdem, wenn man sagt, dass auch bei dem Sinne ein Wirkendes ist, wie z. B. das Licht, so spricht dagegen: das Licht wird für das Gesicht erfordert, insofern es das Medium aktuell hell macht: denn die Farbe ist für sich selbst das bewegende Prinzip des Hellen. Aber bei der Verstandestätigkeit wird kein Medium gesetzt, das aktuell werden müsste. Also braucht man keinen wirkenden Verstand anzunehmen.
3. Außerdem, das Bild des Wirkenden wird in dem Leidenden nach der Weise des Leidenden aufgenommen. Nun ist aber der mögliche Verstand ein unstoffliches Vermögen. Also genügt seine Unstofflichkeit, damit die Formen unstofflich in ihm aufgenommen werden. Nun ist aber eine Form schon dadurch aktuell intelligibel, dass sie unstofflich ist. Also liegt keine Notwendigkeit vor, einen wirkenden Verstand zu setzen, damit er die Bilder aktuell intelligibel mache.
Aber dagegen spricht, dass der Philosoph 3 de Anima (5. 430 a 10 ff.) sagt, dass „wie in jeder Natur (in jedem Wesen, das von der Möglichkeit zur Wirklichkeit oder von dem Können zum Tun schreitet), so auch in der Seele etwas ist, wodurch sie alles (sich ihm intentional nachbildend) werden, und etwas, wodurch sie alles machen muss." 8 Also muss man einen wirkenden Verstand annehmen.
Ich antworte, man müsse sagen, dass der Meinung Platos zufolge keine Notwendigkeit bestand, einen wirkenden Verstand anzunehmen, damit er. aktuell Intelligibles herstellte, sondern etwa, damit er dem Denkenden ein intelligibles Licht verliehe, wie unten (art 4; qu. 84, art. 6) erklärt werden soll. Denn Plato ließ die Formen der Naturdinge ohne Materie für sich bestehen und mithin intelligibel sein, weil etwas dadurch intelligibel ist, dass es immateriell ist, und er nannte derlei Formen Bilder oder Ideen, und kraft der Teilnahme an ihnen ließ er auch einerseits die körperliche Materie geformt werden, damit die Individuen auf naturgemäße Weise unter ihre eigentümlichen Gattungen und Arten gestellt, und andererseits ebenso unsere Intellekte, damit sie zur Wissenschaft von den Gattungen und Arten geführt würden. 9
Weil aber Aristoteles (vgl. Metaphys. 3, Kap. 4 Anf.) die Formen der Naturdinge nicht ohne den Stoff bestehen ließ, die stofflichen Formen aber nicht aktuell intelligibel sind, so musste folgen, dass die Naturen oder Formen der sinnlichen von uns gedachten Dinge nicht aktuell intelligibel sein konnten. Nun wird aber nichts von der Potenz in den Akt überführt außer durch ein Aktuelles, wie der Sinn aktuell wird durch ein aktuell Wahrnehmbares. Man muss folglich auf Seiten des Intellektes ein Vermögen annehmen, dass aktuell Intelligibles herstellt durch Abstraktion der Spezies von den materiellen Zutaten, und darauf beruht die Notwendigkeit, den intellectus agens anzunehmen.
Auf das Erste ist also zu sagen, dass sich das Sinnliche außer der Seele aktuell findet und aus diesem Grunde kein sensus agens angenommen zu werden brauchte. Und so erhellt, dass im ernährenden Teil alle Vermögen aktiv, im sensitiven Teil alle passiv sind, und im intellektiven Teil etwas aktiv und etwas passiv ist.
Auf das Zweite ist zu sagen, dass über die Wirkung des Lichtes eine doppelte Meinung besteht. Einige behaupten, dass das Licht zum Gesicht erfordert wird, um die Farben aktuell sichtbar zu machen, und ihnen zufolge wird der intellectus agens ebenso und aus demselben Grunde zum Denken erfordert, weshalb das Licht zum Sehen nötig ist. Nach anderen gehört das Licht zum Sehen nicht wegen der Farben, damit sie aktuell sichtbar werden, sondern damit das Medium aktuell hell wird, wie der Kommentator (Averroes) in II de Anima (Comm. 67) sagt. Und darnach wäre die Ähnlichkeit, wegen deren Aristoteles den wirkenden Verstand mit dem Lichte vergleicht, dahin zu verstehen, dass wie dieses zum Sehen, so in derselben Weise dieser zum Denken notwendig ist, aber nicht aus demselben Grunde. 10
Auf das Dritte ist zu sagen, dass unter Voraussetzung eines Agens ein Bild von ihm ganz wohl in verschiedene Subjekte wegen ihrer verschiedenen Disposition verschieden aufgenommen werden kann. Wenn aber kein Agens da ist, so wird die Disposition des aufnehmenden Subjekts dafür nichts ausmachen. Das aktuell Intelligible ist aber nichts in Wirklichkeit Bestehendes, soweit es sich um die sinnlichen Dinge fragt, die nicht außer dem Stoffe da sind. Und deshalb würde die Immaterialität des möglichen Verstandes nicht zum Denken genügen, wenn kein wirkender Verstand wäre, der Objekte herstellte, die nach Weise der Abstraktion aktuell intelligibel sind. 11 Sum. Theol. p. 1, qu. 79, art. 3. Vgl. ebenda 54, 4; De Spiritual. Creatur., art. 9; Compend. Theol., 83; Quast, disp. de Anima I, 4; 3 de Anima, lect. 10; in lib. Boethii de Trinit. I, I.
1. Der wirkende Verstand scheint kein Vermögen der Seele (aliquid animae) zu sein. Denn die Leistung des wirkenden Verstandes besteht darin, dass er (die Seele) zum Zwecke des Denkens erleuchtet. Das geschieht aber durch etwas, was höher als die Seele ist, gemäß dem Worte: „Es war das wahre Licht, das erleuchtet jeden Menschen, der in diese Welt kommt," Joh. 1, 9. Es scheint also der wirkende Verstand kein Vermögen der Seele zu sein.
2. Außerdem, der Philosoph legt 3 de Anima (5. 430 a 22) dem intellectus agens die Eigentümlichkeit bei, dass er nicht bald denkt, bald nicht denkt. Unsere Seele denkt aber nicht immer, sondern sie denkt bald, und denkt bald nicht Also ist der wirkende Verstand kein Vermögen unserer Seele.
3. Außerdem, das Wirkende und das Leidende genügen zum Wirken. Wenn also der mögliche Verstand, der ein passives Vermögen ist, etwas als Teil zu unserer Seele Gehöriges ist, und desgleichen der wirkende Verstand, der ein aktives Vermögen ist, so folgt, dass der Mensch immer, wenn er will, wird denken können, was offenbar falsch ist. Also ist der wirkende Verstand nichts zu unserer Seele Gehöriges. m
4. Außerdem, der Philosoph sagt 3 de Anima (5. 30 a 18), dass „der intellectus agens wesenhaft aktuell seiend ist". Es ist aber nichts in Bezug auf dasselbe aktuell und potenziell. Wenn also der intellectus possibilis, der allem Intelligibeln als passive Möglichkeit gegenübersteht, etwas zu unserer Seele Gehöriges ist, so erscheint es als unmöglich, dass der intellectus agens etwas zu unserer Seele Gehöriges ist.
5. Außerdem, wenn der intellectus agens etwas zu unserer Seele Gehöriges ist, so muss er irgendein Vermögen sein; denn er ist weder ein Leiden (passio), noch ein Habitus. Denn der Habitus und das Leiden steht den Erleidungen (passiones) der Seele nicht als Tätiges gegenüber: das Leiden ist vielmehr selbst die Tätigkeit des passiven Vermögens, der Habitus aber ist etwas, was sich als Folge aus den Tätigkeiten einstellt. Jedes Vermögen fließt aber aus der Wesenheit der Seele. Es würde also folgen, dass der wirkende Verstand von der Wesenheit der Seele ausginge, und so fände er sich in der Seele nicht vermöge einer Teilnahme an irgendeinem höheren Verstände, was ungereimt ist. Also ist der wirkende Verstand nichts, was unserer Seele als Teil oder Vermögen angehört.
Aber dem ist entgegen, dass der Philosoph 3 de Anima (5. 430 a 13 f.) sagt, dass „diese Unterschiede in der Seele sein müssen", nämlich der mögliche und der wirkliche Verstand.
Ich antworte, man müsse sagen, dass der wirkende Verstand, von dem der Philosoph redet, ein Teil der Seele ist.
Zum klaren Verständnis dieser Aufstellung ist zu beachten, dass man über der verständigen menschlichen Seele einen höheren Verstand annehmen muss, damit die Seele von ihm das Vermögen zu denken empfängt Denn immer fordert das, was an etwas teilnimmt, und was der Bewegung unterliegt, und was unvollkommen ist, als sich vorausgehend etwas, was durch seine Wesenheit das Betreffende ist, und was unbewegt und vollkommen ist. Die menschliche Seele heißt aber verständig durch Teilnahme an dem Verstandesvermögen. Ein Zeichen dessen ist die Tatsache, dass sie nicht nach ihrer Totalität intellektiv ist, sondern nur nach einem Teile oder Vermögen von sich. Sie gelangt auch zur Einsicht in die Wahrheit, indem sie mit einer Art fortschreitender Bewegung (cum quodam discursu et motu) ihre Folgerungen zieht. Sie hat auch eine unvollkommene Einsicht, einmal darum, weil sie nicht alles versteht, und dann, weil sie bei dem, was sie versteht, von der Potenz zum Akte (vom Vermögen zur Tätigkeit) fortschreitet. Es muss also einen höheren Verstand geben, der der Seele zum Denken und Verstehen verhilft.
Es haben also einige (S. Avicenna de Anima, part. 5, cap. 5; Averroes 3 de Anima, comment. 18) behauptet, dieser der Wesenheit nach getrennte Verstand sei der intellectus agens, der die Phantasiebilder, sie gleichsam belichtend, aktuell intelligibel macht. — Aber zugegeben, dass ein solcher getrennter intellectus agens wäre, so müsste man doch nichtsdestoweniger in der Seele selbst ein von jenem höheren Intellekt durch Teilnahme empfangenes Vermögen setzen, durch das die Seele aktuell Intelligibles herstellt. So gibt es ja auch bei den anderen natürlichen Dingen, soweit sie vollkommen sind, außer den allgemeinen wirkenden Ursachen, noch besondere, von den allgemeinen Agentien abgeleitete Kräfte, die den einzelnen vollkommenen Naturdingen verliehen sind; denn die Sonne erzeugt den Menschen nicht allein, sondern es ist in dem Menschen eine Kraft zur Erzeugung des Menschen, und ebenso in den anderen vollkommenen Sinnenwesen. Unter den niederen (dem sublunarischen Bereich angehörigen) Dingen ist aber nichts vollkommener als die menschliche Seele. Man muss daher sagen, dass in ihr selbst eine von dem höheren Intellekt abgeleitete Kraft ist, durch die sie die Phantasmen belichten könne.
Und das erkennen wir durch die Erfahrung, indem wir wahrnehmen, dass wir die allgemeinen Formen von den partikulären Zutaten abstrahieren, was soviel ist als aktuell Intelligibles herstellen. Nun kommt aber keine Tätigkeit einem Dinge anders als durch ein ihm formell inhärierendes Prinzip zu, wie oben erklärt wurde (76, 1), als vom intellectus possibilis die Rede war. Also muss das Vermögen, das der Grund dieser Tätigkeit ist, etwas in der Seele sein. — Und deshalb hat Aristoteles 3 de Anima (430 a 15) den intellectus agens mit dem Lichte verglichen, das etwas in die Luft Aufgenommenes ist. Plato aber hat den getrennten, auf unsere Seelen einwirkenden Verstand mit der Sonne verglichen, wie Themistius sagt (in der Paraphrase zu de Anima 3, fol. 90 nach Spengel, bei Plato Staat, B. 6, pag. 508).
Aber der getrennte Verstand ist nach den Weistümern unseres Glaubens (worüber vgl. de Spirit. Creat. art. 10) Gott selbst, der der Schöpfer der Seele ist, und in dem allein sie selig wird, wie unten (90, 3; I a II ae , 3, 7) klargestellt wird. Daher dankt die Seele ihm die Teilnahme an dem intellektuellen Lichte, gemäß dem Psalmenwort 4, 7: „Gezeichnet ist über uns das Licht deines Antlitzes, o Herr."
Auf das Erste ist also zu sagen, dass jenes wahre Licht wie die allgemeine Ursache erleuchtet, dank deren die menschliche Seele an einem bestimmten partikulären Vermögen teilhat, wie erklärt worden.
Auf das Zweite ist zu sagen, dass der Philosoph jene Worte nicht von dem intellectus agens spricht, sondern von dem Intellekt in Wirklichkeit (der also gerade tatsächlich denkt). Daher hatte er oben (Zeile 19 f.) bezüglich seiner die Bemerkung vorausgehen lassen: „Das aktuelle Wissen ist ein Ding mit dem Objekt." Oder wenn es von dem intellectus agens gemeint sein sollte (wahrscheinlich ist es gemeint von dem göttlichen Verstände, dem ewig unveränderlichen und aktuellen, dem die Seele den Besitz des intellectus agens verdankt), so heißt es so, weil es nicht von dem intellectus agens herrührt, dass wir bald denken und bald nicht denken, sondern von dem Verstände, der potentiell ist (dem intellectus possibilis).
Auf das Dritte ist zu sagen, dass wenn der intellectus agens sich zu dem intellectus possibilis wie das wirkende Objekt zur Potenz verhielte, ähnlich wie das aktuell Sichtbare zum Gesicht, folgen würde, dass wir alles sogleich verständen, da der intellectus agens es ist, wodurch man alles machen kann. Nun aber verhält er sich nicht wie das Objekt, sondern wie das, was die Objekte aktuell macht, wozu außer der Gegenwart des intellectus agens die Gegenwart von Phantasmen, ein guter Stand der sinnlichen Vermögen und Übung in dieser Verrichtung gehört, weil durch eines, was man verstanden hat, auch anderes verstanden wird, wie die Sätze durch die Termini (Begriffe) und die Folgerungen durch die ersten Prinzipien. Und in Bezug hierauf macht es keinen Unterschied, ob der intellectus agens etwas zur Seele Gehöriges oder etwas Getrenntes ist.
Auf das Vierte ist zu sagen, dass die Denkseele zwar aktuell unstofflich, aber in der Potenz zu bestimmten Formen (species) der Dinge ist. Die Phantasmen aber sind umgekehrt zwar Abbilder (similitudines) gewisser Formen, aber potenziell unstofflich. Daher hindert nichts, dass eine und dieselbe Seele, sofern sie aktuell unstofflich ist, ein Vermögen hat, durch das sie aktuell Unstoffliches macht, durch Abstraktion von den Zutaten des individuellen Stoffes, ein Vermögen, das eben intellectus agens heißt, und ein anderes Vermögen, diese Formen aufzunehmen, das intellectus possibilis heißt, sofern es in der Potenz (passiven Möglichkeit) zu diesen Formen ist.
Auf das Fünfte ist zu sagen, dass, da die Wesenheit der Seele unstofflich ist, als Schöpfung des höchsten Verstandes, nichts hindert, dass ein Vermögen, das sie dem höchsten Verstände durch Teilnahme dankt, durch das sie vom Stoff abstrahiert, von ihrer Wesenheit ausgeht, wie auch ihre anderen Vermögen. Sum. Theol. i, 79, 4; 2 Sent. 17, 2, 1; 2 Cont. Gent. 76, 78; De Spirit. Creat. 10; Qu. de Anima, art. 5; Compend. Theol. 86; 3 de Anima, lect. 10.
Die Denkseele hat etwas Aktuelles, zu dem das Phantasma sich potenziell verhält, und sie verhält sich wieder potenziell zu etwas, was in den Phantasmen aktuell ist. Die Substanz der menschlichen Seele hat nämlich die Unstofflichkeit und auf Grund derselben die intellektuelle Natur zu eigen, da eben dies das unterscheidende Merkmal jeder unstofflichen Substanz ist. Damit kommt es ihr aber noch nicht zu, diesem oder jenem Ding in concreto verähnlicht zu sein, was sein muss, damit die Seele dieses oder jenes Ding in concreto erkennt. Denn jede Erkenntnis geschieht durch eine Verähnlichung des Erkennenden mit dem Erkannten. Daher bleibt die Denkseele den konkreten Bildern der uns erkennbaren Dinge gegenüber, und dieses uns Erkennbare sind die Naturen der sinnenfälligen Dinge — in der bloßen Potenz. Diese konkreten Naturen der sinnenfälligen Dinge nun (eigentlich nicht ihre Naturen, sondern die Dinge nach ihrer äußeren Erscheinung in der Wahrnehmung) stellen uns die Phantasmen vor, die jedoch noch nicht zum intelligiblen Sein gelangt sind, da sie die Sinnendinge auch nach ihren stofflichen Eigenschaften und individuellen Merkmalen darstellen und auch in leiblichen Organen ihren Sitz haben. Sie sind mithin nicht aktuell intelligibel, und doch sind sie es potenziell, weil sich in diesem Menschen, dessen Bild die Phantasmen wiedergeben, die allgemeine Natur entblößt von allen individuellen Eigentümlichkeiten in Betracht nehmen lässt. So haben sie denn die Intelligibilität der Potenz nach, die Bestimmtheit aber, mit der sie die Dinge darstellen, der Wirklichkeit nach. Umgekehrt war es dagegen in der Denkseele. Und so findet sich denn in ihr eine auf die Phantasmen wirkende Kraft, die sie aktuell intelligibel macht, und dieses Vermögen heißt der wirkende Verstand. Und es findet sich in ihr auch eine Kraft, die in der Potenz zu den bestimmten Abbildern (similitudines) der sinnlichen Dinge ist, und das ist das Vermögen des möglichen Verstandes. 2 Cont. Gent. 77.
Als aktuell intelligibel (unmittelbar denkbar) nimmt der intellectus possibilis die Formen in Kraft des intellectus agens auf, dagegen als Abbilder bestimmter Dinge auf Grund der Erkenntnis der Phantasmen. Ouaest disput de Verit. 10, 6, ad 7). 12