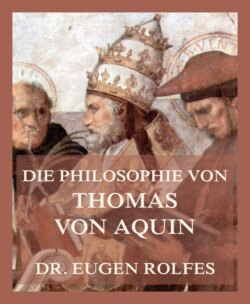Читать книгу Die Philosophie von Thomas von Aquin - Dr. Eugen Rolfes - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung.
ОглавлениеIn der Philosophischen Bibliothek als einer Sammlung der philosophischen Hauptwerke alter und neuer Zeit darf Thomas von Aquin nicht ganz fehlen. Thomas gilt als der größte Denker des christlichen Mittelalters. Er ist überdies der beste Erklärer des Aristoteles und hat seine eigene Spekulation auf die des Stagiriten gegründet. In den letzten Jahren ist noch ein besonderer Umstand eingetreten, der ihm auch in nichtkatholischen Kreisen eine erhöhte Beachtung sichern dürfte: der Weltkrieg hat die Konfessionen in nähere Berührung gebracht und das Bedürfnis nach einer genaueren Bekanntschaft mit der katholischen Kultur geweckt. Thomas muss aber als einer der vornehmsten Vertreter dieser Kultur angesehen werden.
Die autoritative Stellung, die seine philosophische Doktrin gegenwärtig in der katholischen Kirche behauptet, erkennt man am besten aus den amtlichen Kundgebungen der obersten kirchlichen Behörde.
Papst Leo XIII. hat vor nunmehr 40 Jahren, 1879 unterm 4. August, dem Festtage des hl. Dominikus, Stifters des Predigerordens, welchem Thomas von Aquin als Mitglied angehörte, das Rundschreiben Aeterni Patris erlassen, in dem er den Aquinaten mit hohem Lobe erhebt und seine Philosophie neuerdings den katholischen Schulen als Muster vorhält und als Richtschnur vorschreibt.
Es heißt dort über ihn:
„Ausgerüstet mit einem gelehrigen und scharfsinnigen Geiste, einem leicht fassenden und treuen Gedächtnisse, von höchst reinen Sitten, einzig die Wahrheit liebend, an göttlicher und menschlicher Wissenschaft überreich, hat er der Sonne gleich den Erdkreis durch die Glut seiner Tugenden erwärmt und mit dem Glanz seiner Lehre erfüllt Es gibt kein Gebiet der Philosophie, das er nicht ebenso scharfsinnig als gründlich behandelt hätte: seine Untersuchungen über die Gesetze des Denkens, über Gott und die unkörperlichen Substanzen, über den Menschen und die anderen sinnlichen Geschöpfe, über die menschlichen Handlungen und ihre Prinzipien sind derart, dass in ihnen sowohl eine Fülle von Stoff vorliegt, als passende Anordnung der Teile angetroffen wird, die zweckmäßigste Methode, Sicherheit der Grundsätze und Kraft der Beweise, Klarheit und Genauigkeit im Ausdrucke, wie nicht minder eine große Leichtigkeit, auch das Dunkelste aufzuhellen."
Die praktischen Weisungen des päpstlichen Dokuments für die Bischöfe sind in folgenden Sätzen enthalten: „Wir ermahnen euch alle auf das Nachdrücklichste, zum Schutze und zur Ehre des katholischen Glaubens, zum Besten der Gesellschaft und zum Wachstum aller Wissenschaften die goldene Weisheit des hl. Thomas wieder einzuführen und so weit als möglich zu verbreiten. Mögen die Lehrer, die ihr mit Umsicht auswählen werdet, sich bestreben, die Doktrin des Aquinaten dem Geiste ihrer Schüler einzupflanzen und ihre Gediegenheit und ihre Vorzüge vor anderen Lehrmeinungen ins Licht zu stellen. Eben diese Doktrin mögen die Akademien, die ihr errichtet habt oder noch errichten werdet, erläutern und verteidigen, und zur Widerlegung der grassierenden Irrtümer benutzen."
Diese Anordnungen seines Vorgängers sind von Pius X. in der Enzyklika Sacrorum antistitum vom 1. September 1910 und in dem Motu proprio für Italien und die anliegenden Inseln vom 29. Juni 1914 neuerdings eingeschärft und genauer bestimmt worden. In dem genannten Motu proprio ist besonders folgender Satz hervorzuheben: „Wir erklären, dass man nicht nur Thomas nicht folgt, sondern sich auch weit von dem heiligen Lehrer verirrt, wenn man die Prinzipien und Hauptsätze in seiner Philosophie (quae in ipsius philosophia principia et pronuntiata maiora sunt) verkehrt deutet oder gar über sie hinwegsieht.
Im Hinblick auf diese Erklärung hat darauf die damals bestehende römische Kongregation der Studien vierundzwanzig aus Thomas ausgehobene Thesen als principia und maiora pronuntiata seiner Philosophie bezeichnet und mit päpstlicher Zustimmung unterm 27. Juli 1914 veröffentlicht.
Endlich hat mit Gutheißung Benedikts XV. die neuerrichtete Kongregation der Seminare und Universitäten unterm 7. März 1916 erklärt, dass „alle diese vierundzwanzig philosophischen Thesen die echte Lehre des hl. Thomas zum Ausdruck bringen und als sichere direktive Normen vorgestellt werden".
Hiernach kann kein Zweifel sein über die unvergleichliche Wertschätzung, die die Philosophie des Aquinaten in der katholischen Kirche genießt.
In der Geschichte des menschlichen Gedankens ist der Philosoph von Aquino der einzige, der mit solchem Ernste und Erfolge an der Aufgabe gearbeitet hat, die Übereinstimmung der Offenbarung und des Glaubens mit der Vernunft zu beweisen.
Schon der hl. Augustinus hatte sein Genie in den Dienst dieses Zieles gestellt. Ihm war Plato der Vertreter der griechischen Forschung, an die er den Maßstab des Dogmas legte, um teils ihre Irrtümer nachzuweisen, teils ihre Errungenschaften für die Verteidigung und Erklärung der Glaubenslehren zu benutzen. Aber Augustin war weniger systematisch und schulgerecht zu Werke gegangen als Thomas, und Plato hatte seiner Philosophie nicht die nüchterne, von der wissenschaftlichen Mitteilung geforderte Form gegeben wie Aristoteles, der für Thomas die griechische Weisheit vertrat.
Thomas hat sich überdies auf das eingehendste mit den Schriften seines Gewährsmannes beschäftigt, wie die stattlichen Folianten seiner klassischen Kommentare beweisen, und seine selbständigen Arbeiten sind von Verweisungen auf den Philosophen überall durchsetzt, während Augustin eine solche Arbeit an Plato nicht geleistet hat und seine Weise, auf ihn Bezug zu nehmen, selbst dem freilich falschen, aber tatsächlich geäußerten Argwohn Raum ließ, als habe er Plato, mit Ausnahme des Timaios vielleicht, gar nicht gelesen und ihn nur aus den Neuplatonikern gekannt.
Thomas hat auch vor Augustin voraus, dass zu seiner Zeit das kirchliche Dogma eine bestimmtere Fassung angenommen hatte. Und in den Werken des Kirchenvaters selbst fand er als Vorlage für sein Unternehmen eine wissenschaftliche Behandlung der Glaubenslehre, die er nur weiterzuführen brauchte.
Was sein Verhältnis zu Aristoteles angeht, so hat man wohl gesagt, er habe den griechischen Philosophen, dessen wahrer Meinung zuwider, christlich gedeutet. Ich kann diese Auffassung nicht teilen. Die bestimmten Aussprüche des Philosophen und der Zusammenhang seiner Lehre zeigen, dass der Kirchenlehrer ihn richtig verstanden hat. Thomas wollte auch, das zeigt die Weise, wie er spricht, seine günstige Deutung des Aristoteles nicht so aufgefasst wissen, als wäre sie ihm nur von einer gewissen Pietät eingegeben, oder als gäbe er nur an, was man aus den Sätzen des Aristoteles ableiten könne, ohne dass dieser selbst es gesehen habe. Das schließt freilich nicht aus, dass er hin und wieder in den aristotelischen Begriffen und Sätzen Gedanken und Erkenntnisse findet, die mit solcher Klarheit, wie er selbst sie vorträgt, vielleicht nicht vor dem Geiste des Griechen gestanden haben, aber ich denke, das geschieht doch immer in einer Weise, dass man bei einigem Takte das richtige Verhältnis herausfühlt.
Dagegen dürfte wohl nicht zu bestreiten sein, dass Thomas ab und zu der Autorität des Aristoteles zu viel eingeräumt hat. Das scheint mir namentlich, wie aus meinen Anmerkungen zu erkennen ist, in der Frage von der Möglichkeit einer ewigen, bewegten Welt der Fall zu sein. Mit dem Fortschritt seiner Forschung wird er hier allerdings zurückhaltender. Wenn wir behaupten, dass man für eine anfangslose Reihe nicht ohne Widerspruch ein erstes Prinzip fordert, so erkennen wir doch an, dass die Notwendigkeit eines solchen auch für eine noch so lange Reihe besteht. Nur sagen wir, dass eben diese Notwendigkeit eines Prinzips die Unendlichkeit der Reihe ausschließt. Ich hoffe nicht, dass auch die strengsten Anhänger des hl. Thomas mich deshalb tadeln werden. Sollte ich irren, so würde ich mich gern eines Besseren belehren lassen. Übrigens habe ich diese Meinung bereits vor Jahren vertreten; vgl. Philosophisches Jahrbuch, Fulda 1897, S. iff.
Die vorliegende Auswahl von Stücken aus Thomas soll die Grundzüge seiner Lehre vor Augen führen. Wir mussten eine solche Auslese vornehmen, weil es von Thomas selbst keine Gesamtdarstellung der Philosophie gibt. Die Summa contra Gentiles wird zwar oft als Summa philosophica bezeichnet, was gedrängte Darstellung der Philosophie bedeutet, aber sie ist in Wirklichkeit eine spekulative Apologie der katholischen Dogmen mit Einschluss der Mysterien. In den Handschriften und bei den alten Skripturen, die die Schriften des hl. Thomas angeben oder von ihnen reden, findet man den Titel Summa philosophica nie. Der wahre Titel scheint zu sein : Liber oder Summa de veritate catholicae fidei contra Gentiles.
Die Angabe der Parallelstellen zu den ausgewählten Stücken, der man in unserer Arbeit begegnet, erhebt auf Vollständigkeit keinerlei Anspruch, ausgenommen, wo die Parallelen der Leonina entnommen sind.
In der Darstellung, die durch die ausgehobenen Stücke gewonnen wird, ist zwar eine gewisse Vollständigkeit angestrebt, jedoch nicht so, dass ausnahmslos alle Sätze, die amtlich als Hauptsätze der thomistischen Lehre bezeichnet worden sind, berücksichtigt würden. So bleiben zum Beispiel die These 6 über die Relation, die These 10 über die Quantität, die These 11 über das Individuationsprinzip und die These 12 über die absolute Unmöglichkeit einer Bilokation von körperlich ausgedehnten Dingen als solchen ohne Beleg. Der Grund ist, weil diese Fragen für eine erste Einführung in die thomistische Gedankenwelt vielleicht zu schwierig sind, und dann, weil sie unbeschadet des eigentlichen Kerns der thomistischen Lehre, soweit sie uns hier angeht, umgangen werden können. Andererseits sind um der sachlichen Wichtigkeit willen die erkenntnistheoretischen und theologischen Fragen bevorzugt worden.
Die Erkenntnistheorie wird als eigener Teil behandelt, obwohl sie bei Thomas nach aristotelischem Vorbild meistens in psychologischen und metaphysischen Zusammenhängen auftritt. Das geschieht von uns darum, weil die Frage von der Wahrheit und Zuverlässigkeit unserer Erkenntnis, seitdem Kant sie aufgeworfen und verneint hat, auch heute noch im Vordergrunde des philosophischen Interesses steht.
Über den zweiten Teil der theoretischen Philosophie, die Mathematik, bringen wir keine eigenen Stücke. Von Aristoteles, dem Gewährsmann des Aquinaten, besitzen wir über Philosophie der Mathematik keine eigene Schrift, man müsste denn das 13. und 14. Buch der Metaphysik, das von den Ideen und Zahlen handelt, als solche ansehen. Anderes, was hierher gehört, wie die Lehre von der Quantität, dem Unendlichen, der Zahl der himmlischen Sphären, war teils für unseren Zweck entbehrlich, teils ist es bei der Frage von der Möglichkeit einer ewigen Welt berührt worden. Im Übrigen könnte man die Einheit, Vielheit und Unendlichkeit ebenso gut zur Metaphysik ziehen, da sie sich auch am Unstofflichen finden.
Die Fragen von der Geistigkeit, dem Ursprung und der Unsterblichkeit der Seele und von der Willensfreiheit sind in die Naturlehre verwiesen worden, weil diese von Stoff und Form handelt und die Seele die Form des Leibes ist. Das ist ja auch die Systematik, die uns bei Aristoteles begegnet. Nur die Willensfreiheit behandelt er nicht in der Physik, abgesehen etwa von de anima 3,7. 10. und 11. Kap., sondern in der Ethik. Insofern die Freiheit aber unmittelbar aus der Vernünftigkeit entspringt, hat sie mit der Lehre von der Geistigkeit den Platz zu teilen. Aristoteles erörtert die Freiwilligkeit des Handelns in der Ethik unter dem praktischen Gesichtspunkte. — Der Artikel über die Freiheit als Eigenschaft des Strebevermögens, nicht der Erkenntnis oder des Urteils, aus der Summa Theologica 1, 83, 3 fand darum Aufnahme, weil diese Bestimmung, und mit ihr offensichtlich die Freiheit selbst, auch jetzt noch viel bestritten wird, namentlich soweit sie Aristoteles angehören soll.
Als Vorlage dieser Übersetzung musste zum Teil die Ausgabe von Vives, Paris 1871 — 80, dienen, die freilich manches zu wünschen übrig lässt. Die schöne römische, noch unvollendete Ausgabe in Großfolio, mit der auf Anordnung Leos XIII. begonnen wurde, hatten wir nicht beständig zur Hand. Diese Ausgabe, die sog. Leonina, hat uns auch gute Dienste geleistet, wenn wir Bedenken wegen des Vivesschen Textes hatten oder bei der Nachweisung von Zitaten uns im Stiche gelassen sahen. Sie gibt die Stellen aus Aristoteles nicht nach ihrem Ort in der Berliner, Bekkerschen Ausgabe, an, wie es in dieser Arbeit geschieht, sondern nach der Pariser Ausgabe aus dem Verlag von Didot, Typographen des Französischen Instituts, deren 4. Band im Jahre 1888 von Bussemaker besorgt wurde. Auch die Stellen der Platozitate werden in der Leonina nach der Ausgabe im Verlag Didot angegeben.
Bei den Verweisungen auf Thomas selbst kann Unklarheit entstehen, insofern die Lektionen in den Aristoteleskommentaren nicht in allen Ausgaben übereinstimmend eingeteilt sind. Diesem Übelstand wurde durch die genaue Angabe des Ortes der aristotelischen Stellen, die kommentiert werden, abgeholfen. Man findet so die betreffenden Lektionen aus den kommentierten, ihnen beigedruckten Texten. Auch die Opuskula sind in den verschiedenen Ausgaben verschieden nummeriert, weshalb in der Regel die andere Nummer in Klammern beigesetzt wurde.
Köln-Lindenthal, den 8. Oktober 1919.
Rolfes.