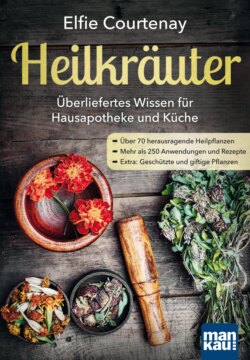Читать книгу Heilkräuter - Überliefertes Wissen für Hausapotheke und Küche - Elfie Courtenay - Страница 19
ОглавлениеBeifuß
Artemisia vulgaris, Korbblütengewächse
Verwendete Pflanzenteile Die oberen, unverholzten Triebspitzen des Krautes
Sammelzeit Zur Blütezeit von Juni bis September
Wichtige Inhaltsstoffe Bitterstoffe und ätherisches Öl
Wichtige Wirkungen Regt die Magensäfte an, unterstützt Leber, Galle und Fettverdauung, wirkt antibakteriell, fungizid, menstruationsauslösend und geburtseinleitend
Gegenanzeigen Schwangerschaft
Volkstümliche Namen Jungfern- oder Weiberkraut, Gänsekraut, Wilder Wermut
Beifußpflanzen werden bis eineinhalb Meter hoch, wachsen in Gärten, an trockenen Gräben, Wegrändern, Zäunen, an Böschungen und auf Brachland. Die Stängel sind oft rispig verästelt, im unteren Bereich verholzt und bräunlich oder rötlich gefärbt. Die Blätter sind fiederteilig lanzettlich und spitz zulaufend, auf der Oberseite sind sie grau- bis dunkelgrün und kahl, auf der Unterseite weißfilzig behaart. Am oberen Ende des Stängels sind die Blätter meist nur einfach oder dreilappig. Die kleinen gelblichen oder rötlichen Einzelblüten stehen in ährenartiger Anordnung.
Verwendungsmöglichkeiten
In der Volksmedizin wurde Beifuß eingesetzt, um Leber und Galle zu aktivieren und die Verdauung anzuregen. Ein typischer Verwendungszweck war früher die Weihnachtsgans. Sie wurde mit reichlich Beifußkraut gewürzt, die aromatische Bitterkeit hat den Appetit angeregt, die Bildung der Verdauungssäfte gefördert und so schwere Speisen bekömmlicher gemacht. Neben der Verwendung in Würzmischungen wurde Beifuß auch gern im Tee oder Wein eingenommen.
Beifußtee
1 gehäufter Teelöffel geschnittenes Beifußkraut mit 1/4 Liter kochendem Wasser überbrühen, nur 2 bis 3 Minuten abgedeckt ziehen lassen und abgießen.
Dosierung: 1- bis 3-mal täglich eine Tasse ungesüßt in kleinen Schlucken trinken.
Empfohlen wird der Tee bei chronischen Durchfällen, bei Mundgeruch, aber auch bei Verdauungsschwierigkeiten wegen zu schwacher Leber-bzw. Gallentätigkeit.
Beifußwein
Nebenwirkungen
Es besteht Allergiegefahr; Beifußpollen gehören zu den wichtigsten Auslösern von Heuschnupfen! Bei normaler Dosierung sind keine Nebenwirkungen zu befürchten.
20 Gramm zerkleinerten Beifußblättern etwas Minze oder Zitronenmelisse beifügen, die Mischung in 3/4 Liter Weißwein kalt ansetzen und täglich gut verschütteln. Nach 2 bis 3 Wochen abgießen.
Dosierung: 3-mal täglich 1 Likörglas nach dem Essen trinken.
Beifußöl
Setzen Sie zerkleinertes Beifußkraut mit naturreinem Olivenöl an, und schütteln Sie das Ganze täglich gut durch, damit immer alle Pflanzenteile mit Öl bedeckt sind, ansonsten besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Nach 4 Wochen durch ein Sieb in Flaschen füllen.
Dieses Öl fördert die Durchblutung, wirkt stark erwärmend und entspannend. Gut als Massageöl gegen kalte Füße, bei Verspannungen im Nacken oder Rücken sowie bei Muskelkater. Bei Verkühlung des Unterleibs oder Blasenentzündung 100 Milliliter des Öls als Zusatz ins Sitzbad geben. Gegenanzeige: Schwangerschaft!
Brauchtum
Der Name Artemisia leitet sich von Artemis ab, der griechischen Göttin der Jagd. Sie galt auch als Göttin der Fruchtbarkeit und Heilung und als Beschützerin der Frauen.
Beifußbüschel wurden früher in den Häusern aufgehängt, um Dämonen, Hexerei und Verzauberung abzuwehren.
Um sich selbst und ihr Ungeborenes zu schützen, banden sich schwangere Frauen Beifußgürtel um den Leib oder trugen Schutzamulette aus Beifußwurzel bei sich.
Auch als Räucherkraut kam dem Beifuß große Bedeutung zu. Bei den Germanen durfte er in keiner rituellen Räucherung fehlen.
Kranke wurden gründlich mit Beifußbüscheln abgefächert, um sie von den Übeln zu befreien, die sich an ihren Leib geheftet hatten. Anschließend wurden diese Büschel verbrannt.
Um Fußmärsche über weite Strecken unbeschadet zu überstehen, wurde Beifußkraut mit der weißfilzigen Seite nach oben in die Schuhe gelegt.
Beifuß vor der Blüte
Beifuß als Frauenkraut
Der würzig-bittere Beifuß galt als eines der wichtigsten Frauenkräuter. Je nach Dosierung halfen Tees oder Sitzbäder, die ausgebliebene Menstruation anzuregen, die Entbindung zu beschleunigen, die Nachgeburt oder einen toten Fötus abzutreiben. Die antibakterielle sowie durchblutungs- und wehenfördernde Eigenschaft des Beifuß war den Frauen seit Jahrhunderten bekannt und wurde in vielen Kulturen genutzt.
Während der Entbindung räucherte die Hebamme den Raum und das Lager mit Beifuß, um die Geburt zu erleichtern, die Gebärende zu beruhigen und um vor bösen Einflüssen zu schützen.
Historisches
Eduard Bauer schreibt in seinem »Heilpflanzen-Taschenbuch« von 1908:
»Tee von Beifuß dient als vorzügliches und kräftiges Heilmittel bei allgemeiner Schwäche und Schwäche der Verdauungsorgane. Er hat einen ausgesprochenen Einfluss auf die Blutverteilung und somit auch auf das Zentralnervensystem (tägl. 1 Tasse). Und gerade in den Entwicklungsjahren der Kinder übt er eine ganz besonders gute Wirkung aus.
Wegen des Bitterstoffes, den Beifuß enthält, gibt er, mit Rainfarn vermischt, ein sicher wirkendes Mittel gegen Spulwürmer. Bei Rheumatismus, Verrenkungen und Quetschungen wird die aus Beifuß gewonnene Tinktur, zur Hälfte mit Arnikatinktur (aus der Apotheke, Arnika steht streng unter Naturschutz!) vermischt, zum Einreiben benutzt.«