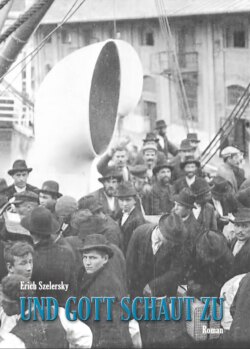Читать книгу Und Gott schaut zu - Erich Szelersky - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorgeschichte Deine Ur-Ur-Großeltern Krakau 1848
ОглавлениеIch beginne mit meinen Aufzeichnungen in Krakau. Dort hat unsere Familie einmal gelebt.
Das war in der Zeit der nationalen Bewegungen. Auch die Polen strebten nach einem geeinten Vaterland.
»Jeszcze Polska nie zgineta.«
»Noch ist Polen nicht verloren.«
Überall in den Straßen von Krakau war das von Jozef Wybicki ein paar Jahrzehnte zuvor nach der dritten polnischen Teilung komponierte patriotische Kampflied, in dem zum bewaffneten Widerstand gegen die Besatzungsmächte aufgerufen wird, zu hören. Polnische Nationalisten zogen fahnenschwenkend durch die Straßen und forderten die Wiederherstellung des polnischen Nationalstaates.
Die alte polnische Königsstadt Krakau war ein Hexenkessel. In dieser Zeit, etwa zwischen 1830 und 1850, lebte hier unsere Familie, Dein Ur-Urgroßvater Gregor Slapszi, seine Frau Maria, seine Tochter Martha und Gustav, Dein Urgroßvater.
Ich weiß nicht, ob und wie lange wir schon vorher in Krakau ansässig waren, das ließ sich nicht mehr feststellen, aber sicher belegt ist, dass Dein Ur-Ur-Großvater, Gregor Szlapszi bis zu seinem Tod im Jahr 1849 als preußischer Beamter in der Verwaltung in Krakau gearbeitet hat.
Die alte polnische Königsstadt hatte damals schon eine wechselvolle Geschichte hinter sich, doch seit dem Wiener Kongress 1815 waren die Verhältnisse besonders verworren. Russland hatte ein Königreich Polen proklamiert, das weite Teile des polnischen Territoriums umfasste und zu dessen König sich der Zar selbst ernannt hatte. Österreich und Preußen konnten diesen Machtzuwachs des Zarenreiches nicht verhindern. Als es um Krakau ging waren sie jedoch unnachgiebig. Da alle drei Staaten gleichermaßen Anspruch auf die zweitälteste Universitätsstadt Mitteleuropas erhoben, kam als Kompromiss ein sehr künstliches Gebilde, die Republik Krakau zustande, die in den darauffolgenden Jahren immer wieder Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen wurde.
Krakau wurde unter das Protektorat Österreichs, Russlands und Preußens gestellt. Die Betroffenen wurden nicht gefragt. Achtundachtzigtausend Menschen lebten damals in der Stadt, fast ausschließlich Polen. Die Amtssprache war polnisch, man dachte polnisch, fühlte sich polnisch und sehnte sich nach der Wiederherstellung des polnischen Nationalstaates, den die Großmächte mit seiner Zerschlagung zwischen 1772 und 1795 vernichtet hatten.
In dieser Zeit zunehmender patriotischer Gesinnung entwickelte sich Krakau zu dem maßgeblichen Zentrum des polnischen nationalen Widerstandes.
Gregor Szlapszi war einer der Beamten in preußischen Diensten.
Die politische Lage in den 1840-er Jahren war eine hochexplosive Mischung und so war es auch nicht verwunderlich, dass es immer wieder zu Aufständen kam. Um der Revolten Herr zu werden, wurde die Polizei unter österreichische Leitung gestellt. Als das auch nichts half besetzten russische, österreichische und preußische Truppen Krakau. Die Soldaten befanden sich in einer Art Kriegszustand. Überall in der Stadt wurde patroulliert und kontrolliert, und wer sich verdächtig machte wurde verhaftet. Die Lebensverhältnisse waren sehr schwierig und sie wurden noch schwieriger.
Im Februar 1846 konnte ein Volksaufstand nur von zusätzlich herbeieilenden österreichischen Truppen niedergeschlagen werden. Daraufhin lösten die drei Besatzungsmächte die Republik Krakau kurzerhand auf.
In der Hoffnung, die Ruhe auf diesem Wege besser sicherstellen zu können, annektierte das Kaiserreich Österreich Krakau und gliederte die Stadt in das Kronland Galizien ein. Anfangs beruhigte sich die Lage, doch als die Österreicher 1849 die Burganlagen auf dem Wawel in eine Festung zum Schutz gegen die panslawischen Pläne der Russen, zu deren Grenze es nur ein paar Kilometer waren, umbauten, kam es erneut zu Unruhen.
Auf dem Wawelhügel, einem Ausläufer des Tschenstochauer Juragebirges, hatte der polnische König residiert. Dort jetzt die verhassten Besatzungssoldaten zu sehen war eine Provokation für jeden patriotischen Polen. Täglich gab es Anschläge. Besonders die neu errichteten Kasernenmauern waren immer wieder Ziel von Aktionen.
Die Auseinandersetzungen mit den polnischen Nationalisten und die Bedrohung durch die Russen in Verbindung mit der Sorge um einen Krieg, der in dieser Lage durchaus hätte ausbrechen können, machte unserer Familie das Leben noch schwerer. Sie lebten in ständiger Sorge um ihr Leben und ihre und ihrer Kinder Zukunft. So hatten sie noch ein Jahr zuvor als bekennende Katholiken völlig ungehindert die Kirche besuchen können, um gemeinsam mit den polnischen katholischen Gläubigen die Messe zu feiern. Dies war anders geworden. Man verwehrte ihnen als Glaubensbrüder den Eintritt zwar nicht, doch von einem freundlichen Miteinander konnte selbst in der Kirche keine Rede mehr sein, im Gegenteil, Hass schlug ihnen ständig, und sogar in der Kirche, entgegen.
Gregor Szlapszi und seine Familie waren preußisch, sprachen deutsch und legten Wert auf ihre preußische Staatszugehörigkeit. Für die Polen gehörten sie der verhassten Minderheit einer Besatzungsmacht an. Was aber für Gregor Szlapszi und seine Familie noch schlimmer war; ihnen fehlte als Preußen auch der Rückhalt der österreichischen Behörden, die zuerst an die Sicherheit ihrer Landsleute dachten und die im Sinne ihrer Regierung handelten, wenn sie die Lebensverhältnisse preußischer Beamten nicht erleichterten, sondern eher noch erschwerten. Nachdem man Schlesien im Siebenjährigen Krieg vor nicht einmal hundert Jahren an Preußen verloren hatte, war man in Wien fest entschlossen, Galizien und Krakau, das seit der ersten Teilung Polens 1772 zu Österreich gehörte, der Habsburger Krone zu erhalten. Und wenn die preußischen Beamten weggingen, würden immer mehr Verwaltungsaufgaben österreichischen Staatsbediensteten zufallen. Etwaige Ansprüche aus Potsdam würden somit immer unwahrscheinlicher.
Gregor Szlapszi verließ die Wohnung nur noch wenn es absolut notwendig war. Seiner Frau und den Kindern verbot er, die Wohnung zu verlassen. Morgens ging er, für eine Droschke fehlte ihm das Geld, aufmerksam seine Umgebung beobachtend, in die Gewerbekammer, wo er in der Abteilung für die Genehmigung und Überwachung gefährlicher Anlagen, wozu damals auch der Betrieb der Eisenbahn gehörte, tätig war.
Gregor Szlapszi befand sich mit seiner Familie zwischen den Fronten. Trotzdem erfüllte er seinen Dienst mit preußischer Gründlichkeit. Im Herbst 1851 wurde er jedoch Opfer eines Anschlages, bei dem er ums Leben kam. Er selbst war gar nicht das eigentliche Ziel der Attentäter, die eine selbstgebaute Bombe in das Gebäude der Gewerbekammer warfen. Er war nur ein Opfer des Anschlags auf eine Einrichtung der preußischen Besatzer. Daraufhin entschloss sich Maria Szlapszi, mit den Kindern von Krakau wegzuziehen.
Viele Möglichkeiten eines Umzuges gab es für sie nicht. Nur eines war für sie klar. Sie wollte ins preußische Hoheitsgebiet, und da bot sich Schlesien an. In Langenbielau lebte eine Cousine und so fiel ihre Entscheidung schnell. Sie verkaufte Möbel und Hausrat an Mendel Seligmann, einen jüdischen Händler, der im Krakauer Judenviertel lebte. Es spricht für die liberale Haltung der Krakauer Bevölkerung zu dieser Zeit, dass die jüdische Gemeinde eine eigene Synagoge und einen eigenen Friedhof hatte, die weder von der österreichischen noch von der napoleonischen Besatzungsmacht fünfzig Jahre zuvor angerührt worden waren. Mendel Seligmann war Kaufmann und hatte nichts zu verschenken, doch er erkannte die Not der Witwe mit ihren minderjährigen Kindern und zahlte etwas mehr als andere. Am Abreisetag packte Maria vier Koffer und ein paar Säcke zusammen und verließ das Haus mit Ziel Poststation, wo sie die Kutsche in die neue Heimat nehmen wollte. Die beschwerliche Reise auf den nur teilweise gepflasterten Straßen dauerte vier Tage.
In Langenbielau wurden sie erwartet, denn Maria hatte ihre Ankunft in einem Brief angekündigt. Ihre Cousine stand an der Station als die Kutsche ihr Ziel erreichte. Ihre Begrüßung war herzlich und Maria glaubte sich in Geborgenheit. Endlich wieder, denn seit Gregors Tod hatte sie nur in Sorge gelebt, wie sie sich und ihre Kinder durchbringen sollte. Sie bekam eine Rente von der preußischen Regierung, aber die würde auf Dauer nicht reichen, um sich und die Kinder zu versorgen.
Nach der Begrüßung nahm ihre Cousine ihr zwei Koffer ab und führte sie zu einem kleinen Gasthof.
»Hier kannst Du wohnen. Ich habe Dir ein Zimmer bestellt.«
Maria verschlug es die Sprache. Sie hatte erwartet, dass sie bei ihrer Cousine für eine kurze Zeit unterkommen würde, nicht lange, aber eben so lange, bis sie eine Lösung für sich und die Kinder gefunden hatte. Wortlos folgte sie in den Gasthof und betrat ihr Zimmer.
»Macht fünf Silbergroschen in der Woche, im Voraus zu zahlen.«
Übertölpelt entnahm Maria ihrem Portemonnaie fünf Groschen und zahlte den Mann aus. Dann verabschiedeten sich die Cousinen. Alleine mit den Kindern auf dem Zimmer kamen ihr die Tränen. Hier konnte sie nicht bleiben. Sie musste schnell eine Lösung finden.
Am Tag darauf ging sie zum Haus ihrer Cousine. Auf ihr Klopfen öffnete ein kleines Mädchen von höchstens fünf Jahren die Türe. Maria erschrak. Dem Körper des Kindes konnte man ansehen, dass es schon länger nichts Ordentliches mehr gegessen hatte. Das Gesicht war ausgezehrt, die Augen lagen in tiefen, dunkel umränderten Höhlen und der Blick des Kindes zeugte von der großen Not, die es litt, ohne zu wissen, wie ihm eigentlich geschah. Es hielt seine Mutter ängstlich an der Hand und blickte sie wortlos an, und seine Blicke durchdrangen die Mutter bis in ihre Seele.
Maria trat ein. Der Raum war dunkel. An der Wand stand ein Schrank und in einer Ecke war eine offene Feuerstelle, in der kein Feuer brannte, obwohl es schon Herbst und kalt war. Der Mann ihrer Cousine und ein kleiner Junge arbeiteten an den Webstühlen. Für einen Moment blickte der Mann hoch und betrachtete argwöhnisch den Gast, ohne ihm jedoch weitere Aufmerksamkeit zu schenken. Aus der Dunkelheit der Stube löste sich die Gestalt des Jungen. Marias Cousine fasste auch ihn an die Hand. Dann gab sie Maria ein Zeichen, ihr in den hinteren Raum des Hauses zu folgen. Das kleine Mädchen und der Junge blieben ängstlich zurück. Durch die geschlossene Tür hörte Mariaden eintönigen Takt der Handwebstühle. Nachdem die beiden Frauen sich gesetzt hatten schauten sie sich wortlos an. Maria kam es vor, als würde sich das gesamte Elend dieser Welt in dem Blick ihrer Cousine konzentrieren. Sie wagte nicht, etwas zu sagen oder gar zu fragen, doch ihre Blicke waren Fragen genug.
»Das hast Du nicht erwartet«, begann die Cousine, die sich von den fragenden Blicken aufgefordert fühlte, etwas erklären zu müssen.
»Du musst nichts erklären.«
Maria legte die Hand auf die Schulter ihrer Cousine.
»Doch, Maria; wir sind arm. Das war nicht immer so. Sicher, wir hatten nie viel, aber wir konnten uns immer sattessen. Seit ein paar Jahren wird es immer schlechter. Wir arbeiten und arbeiten. Fritz ist neun und arbeitet wie ein Mann, zehn Stunden und mehr am Tag. Selbst Elisabeth hilft schon, obwohl sie erst fünf ist. Es bricht mir das Herz. Aber wie sollen wir sonst die Mengen schaffen, die Herr Dierig von uns verlangt.«
Sie hielt inne, denn sie sah Marias fragenden Blick.
»Die Firma Dierig gibt uns das Garn und die Wolle, und wir weben daraus Leinen und Wollstoffe. So war es immer schon, soweit ich zurückdenken kann. Vor ein paar Jahren aber wurden uns die Löhne gekürzt. Auf einmal bekamen wir nur noch die Hälfte von dem, was wir früher bekommen hatten. Sie sagten, dass sie auf die modernen Maschinen umstellen würden und die würden schneller und besser weben als wir. Wir haben uns zuerst geweigert, für diese Löhne zu weben, doch dann hatten wir gar nichts mehr. Du hast vielleicht das große Gebäude am Ortsrand gesehen. Das ist die Fabrik, die Dierig gebaut hat. Darin stehen Maschinenwebstühle. Ich habe gehört, da gibt es keinen Menschen mehr drin. Wie das funktionieren soll weiß ich nicht; so ganz ohne einen Menschen. Wir versuchen jetzt, genauso schnell zu sein wie die Maschinen. Wenn wir überleben wollen müssen wir doppelt so viel Stoff weben wie früher. Das ist aber nicht zu schaffen, auch wenn wir Tag und Nacht weben, und die Kinder auch. Maria; wir verhungern, obwohl wir fleißig sind. Glaub mir, ich war immer fleißig; der Herr soll‘s bezeugen, aber mehr können wir nicht.«
Sie weinte. Maria nahm sie in den Arm und tröstete sie, obwohl sie selbst nicht wusste, was aus ihr und ihren Kindern werden würde.
»Wir können Dich nicht aufnehmen. Es reicht nicht einmal für uns. Kannst Du mich verstehen?«
Maria nickte.
»Vor ein paar Jahren«, ihre Cousine schluchzte und die Worte kamen nur zögernd aus ihrem Mund, »haben die Männer sich gewehrt. Sie sind nach Peterswaldau zu der Fabrik von der Firma Zwanziger gezogen, weil der die Weber noch mehr ausbeutet und dazu noch lügt. Er sagte, dass er für unsere Stoffe nichts bekommt und uns deshalb auch nicht richtigen Lohn geben kann. Aber das stimmt nicht. Der Pfarrer hat gesagt, dass Zwanziger sich gebrüstet hätte, noch immer mit unseren Stoffen gut gegen die Maschinenware aus England bestehen zu können, weil wir bessere Qualität hätten. Da sind die Männer los und haben vor der Fabrik vom Zwanziger gestanden und gefordert, bessere Löhne zu bekommen. Wir sind hinterher und haben unseren Männern beigestanden. Auch Fritz war dabei; wie viele Kinder. Der Zwanziger hat aber nur die Polizei gerufen und die hat Soldaten geholt. Und die haben geschossen. Stell Dir vor, auf Kinder auch. Elf von uns sind tot geblieben, viele verletzt. Den Alois, das ist mein Mann, haben sie nach Breslau gebracht und zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Wie einen Schwerverbrecher. Nach einem halben Jahr haben sie ihn raus gelassen gegen hundert Peitschenhiebe. Man kann heute noch die Narben auf seinem Rücken sehen.«
Sie begann erneut zu weinen.
Maria wollte sie trösten, doch ihre Cousine wandte sich ab.
»Geh jetzt Maria, wir haben schon zu lange gesprochen. Ich muss wieder an die Arbeit.«
Sie machte eine ungelenke Bewegung in Richtung der Stube, wo ein Webstuhl auf sie wartete.
Maria stand auf und ging. Als sie die Stube zur Türe der kleinen Kate durchquerte spürte sie die Blicke, die sie verfolgten. Draußen vor dem Haus rang sie nach Luft. Es kam ihr vor, als müsste sie ersticken. Die Sorge um ihre Kinder machte sie halb wahnsinnig. Wohin? Was soll werden?
Es hatte sich in dem Dorf schon herumgesprochen, dass eine Neue angekommen war. Die Leute tuschelten, denn die Gerüchte nahmen kein Ende. »Zwei Kinder hat sie, eins von einem Russen und eins von einem Polen, die katholische Hure.«
Aus Krakau war sie geflohen, weil sie einer deutschen Minderheit angehörte. Nun war sie als Katholikin in einer protestantischen Gegend. Die gegenseitige Abneigung der beiden Religionsgruppen war ein Problem wie überall; schwerwiegender waren allerdings die sozialen Verhältnisse. Jeder Neue wurde zuerst einmal als ein Wettbewerber um einen der begehrten Arbeitsplätze angesehen, denn davon gab es nicht genug, um allen Einwohnern einen halbwegs ausreichenden Broterwerb zu sichern. Und so wurden Gerüchte in die Welt gesetzt, um Maria möglichst auszugrenzen. Jeder zeigte ihr seine Abneigung. Doch selbst wenn sie gewollt hätten; keiner der Heimarbeiter konnte sich eine Frau mit zwei Kinder leisten. Sie hätte bei den Löhnen, die gezahlt wurden, nicht den Lebensunterhalt für sich und die Kinder verdienen können.
Maria erkannte sehr schnell, dass sie eine andere Lösung finden musste. Am nächsten Morgen machte sie sich auf die Suche nach Arbeit. Sie zog ihre besten Sachen an und fragte in den umliegenden Gütern nach Arbeit. Überall bekam sie Absagen. Jetzt war nur noch eines geblieben. Voller Sorge weil dies vielleicht ihre letzte Chance war, klopfte sie an die schwere Türe aus schlesischer Eiche. Eine freundliche Frau ließ sie herein, und es dauerte auch nicht lange bis sie zu dem Verwalter des Gutes geführt wurde. Sie erklärte ihm, dass sie Arbeit suche, und dass sie nicht mehr weiter wisse. Der Verwalter, ein untersetzter, schon etwas älterer Mann mit einer Halbglatze, die er mit ein paar grauen Haaren zu kaschieren versuchte, hörte sich an, was sie zu sagen hatte. Dann straffte er seinen Rücken, zwirbelte seinen Bart und sah sie an.
»Du kannst in der Ziegelei arbeiten. Zehn Taler im Monat, Kost und Logis frei. Morgen meldest Du Dich beim Ziegler
Lanzkus. Der zeigt Dir, was Du zu tun hast und wo Du schlafen kannst.«
Dann drehte er sich um. Es war alles gesagt. Maria ging.
»Danke.«
In einer Ziegelei. Was würde auf sie zu kommen? Doch der erste Schritt war getan. Sie war erst einmal untergekommen und hatte eine Chance, den Winter zu überleben.
Tags drauf, als sie sah, wo sie zukünftig würde leben müssen, war sie erschüttert. Sie hatte eine Kammer in einem der Nebengebäude des Gutes. In der Kammer standen ein Ofen und ein Bett. Auf ihren Wunsch hin war ein zweites Bett für Gustav und Martha aufgestellt worden. Als der Vorarbeiter wieder gegangen war sah sie sich um. Es war traurig, doch irgendwie war sie froh, dass sie erst einmal eine Bleibe hatte.
Zehn Taler im Monat waren nicht viel, doch wenn man bedachte, dass eine Weberfamilie trotz aller Mühe auch nicht mehr als höchstens zweihundert Taler im Jahr verdiente, ging es ihr bei freier Kost und Logis erst einmal nicht so schlecht. Hinzu kam die Pension ihres Mannes. Wenn sie sparsam wäre könnte sie vielleicht etwas zurücklegen.
Fürs erste würde sie mit den Kindern hier bleiben, wenn es auch noch so schrecklich war.