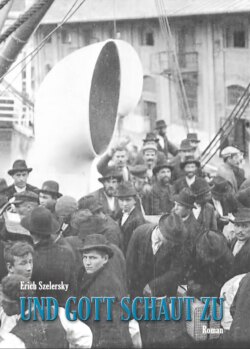Читать книгу Und Gott schaut zu - Erich Szelersky - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gustav 1852 bis 1866 Kindheit und Jugend in Langenbielau, Schlesien
ОглавлениеGustav Szlapszi war sieben Jahre alt, als er mit seiner Mutter und seiner Schwester auf dem Gut ankam. Die schwierigen Lebensverhältnisse nahm er noch nicht wahr. Dazu war er noch zu klein. Er lebte auf dem Gut und spielte mit seinen Gleichaltrigen. Die Gutsbesitzer waren ebenso wie alle anderen Gewerbetreibenden per Gesetz verpflichtet, von Kinderarbeit abzusehen. Das schützte Gustav aber nur bis zu seinem sechsten Lebensjahr. Im Sommer des Jahres 1853 wurde er zum ersten Mal zur Mithilfe bei der Ernte eingeteilt. Zusammen mit den anderen Kindern, die auf dem Hof aufwuchsen, musste er auf den Feldern helfen. Morgens ging er schon früh mit den Erwachsenen auf die Felder, und erst am Abend, wenn es dunkel wurde, kam er zusammen mit seiner Schwester nach Hause. Er empfand nichts Außergewöhnliches dabei. Alle machten es so. Es war Bestandteil ihres Lebens, doch Maria hatte in Krakau erlebt, dass Kinder anders aufwachsen konnten.
Es gab in Langenbielau keine katholische Schule, die wurde erst 1859 gegründet, und deshalb erhielt sie keine Information darüber, dass Gustav mit sieben Jahren schulpflichtig wurde. Die protestantische Gemeinde in Langenbielau sah keine Veranlassung, Katholiken darüber zu informieren, und die Gutsbesitzer freuten sich über jedes Kind, das trotz der Schulpflicht, die in Preußen schon gesetzlich geregelt war, nicht zur Schule ging und somit als Arbeitskraft zur Verfügung stand.
Durch Zufall erfuhr Maria, dass Martha und Gustav zur Schule gehen konnten. Friedrich I. hatte bereits 1717 die Schulpflicht in Preußen eingeführt, in dem er erließ, dass die Eltern überall dort, wo es eine Schule gab, ihre Kinder in dieselbe zu schicken hätten. Es gab allerdings nur wenige Schulen. Und dort, wo es Schulen gab, gingen auch viele Kinder nicht hinein, denn die meisten Familien waren darauf angewiesen, dass ihr Kind beim Broterwerb mitarbeitete. So blieben die meisten der Schule fern und damit Analphabeten. Durch den Schock der verheerenden militärischen Niederlage 1806 gegen Napoleon und der in deren Folge politischen Bankrotterklärung Preußens erkannte man die Notwendigkeit von Reformen, die auch das Schulwesen umfasste. Enorme Anstrengungen wurden unternommen, flächendeckend Schulen zu bauen und ausgebildete Lehrer einzustellen. 1840 führte Preußen die allgemeine Schulpflicht ein und verpflichtete die Eltern. Trotz der angedrohten Sanktionen im Falle des Nichterscheinens wurde das Gesetz jedoch oft genug unterlaufen. Die Kinder wurden weiterhin als billige Arbeitskräfte missbraucht, und die am Existenzminimum lebenden Familien wehrten sich nicht dagegen, da sie zum Überleben jeden Groschen brauchten. Hinzu kam, dass es den einfachen Menschen häufig auch an der Einsicht fehlte, dass eine bessere Bildung die Lebensperspektiven ihrer Kinder verbesserte. Die meisten der Lohnarbeiter waren selbst Analphabeten, und von den Kanzeln wurde ihnen erklärt, dass dies Gottes Wille sei und sie sich in ihr Schicksal, in einer ständisch strukturierten Gesellschaft am unteren Ende zu leben, zu fügen hätten. Kaum einer stellte sich die Frage, warum ihnen Hunger als Prüfung Gottes auferlegt würde und warum Gott anderen diese Prüfung ersparte.
Auch Maria war gottesfürchtig und fügte sich soweit es sie selbst betraf. Für ihre Kinder erhoffte sie sich jedoch eine bessere Zukunft. Gregors Eltern waren in seiner Kindheit zum katholischen Glauben konvertiert, damit er auf die Klosterschule gehen und preußischer Beamter werden konnte. Jetzt war Gregor tot und sie lebten in einem Dorf, in der es nicht einmal eine katholische Schule gab. Ihre Kinder mussten auf die Schule, und wenn es die evangelische war, auch gut. Sie setzte alle Hebel in Bewegung, dass Gustav und Martha auf die Schule konnten. Sie erwog sogar, mit ihren Kindern erneut zu konvertieren und protestantisch zu werden, was die Aufnahme in die Schule sehr erleichtert hätte, doch sie zögerte. Was würde Gregor sagen? Es ist schwer, sich zu emanzipieren, wenn man jahrhundertelang eingetrichtert bekommen hat, wie man zu leben und zu denken hätte. Natürlich nur, um Gott zu gefallen und die ewige Seligkeit zu erlangen. In Wahrheit dienten all diese Aussagen und Maßnahmen nur einem Ziel: der Bewahrung bestehender Strukturen durch Unterdrückung. Und dies zur Bevorzugung der Unterdrücker.
Martia brauchte eine Lösung zum Wohle ihrer Kinder. In ihrer Not wandte sie sich an den Gutsverwalter. Sie hoffte, er würde ihr helfen können. Einmal im Monat durfte das Gesinde um ein Gespräch beim Gutsverwalter nachfragen. Als sie bei ihm vorsprach hörte er sich ihr Anliegen an. Nach einer Weile nickte er zustimmend mit dem Kopf.
»Komm heute Abend gegen acht Uhr zu mir. Ich werde schauen, ob ich etwas für Dich tun kann.«
Am Abend klopfte Maria an die Tür des Gutsverwalters. Er öffnete persönlich die Tür und bat sie herein. Diese Freundlichkeit hatte Maria nicht erwartet. Sein Salon war geschmackvoll eingerichtet. Er bot Maria einen Platz an. Unsicher strich sie sich den Rock gerade und setzte sich.
»Du bist neu in der Gegend, nicht wahr?«
Er grinste jovial
»Ja, mein Herr.«
Du willst also, dass Deine Kinder in die Schule gehen?«
»Ja. Ich möchte, dass die Kinder etwas lernen.«
Maria entwickelte ihren Kampfgeist.
»Und es ist Gesetz.«
»Gesetz? Was heißt das schon? Wir brauchen hier jede Hand. Das weißt Du doch?«
»Ja, schon. Aber meinen Kindern soll es einmal besser gehen als mir.«
Der Gutsverwalter grinste und schob sich etwas näher an sie heran.
»Für uns ist eine Arbeitskraft sehr wertvoll. Sie zu verlieren kostet seinen Preis. Wer soll die Garben binden und beim Verladen helfen? Wir müssten einen anderen einstellen.«
»Was kann ein Kind von sieben Jahren schon leisten?«
»Immerhin bittest Du um zwei Arbeitskräfte.«
Maria stutzte. Er bemerkte den ungläubigen Blick in ihren Augen und setzte sich neben sie. Dabei lächelte er sie an.
»Es gibt aber immer einen Weg.«
Dann ging alles sehr schnell. Ohne ihr einen Augenblick Zeit zu lassen umarmte er sie und küsste ihren Mund. Sie drehte sich um und versuchte aufzustehen. Er hielt sie zurück und presste sie in die Polster des Sofas. Maria wehrte sich und als er immer zudringlicher wurde schlug sie ihm ins Gesicht. Der Gutsverwalter zuckte zurück. Er sprang auf und richtete seine Krawatte. Maria rannte aus dem Haus. Draußen brach sie in Tränen aus. Was nun? Nach einigen schlaflosen Nächten fasste Maria einen Entschluss. Sie blieb im Bett liegen und schickte Gustav zu Lanzkus. Er sollte ihm sagen, dass sie krank sei und nicht zur Arbeit kommen könne. Als Gustav weg war machte sie sich auf den Weg nach Reichenbach. In Reichenbach gab es eine katholische Gemeinde und eine katholische Schule. Martha hatte sie eingeschärft, keinem ein Wort zu erzählen, ganz gleich, was passieren würde.
Reichenbach war weit, und sie musste anfangs sehr aufmerksam sein, denn sie wollte nicht von anderen Bediensteten des Gutes bemerkt werden. Als sie die Dächer der Häuser und den alles überragenden Turm der Kirche der alten Stadt erkennen konnte beschleunigte sie ihre Schritte. Außer Atem kam sie in der Stadt an und ging sofort zu der katholischen Kirche.
In der Kirche war es menschenleer. Am Altar brannte das ewige Licht. Sie kniete nieder und bekreuzigte sich. Langsam ging sie im Mittelschiff auf den Altar zu. In der ersten Bankreihe kniete sie nieder und betete. Sie erhoffte sich Hilfe für ihr Problem. Die Kinder mussten in die Schule. Das war ihr sehnlichster Wunsch. Maria hatte nicht wahrgenommen, dass jemand in der Bank hinter ihr Platz zum Beten genommen hatte. Erst durch ein leichtes Räuspern wurde sie aufmerksam und drehte sich um.
»Du bist fremd hier. Ich habe Dich noch nie gesehen.« Pfarrer Broszka duzte sie, ohne zu fragen ob er es durfte und empfand darin auch nichts Ungewöhnliches. Maria schaute ihn an und stand auf. Sie trat in den Gang und wandte sich dem Pfarrer, wegen dem sie ja auch hier war, zu.
»Ich möchte, dass meine Kinder in die katholische Schule hier in Reichenbach gehen.«
»Und warum gehen sie noch nicht hier in die Schule?«
»Ich wohne in Langenbielau und dort gibt es keine katholische Schule. Und die evangelische nimmt sie nicht auf.«
»Du wolltest sie auf eine evangelische Schule schicken?« Pfarrer Broszka verfinsterte sein Gesicht zu einer vorwurfsvollen Miene.
»Ich wusste mir keinen Rat. Sie sollen zur Schule gehen und Schreiben und Lesen lernen. Können Sie nicht hier in Reichenbach in die Schule gehen?«
»Es ist ein weiter Weg von Langenbielau hierher.«
Maria schwieg devot. Pfarrer Broszka schaute sie an. Als ihm bewusst wurde wie ernst es Maria war wurde er etwas versöhnlicher.
»Nun, Deine Kinder wären nicht die Einzigen aus Lanenbielau. Ich muss einen Antrag stellen. Komm in einer Woche wieder.«
Er hielt ihr seine rechte Hand hin. Sie kniete nieder und küsste sie. Damit war das Gespräch beendet.
Als der Gutsverwalter von Marias Ausflug nach Reichenbach erfuhr zitierte er sie zu sich und stellte sie zur Rede. Maria erklärte erneut ihr Anliegen und dass sie im Sinne ihrer Kinde so handeln musste.
»Geh ins Kontor. Dort bekommst Du ein Zeugnis. Dann kannst Du mit Deinen Kindern gehen. So eine wie Dich können wir hier nicht brauchen.«
Maria erschrak. Tränen schossen ihr aus den Augen.
»Wo soll ich denn hin?«
»Das hättest Du Dir vorher überlegen sollen. Geh jetzt.« Maria verließ das Büro des Gutsverwalters. In ihrem Zimmer packte sie ihre Sachen und half den Kindern beim Anziehen. Dann verließen die drei das Gut. Gustav war für sein Alter schon groß und trug seinen Rucksack alleine. Er wurde ihm auf dem langen Weg immer schwerer, doch er ließ sich nichts anmerken. Völlig erschöpft erreichten sie die katholische Kirche in Reichenbach. Sie setzten sich in die letzte Bank. Himmlische Ruhe umgab sie, bis der Pfarrer eintrat.
»Was wollt Ihr hier?«
»Ich war gestern schon mal da. Das sind meine Kinder.«
»Geh jetzt. Hier kannst Du nicht bleiben.«
»Ich dachte, in der Kirche wäre Platz für jeden, der Hilfe sucht.«
»Das Haus Gottes ist aber kein Gasthof. Da müsst Ihr hingehen.«
Er wies ihnen den Weg zum Portal.
Maria und die Kinder gingen. Im Gasthof fanden sie ein Zimmer für eine Nacht. Zum Glück hatte Maria jeden Monat etwas Geld von der Pension ihres Mannes zurückgelegt, so dass sie den Silbergroschen, den der Wirt für das Zimmer und eine Nacht haben wollte, zahlen konnten. Sonst wären sie alle im Schuldturm gelandet. Die Lage war aussichtslos. Keiner wollte sie. Gustav verstand die Situation nicht ganz. Er bemerkte aber, dass seine Mutter traurig war und das machte ihn unglücklich.
»Warum bist Du traurig?«, flüsterte er ihr zu, als sie im Bett lagen. Maria wusste nicht, was sie einem kleinen, siebenjährigen Jungen sagen sollte. Nach einer Weile strich sie ihm über seinen Kopf.
»Weil uns Unrecht geschieht, Gustav.«
»Was ist Unrecht?«
Maria stockte. Was ist Unrecht. Dann sagte sie ihrem Sohn: »Weißt Du Gustav, Unrecht ist alles, was Menschen unglücklich macht.«
Gustav weinte in sein Kopfkissen hinein. Er würde immer gegen Unrecht kämpfen. Was er jedoch nicht wusste; er würde auch Unrecht begehen.
Nach einer unruhigen Nacht gingen die beiden Kinder mit ihrer Mutter erneut ins Pfarrhaus. Pfarrer Broszka machte es kurz. Wahrscheinlich würden die beiden Kinder in der katholischen Schule einen Platz bekommen, so meinte er. Natürlich nur, damit sie nicht bei den Protestanten im falschen Glauben erzogen würden, wie er ausdrücklich betonte. Als Maria nicht locker ließ und wissen wollte, wann die Kinder denn in die katholische Schule in Reichenbach aufgenommen würden, gab ihr der Pfarrer die ersehnte Antwort: »Also gut. Sie sollen am Montag kommen.«
Maria war erleichtert. Der Weg zurück nach Langenbielau fiel ihnen leicht, doch als Maria in der hereinbrechenden Nacht das Gutshaus sah bekam sie Angst. Wo konnte sie wohnen? Bald würde der Winter kommen, und die Winter im Riesengebirge waren lang und hart.
Sie müsste bei der Gutsverwaltung bitten, wieder angestellt zu werden. Schon der Gedanke daran lastete wie ein schwerer Stein auf ihrem Herzen. Es wurde auch nicht einfach. Sie klopften an die Türe der Küche, die einen Ausgang zum Hof hatte, um die Abfälle leichter entsorgen zu können. Die Köchin öffnete. Sie kannte Maria, und es hatte sich natürlich auf dem Hof herumgesprochen, dass Maria entlassen worden war.
»Darf ich reinkommen?«
Die Köchin nickte, obwohl es ein großes Risiko für sie war. Sie hielt den Finger auf ihren Mund als Zeichen, nicht zu sprechen. Als alle drin waren schloss die Köchin die Türe zum Flur.
»Was willst Du?«
Maria erzählte, was passiert war und dass sie über Nacht einen Schlafplatz brauchte. Morgen wollte sie direkt in der Frühe um Wiedereinstellung nachsuchen. Die Köchin sah, dass alle todmüde waren. Sie ging zum Ofen und gab allen von der Suppe, die vom Abendessen übrig geblieben war. Dazu erhielten sie ein Stück Brot. Das war das erste Essen seit fast zwei Tagen. Als sie satt waren gab ihnen die Köchin den Schlüssel zu ihrer Kammer. Es war ein Privileg, das Köchinnen und Köche auf den Gutshöfen oftmals hatten, während die Dienstmägdeund Küchenhilfen irgendwo unterm Dach oder im Keller in Mehrbettzimmern, oftmals ohne Fenster, untergebracht waren. Maria schlich mit den Kindern aus der Küche in das Zimmer der Köchin. Es war sehr klein, hatte ein Bett und einen Schrank. Die drei legten sich auf den Boden. Der war hart, doch das merkten sie nicht. Als sie am nächsten Morgen aufwachten war das Bett der Köchin schon leer. Sie wussten nicht, wie spät es war, doch es war schon Tag.
»Bleibt hier und rührt Euch nicht. Ich bin gleich wieder da.«
Maria trat auf den Flur des Nebengebäudes, in dem auch der Gutsverwalter mit seiner Familie wohnte. Langsam ging sie hinunter, in Sorge, jeden Augenblick entdeckt zu werden. Unten angekommen trat sie schnell auf den Hof. Sie wollte gerade die Treppenstufen hinab treten als sie aufgehalten wurde.
»Was machst Du denn hier? Habe ich Dir nicht gesagt, Du sollst verschwinden.«
Maria war entsetzt. Sie war entdeckt. Verwirrt schaute sie umher.
»Wo kommst Du her?«
Maria hatte sich wieder gefasst.
»Ich habe Sie gesucht.«
»Hier?«
Maria überhörte das.
»Ich wollte Sie bitten, mich wieder einzustellen. Ich weiß nicht wohin.«
»Ich habe Dir schon gesagt, wie ich darüber denke.«
Maria versuchte alles, doch der Gutsverwalter blieb hart. Sie flehte, bettelte, doch es war vergebens. Der in seiner Ehre gekränkte Gutsverwalter ließ sich nicht erweichen. Zu sehr hatte sie ihn verletzt, als sie ihn zurückstieß. Er hatte auch Sorge, dass sie vielleicht einmal über seinen Annäherungsversuch reden könnte, und das konnte er gar nicht gebrauchen. Ihm waren die Mädchen lieber, die für ein paar Vergünstigungen großzügig seine Wünsche erfüllten. Maria gehörte nicht dazu.
»Geh. Ich sage es nicht noch einmal.«
Deprimiert verließ sie mit ihren Kindern den Hof.
Ihre Cousine war nicht erfreut, als sie wieder vor ihrer Tür standen.
»Kein Essen, nur etwas Wasser und ein Dach überm Kopf. Für eine Nacht. Ist das zu viel verlangt, liebe Cousine?« Sie ließ sie hinein.
Am Abend saßen sie beisammen und teilten das wenige Brot, das sie hatten. Es herrschte Stille. Keiner sagte ein Wort, bis Maria, deren Gehirn fieberhaft nach einem Ausweg suchte, einen letzten Versuch unternahm.
»Kann ich nicht vielleicht doch ein paar Tage bei Euch bleiben?«
Sie bemerkte, dass Ihre Cousine erschrak und fügte hastig hinzu:
»Ich habe eine kleine Pension als Witwe. Jeden Monat fünfzehn Taler. Die gebe ich Euch. Ich arbeite auch dafür. Nur so lange, bis ich etwas gefunden habe.«
»Fünfzehn Taler, das ist mehr als wir verdienen. Ist das wirklich wahr?«
»Ich sag‘s Euch doch.«
»Gut, aber nur bis Du etwas gefunden hast.«
Noch am Abend zog Maria mit den Kindern und den wenigen Habseligkeiten, die sie noch hatte, in das Haus ihrer Cousine ein.