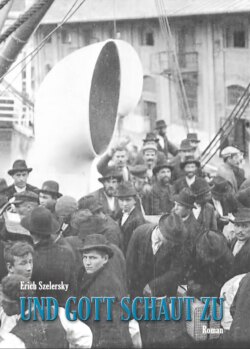Читать книгу Und Gott schaut zu - Erich Szelersky - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gustav und Henriette 1866 bis 1894 Krieg
ОглавлениеKöniggrätz, Sommer 1866. Es herrschte Krieg. Die preußische Armee war in das habsburgische Böhmen eingefallen. Krieg sollte die Entscheidung über die Führungsrolle in Deutschland herbeiführen. Preußen oder Österreich. Beide Mächte standen sich unversöhnlich gegenüber.
Gustav war dabei. In Eilmärschen waren sie über das Riesengebirge marschiert. Jetzt wühlten sie sich in den Dreck wie Maulwürfe. Jeder Zentimeter, den sie sich mit ihren groben, dreckverkrusteten Fingern in die Erde Böhmens kratzten, bedeutete für sie ein bisschen mehr Leben, oder besser Überleben. Sie wussten nicht genau, wo sie waren, und es war ihnen auch egal. Ihnen war nur eines klar. Wenn sie aus diesem Inferno heil rauskommen wollten mussten sie sich ganz klein machen, so klein, wie sie nur konnten.
Es waren die ersten Kämpfe, die Gustav mitmachte, obwohl er schon zwei Jahre bei der preußischen Armee war. Er hatte oft bereut, damals zu den Soldaten gegangen zu sein, denn die Zeit in der Armee war geprägt von Drill und Demütigungen. Absoluter Gehorsam wurde von ihm und seinen Kameraden gefordert. Schon die geringste Übertretung einer Anordnung oder ein nicht sofort ausgeführter Befehl hatte schlimmste Bestrafung zur Folge. Eiserne Disziplin stand über allem. Sie wurde jedem Einzelnen von ihnen abverlangt. Die Prügelstrafe war offiziell zwar schon seit Jahren abgeschafft; wurde jedoch immer wieder angewandt, wenn Fehler beim Exerzieren gemacht wurden, oder die Soldaten nicht auf Anhieb begriffen oder taten, was die Vorgesetzten von ihnen verlangten. Nach den vernichtenden Niederlagen in den napoleonischen Kriegen etwa fünfzig Jahre zuvor hatten Scharnhorst und Gneisenau ganze Arbeit geleistet und eine schlagkräftige und bestens ausgerüstete Armee mit eiserner Disziplin geschaffen.
Die meiste Zeit hatte Gustav auf der Festung Glatz verbracht. Der Trott des täglichen Dienstplans bestimmte das Leben. Wecken um fünf. Appell, Exerzieren, Drill, Schießübungen. Erst am Abend kamen sie etwas zur Ruhe. Nach den kargen Rationen, die Abendessen genannt wurden, musste jeder seine Kleidung und Ausrüstung reinigen und flicken. Um zehn war Zapfenstreich. Die Petroleumlampen wurden gelöscht. Die Soldaten schliefen auf Strohsäcken, die auf groben Eisengestellen lagen. In den Schlafsälen für die einfachen Soldaten standen zwanzig davon, dicht an dicht nebeneinander. Jeden Monat tauschten sie das Stroh aus; doch die Wanzen waren trotzdem ihre ständigen Begleiter. Das störte aber keinen von ihnen sonderlich, denn diese kleinen Störenfriede kannten sie schon seit sie denken konnten, und so war es für sie nichts Ungewöhnliches, wenn sie nachts von den Blutsaugern immer und immer wieder aus ihrem Schlaf gerissen wurden. Die Festung Glatz war schon von weitem für jeden, der sich der Kleinstadt in Niederschlesien näherte, zu erkennen. Sie lag auf einem felsigen Hügel am linken Neißeufer. Schon seit Jahrhunderten war sie immer wieder Mittelpunkt kriegerischer Auseinander-setzungen gewesen. Der Grund hierfür war ihre strategische Lage an der Straße nach Breslau. Unterhalb der Festung lag die kleine Altstadt. Umgeben von Mittelgebirgen lag die Stadt in einem Kessel. Diese natürlichen Grenzen gaben ihr eine geostrategische Lage und machten sie damit zu einem bevorzugten Ziel militärischer Operationen. Nach Abzug der französischen Besatzungstruppen fiel Glatz im Rahmen der Neuordnung auf dem Wiener Kongress wieder an Preußen. Die Menschen in Glatz hatten sich an das Bild der Soldaten gewöhnt. Über 5000 von ihnen taten in der Festung und den zwei in den vergangenen Jahren dazu gebauten Kasernen ihren Dienst. Glatz war zu einem riesigen Heerlager geworden. Das brachte immer wieder einmal Probleme, denn wenn so viele Männer auf so engem Raum fern von daheim zusammenleben, geht dies nicht immer ohne Gewalt ab. Auf der anderen Seite war die preußische Militärverwaltung der größte Auftraggeber in der Region, und die kleinen Betriebe und Handwerker der Umgebung lebten sehr gut davon. So hatte man sich arrangiert. Die militärische Führung tat alles, um Störungen in der Stadt zu vermeiden, und die Stadtverwaltung bemühte sich, die zum Alltagsbild gehörenden Soldaten zu übersehen. Durch strenge Bestrafung wurde die Disziplin unter den Männern sichergestellt. Dennoch kam es immer wieder vor, dass Soldaten, die dem eintönigen Trott des Dienstes entfliehen wollten, sturzbetrunken durch die Straßen torkelten. Prügeleien waren dann an der Tagesordnung, doch wenn sich wieder einmal einige in den Gasthäusern schlugen, rückte sofort eine Einheit Bewaffneter herbei und las die Armseligen auf. Die wurden noch an Ort und Stelle in Ketten gelegt und zur Festung gebracht. Dort erwartete sie Kerkerhaft. Doch selbst die vier Wochen in dem dunklen und feuchten Gemäuer hielt die Männer nicht davon ab, sich von Zeit zu Zeit voll laufen zu lassen und dann im Suff ihre Streitigkeiten auszutragen. In dieser Welt lebte Gustav Szlapszi, der damals nicht einmal zwanzig Jahre alt war. Sein Leben wurde vom Gleichklang des Dienstplanes bestimmt, doch das sollte sich bald ändern. Unmittelbar im Anschluss an den Abendappell, als alle schon darauf warteten, in ihre Stuben entlassen zu werden, ertönte ein unerwarteter Befehl. »Kompanie stillgestanden! Rechts um! Im Gleichschritt Marsch!« Gustavs Kompanie marschierte auf der breiten, gepflasterten Straße, die zwischen den Unterkünften und dem Exerzierplatz verlief, in Richtung Regimentsgebäude. Dort trafen sie auf die anderen Kompanien. Nachdem sie alle angetreten waren erschien der Regimentskommandeur, Oberst Carl August von Kalckreuth. Er trat vor das angetretene Regiment und erhob sein Wort. »Soldaten des Infanterieregiments vier! Auf Befehl unseres Kommandeurs, Seine Königliche Hoheit, Kronprinz Friedrich, werden wir aus der Festung Glatz ausrücken. Wir werden morgen bei Tagesanbruch abmarschieren. Auf unser Regiment warten große Aufgaben. Ich erwarte von jedem von Euch, dass er bedingungslos seine Pflicht erfüllt!« Er machte eine kleine Pause und schaute die Reihen der angetreten Soldaten an. Dann straffte er sich und rief. »Unsere Königliche Majestät, König Wilhelm I. Er lebe hoch!« Aus den mehr als 2000 Kehlen dröhnte ein »Hoch!« Sie konnten weg treten. Gustav machte sich mit den anderen auf den Weg zu seiner Unterkunft. Dort wurden sie angewiesen, ihren Tornister für den Marsch in eine ungewisse Zukunft zu packen. In dieser Nacht schlief Gustav schlecht. Sorge erfüllte ihn, und wenn er an die bevorstehenden Kämpfe dachte überkam in Angst. Der nächste Tag begann schon sehr früh. Schon um halb vier wurden sie geweckt. Im Dämmerlicht der aufgehenden Sonne rückten sie aus. Ihr Weg führte sie nach Böhmen. Hier würde entschieden werden, ob die Politik Otto von Bismarcks, einen deutschen Nationalstaat preußischer Prägung oder gar von Preußen dominiert, erfolgreich sein würde. Dazu musste jedoch der größte Widersacher dieser preußisch-deutschen Lösung, Österreich, besiegt werden. Die schier unendlich scheinende Heerschlange bahnte sich ihren Weg über das Riesengebirge. Unter größten Entbehrungen und nach mühevollen Märschen erreichten sie nach ein paar Tagen ihr Ziel Horice in Böhmen. Bei ihrem Marsch über das Riesengebirge hatten sie, ohne auf Grenzsoldaten zu treffen, österreichisches Territorium betreten. Nicht weit von Horice entfernt entstand ein riesiges Feldlager. Von hier würde der Aufmarsch gegen die österreichischen Truppen stattfinden. Es herrschte emsiges Treiben. Pferdegespanne wurden entladen und die Großzelte, die im Rahmen der Militärreform in der Armee eingeführt worden waren, wurden aufgebaut. Obwohl völlig erschöpft, arbeiteten die Soldaten bis in die Dunkelheit. Dann hatten sie die Zelte aufgestellt. Gustav suchte sich einen Schlafplatz in einem Zelt und fiel todmüde um. Ohne etwas zu essen oder zu trinken legte er sich, sein Kopf auf dem Tornister, der ihm als Kopfkissen diente, auf den Boden und schlief sofort ein.
Nach zwei Tagen in dem Feldlager begann es zu regnen. Über Nacht verwandelten sich die Wege in tiefe Schlammfurchen, die sie fast unpassierbar machten. Doch der Strom der herbei marschierenden Soldaten riss nicht ab. Fast endlos schien der Zug von Pferdegespannen, die sich ihren Weg durch den Morast bahnten. Bis zu den Knien versanken die Artilleriesoldaten in der aufgewühlten Erde. Mit ihren bloßen Händen griffen sie in die Speichen der Wagen und halfen den mit heftigen Peitschenschlägen angetriebenen Pferden, die Geschützlafetten mit den schweren Artilleriegeschützen vorwärts zu bewegen. Jeder Meter wurde zur Qual, und je mehr Gespanne sich ihren Weg zu bahnen versuchten, desto beschwerlicher wurde es für Mensch und Tier. Der Dauerregen tat sein Übriges. Die Uniformen sogen sich voll Wasser und wurden für die sie tragenden Soldaten zu schweren Gewichten, die noch zusätzlich an ihren Kräften zerrten.
Viele Pferdegespanne blieben stecken, und so waren nicht genügend Zelte vorhanden, doch die hereinströmenden Soldaten suchten Schutz vor dem Regen und drängten in die Zelte. Bald waren die Zelte so überfüllt, dass sie sich nicht einmal mehr legen konnte. Doch das war immer noch besser als draußen im Regen zu campieren. Inzwischen lagerten bei Horice sechzigtausend Soldaten. Die völlig erschöpften und durchnässten Soldaten versuchten zuerst einmal, sich und ihre Kleidung zu trocknen. Überall wurden dafür Feuer entzündet. Vor allem die Stiefel, die sich durch die Nässe vollgesogen hatte, mussten kräftig geknetet und gewalkt werden, denn mit der Trocknung verzog sich das schlechte Leder zu einer knochenharten Schwarte. Jeder, der hierbei nachlässig war, würde dafür schon nach ein paar Kilometern Marsch bitter bezahlen. Zuerst würde das harte Leder scheuern. Dann riss die Haut auf, und kurz darauf würde sich das rohe Fleisch an dem rauen Leder reiben bis das Blut in den Stiefel floss und die Socken zu einer harten klebrigen Masse verklumpten. Jeder Schritt würde so zur Qual. Aber die Vorgesetzten kannten keine Gnade. Sie würden trotzdem weitermarschieren müssen. Auf Rücksicht konnte keiner hoffen. Nachts spendeten die Feuer Wärme, und der Schein des flackernden Lichtes vermittelte jedem etwas Vertrautes. Gustav blickte gedankenverloren in eines der Feuer. Fast wie zuhause, wenn Mutter das Feuer im Ofen entzündet hatte, kam es ihm unwillkürlich in den Sinn. Nach einer Woche des Wartens in der klammen Kälte der Nässe kam der Befehl zum Aufbruch. Gustavs Regiment wurde in die vorderste Linie verlegt. In Eilmärschen,
täglich acht Stunden über ausgetretene Wege, marschierten sie ihrem ungewissen Ziel entgegen. Wer umfiel und aus den Marschkolonnen heraus brach, wurde hochgetrieben. Mit Stöcken hieben die Korporale auf die Soldaten ein.
Nach zwei Stunden Marsch gab es jeweils eine kurze Pause.
Etwas trinken, die wunden Füße versorgen und ein wenig liegen und durchatmen. Mehr Zeit blieb nicht. Zu essen gab es erst am Abend. Der Tornister mit ein paar Sachen, dem Stückchen Brot, das sich Gustav vom Abend zuvor aufbewahrt hatte, und hundert Patronen, die jeder als Teil seiner Bewaffnung mitschleppen musste, wurden von Kilometer zu Kilometer schwerer. Jetzt diente er den meisten dazu, ihren Kopf darauf zu legen. Bei einigen waren die Füße mit Blasen übersät. Die Haut war aufgerissen und das pure Fleisch scheuerte bei jedem Schritt gegen das grobe Leder der Stiefel. Die Socken waren verdreckt und blutig, denn sie hatten schon seit ihrem Abmarsch in Horice keine Zeit mehr gehabt, sie ordentlich zu waschen. Der Dreck gelangte in die Wunden, die sich entzündeten und eiterten. Notdürftig banden sie Lappen um die Füße, damit das rohe Fleisch der Füße nicht zu sehr an den Stiefeln rieb. Alle versuchten, die kurze Rast so gut es ging zu nutzen, doch der Befehl zum Weitermarschieren war unerbittlich. So hetzten und keuchten sie los, angetrieben von den Korporalen und Offizieren.
Bei Sonnenuntergang gelangten sie in ihr Nachtlager. Vor-ausmarschierende Soldaten hatten den Lagerplatz vorbereitet, doch die Nacht mussten sie im Freien verbringen, denn Zeit, Zelte aufzuschlagen, wurde ihnen nicht gewährt. So saßen sie vor den Feuern, die überall im Lager angezündet waren, und aßen den Kanten trockenes Brot und den Hartkäse, ihre Tagesration. Dazu bekamen sie Grießbrei und einen Hering. Vier Tage vergingen so. Wer absolut nicht mehr konnte wurde zurück gelassen. Rechts und links vom Weg lagen sie und hofften darauf, dass eines der nachfolgenden Fuhrwerke sie mitnahm. Die Marschkolonnen zogen stumm an ihnen vorüber. Am Abend des vierten Tages erreichten sie ihr Ziel. Erleichtert fiel Gustav auf die Knie, als der Befehl kam, die Zelte wieder aufzubauen. Endlich. Das Leiden hatte ein Ende. Ein paar Tage Ruhe. Sie konnten ausruhen und wurden medizinisch versorgt. Die Feldscher kümmerten sich um die zerschundenen Füße und verbanden Wunden. Das wichtigste war aber, dass sie warmes Essen bekamen. Suppe, Kartoffeln, zwei Heringe und etwas Fleisch. Dazu gab es gesüßten Rum. Gustav trank, und die Qualen der vergangenen Tage verschwanden im Dunst des Alkohols.
Erinnerungen überkamen ihn. Zwei Jahre war es her, seit er Soldat geworden war. Er hatte sich sogar freiwillig gemeldet. Wie konnte er nur? In Gustavs Kopf zogen die letzten Jahre wie in einem Film vorüber. So hatte er sich das Soldatenleben nicht vorgestellt, als er sich damals von dem preußischen Korporal mit seinen beiden Soldaten in ihrer prächtigen Uniform zur königlich preußischen Armee hatte anwerben lassen.
Rrrrratttatamm, rrrrratttatamm, rrrrratttatamm. Die Trommeln erstarben genauso schnell, wie sie stakkato artig begonnen hatten.
»Kommt nur näher! Kommt her und hört zu, was Euch Euer König, Seine Majestät, König Wilhelm, zu sagen hat. Die Armee braucht Euch. Sie ist eine starke Armee, und sie ist dazu da, unser Land, unsere Frauen und unsere Kinder zu verteidigen, sie zu beschützen gegen die Feinde, die nur darauf warten, Euch Euer Hab und Gut zu nehmen, Eure Frauen zu schänden und Eure Kinder zu töten.«
Rrrrratttatamm, rrrrratttatamm, rrrrratttatamm. Ein Trommelwirbel unterbrach die zündende Rede des Korporals. Er trug den blaugrauen Waffenrock der Infanterie. Die Farbe der Schulterklappe zeigten, dass er zum zweiten Armeekorps gehörte. Darunter hatte er eine grauschwarze Hose an, die in die Stiefel hineingesteckt war. Auf seinem Kopf trug er einen Tschako. Der Kinnriemen war hochgeklappt und lag auf der Oberseite des Tschakoschirms. Das Koppelschloss trug die Aufschrift Pro Gloria et Patria über einem Adler, der von der Seite zu sehen war und ein Schwert in seinen Klauen hielt. Seine beiden Begleiter waren ebenso gekleidet, doch hatten sie statt des Tschakos eine Pickelhaube, deren Vorderseite der preußischen Adler zierte, auf dem Kopf. Vor dem Bauch trugen sie eine Trommel. Sie hing an weißen Gurten, die am Koppel befestigt waren und über die beiden Schultern führten.
»Gut genährt sehen sie aus«, rief Franz den anderen jungen Männern zu, die sich unterhalb des Pferdewagens, auf dem die Werber standen, eingefunden hatten und lachte. Die Jungen verfolgten das Treiben neugierig.
»Recht so Burschen! Bei der Armee bekommt Ihr täglich warmes Essen und auch im schlimmsten Winter und bei bitterster Kälte ist bei uns noch keiner erfroren.«
»Da ist was dran«, meinte Gustav.
»Ich glaub, ich lass mich werben.«
»Für jeden, der sich heute einschreibt, gibt es fünf Taler extra. Hört genau hin. Fünf Taler für jeden, der jetzt und hier bei mir seinen Eintritt in die stolze preußische Armee erklärt und mit uns geht.«
»Fünf Taler. Das ist mehr als ich für einen ganzen Monat harte Arbeit bekomme«, sagte Gustav.
»Ich geh.«
»Was wird der Herr sagen?« Franz schaute ängstlich drein.
»Erfreut wird er nicht sein, wenn er hört, dass Du Dich freiwillig gemeldet hast. Geh nicht Gustav. Eingezogen wirst Du noch früh genug.«
»Sicher Franz. Aber guck uns doch an! Wann hast Du zuletzt was Richtiges gegessen? Immer nur Kartoffelschalen und Salzheringe und manchmal trockenes Brot. Mutter ist vor vier Jahren an Hungertyphus gestorben. Sterben kann ich überall, und wenn‘s bei den Soldaten ist.« Gustav hob, noch etwas zaghaft, die Hand. »Da, Leute, seht her«, hörte er den Korporal schreien. Seine Stimme überschlug sich.
»Da ist ein kluger Kopf. Komm her zu mir, komm hier herauf.«
Er streckte Gustav seine Hand entgegen. Der ergriff sie und stand kurz darauf auf dem Wagen, wo er dem Vierten im Bunde seinen Namen sagen musste.
»Kannst Du schreiben?« herrschte ihn der schreibende Uniformierte, nicht mehr ganz so freundlich wie der Korporal, an. Gustav nickte.
»Gut, dann schreib hier Deinen Namen hin. Aber schmier nicht.«
Gustav schrieb seinen Namen, wie er es in der Volksschule von Reichenbach gelernt hatte, an die Stelle, die ihm die dicken Finger des Schreibsoldaten zeigten. Er drehte sich um und blickte zu Franz. Für einen Moment durchzuckte ihn der Gedanke, er könne vielleicht doch einen Fehler begangen haben; doch dann dachte er an die fünf Taler in seiner Tasche. Gustav war Soldat in Preußens Armee.
»Kompanie antreten!« Gustav schreckte aus seinem Halbschlaf und seinen Gedanken hoch.
»Raus! Aber ein bisschen plötzlich!«
Der Korporal riss das Zelt auf. Draußen war es noch dunkel. Gustav suchte seine Sachen zusammen und zog sich an. Sein Schädel brummte vom gesüßten Rum, den sie am Abend zuvor bekommen hatten. Die erfahrenen Soldaten wussten, was das bedeutete. Am nächsten Tag würden sie in die Schlacht ziehen.
Als Gustav fragte, worum es denn in der Schlacht ging, wurde er aufgeklärt.
»Leg Dich hin und schlaf, Kleiner. Morgen wirst Du schon sehen, worum es geht.«
Es war kalt für einen Sommertag. Mit ihm schlurften die anderen seiner Kompanie durch den Buchenwald der Lichtung zu. Es war der Morgen des 3. Juli 1866. Alles war feucht vom nicht enden wollenden Regen. Aus den feuchten Niederungen der Bistritza stieg Nebel empor. Nach einem kurzen Appell marschierten sie los. Der Morgen graute allmählich. Trotzdem hatte es den Anschein, als wollte die Sonne diesen Tag nicht zum Leben erwecken. Heftige Windböen peitschen über die Auen und bliesen den Soldaten den Regen ins Gesicht. Unerbittlich wurden sie von den Unteroffizieren und Feldwebeln angetrieben. Die Feuchtigkeit des Regens machte ihre Klamotten klamm. Der Uniformrock klebte auf dem Hemd und war inzwischen schwer wie Blei. Bei jedem Schritt versanken die Soldaten bis zu den Knöcheln im Dreck. So marschierten sie am Südufer der Bistrica entlang in Richtung Sadowa; ihrem Feind entgegen. Der Nebel versperrte ihnen den Blick auf das gegenüberliegende Ufer der Bistritza, wo die Österreicher auf sie warteten. Noch waren sie durch den Fluss getrennt, aber die Brücke von Sadowa war schon in Sicht, und über diese Brücke führte die Straße in Richtung Chlum und dann weiter nach Königgrätz. Dort würden sie auf die Österreicher treffen.
Plötzlicher Kanonendonner riss Gustav aus seiner Lethargie. Darauf Schüsse aus Gewehren. Unter wildem Geschrei fielen die ersten, getroffen von Kugeln aus österreichischen Gewehren oder von Splittern der Granaten der österreichischen Artillerie. Die Getroffenen krümmten sich auf dem Boden. Die Schreie der Sterbenden oder Zerfetzten drang in Gustavs Ohren wie das Inferno der Hölle.
»Vorwärts, vorwärts, los, wollt ihr wohl los. Zur Brücke, zur Brücke!«, riefen die Offiziere. Sie rannten und rannten, ohne auf die Schüsse zu achten, die um sie herum einschlugen, auf die Brücke zu. Auf der gegenüberliegenden Seite sahen sie schemenhaft im Nebel die österreichische Infanterie, die mit ihnen gleichauf lief, nur durch die Bistritza getrennt, und sie über das Flüsschen hinweg beschoss. Als sie auf Höhe der Brücke waren, steigerte sich das Gewehrfeuer von der österreichischen Infanterie, die sich nun auf der Nordseite der Brücke verschanzt hatte, zu einem todbringenden Inferno. Die österreichischen Stellungen bestanden aus einer Reihe von Höhen, welche den Raum zwischen Bistritza, Elbe und Trotina ausfüllten. Der nach Westen gerichtete Teil der Front verlief hinter der Bistritza. Das Überschreiten der Bistritza und der Trotina war wegen des morastigen Talgrunds nur der Infanterie möglich. Deshalb hatte die zweite Armee den Auftrag, Sadowa und die Brücke über die Bistritza zu nehmen und für die Kavallerie und Artillerie zu sichern. Vorher konnte die preußische Artillerie nicht nachhaltig eingesetzt werden. Die auf den beherrschenden Höhen nördlich der Bistritza in Stellung gegangene österreichische Artillerie hatte dagegen eine hervorragende Stellung. Pausenlos feuerte sie auf die sich südlich der Bistritza vor der Brücke konzentrierende preußische Infanterie. Gustav gehörte mit seiner Kompanie zu der preußischen Spitze, die sich Sadowa näherte und als erste unter das Feuer der österreichischen Batterien geriet. Er stürmte, angetrieben von den Offizieren und Unteroffizieren, mit seinen Kameraden trotz der um sie einschlagenden Artilleriegranaten auf die Brücke zu. Schwer getroffen fielen die ersten zu Boden. Die Brücke war aus Holz und etwa fünf Meter breit. Ein gefährliches Nadelöhr für jeden, der bei dem feindlichen Feuer darüber musste. Schießen, laden, schießen, laden, und vor, vor. Gustav rannte auf die Brücke, als er das sirrende Pfeifen und den dumpfen Knall einer neben ihm einschlagenden Granate spürte. Er warf sich hin und suchte Schutz und Deckung hinter einem gefallenen Soldaten. So ist mancher auf der Brücke mehrmals gestorben. Zuerst, als er über die Brücke stürmend vom Abwehrfeuer der Österreicher niedergestreckt wurde, und dann, als sein toter Körper als Deckung für einen Nachfolgenden herhalten musste. Die Österreicher kämpften verbissen, konnten aber die Brücke nicht halten. Der erste Strom preußischer Soldaten ergoss sich auf das nördliche Bistritzaufer. Die Österreicher mussten ihre Stellungen aufgeben und strebten ungeordnet die Hügel hinauf nach Norden, um hinter den Artilleriestellungen Schutz zu suchen. Das Schlachtfeld war übersät mit Toten und Verwundeten. Sie lagen dort mit aufgerissenen Bäuchen oder verstümmelten Gliedmaßen. Sie flehten um Hilfe; doch keiner kümmerte sich um sie. Wer fragt die Opfer. Im infanteristischen Kampf hatten sich die Preußen einen Vorteil erkämpft. Das lag auch an ihrer technischen Überlegenheit. Vor ein paar Jahren war die Infanterie mit dem modernen Zündnadelgewehr ausgerüstet worden, das von hinten mit einer Patrone geladen wurde und eine deutlich höhere Feuergeschwindigkeit gegenüber dem veralteten Vorderladergewehr der österreichischen Füsiliere brachte. Auf einen Schuss eines Österreichers kamen mindestens drei Schüsse eines Preußen, und, was bei dem Sauwetter an diesem Morgen noch wichtiger war, das Zündnadelgewehr konnte in jeder Lage geladen werden, wohingegen beim Laden des Vorderladergewehrs der österreichische Infanterist stehen musste. Trotzdem hatte der erbitterte Kampf auch bei den Preußen seinen Blutzoll gefordert. Die Brücke war übersät von Leichen, und das Sterben nahm kein Ende, denn die österreichische Artillerie verstärkte ihre Kanonade noch. Mit ihren 160 Geschützen auf der Höhe zwischen Lipa und Langenhof hatten sie eine mächtige Artillerielinie in Stellung gebracht, die den preußischen Angriff der Infanterie zum Erliegen bringen konnte. Ohne Unterstützung der preußischen Artillerie über das Bistritzatal hinweg war an ein Nachsetzen der Preußen nicht zu denken. Gustav schaute zurück. Wann würden die Geschütze kommen und helfen, dem Inferno ein Ende zu bereiten? Sie hatten zwar das nördliche Ufer der Bistritza erreicht; aber es gab kein Weiterkommen, und sie waren einem Gegenangriff der Österreicher hilflos ausgesetzt. Gustav lag am Ufer des kleinen Flusses und wartete darauf, dass die preußische Artillerie in Stellung gebracht werden würde. Die Infanterie der Österreicher hatten sie zwar erst einmal zurückgedrängt, doch das Schlachtfeld lag offen für die Kanoniere der Artillerie, und die nutzten ihren strategischen Vorteil. Sie überzogen die Stellungen der Preußen mit einer unmenschlichen Kanonade. Die Granaten schlugen unaufhörlich ein. Von Splittern zerfetzte Soldaten dezimierten Gustavs Kompanie immer mehr. Schon versuchten die ersten preußischen Soldaten, über die Brücke wieder zurück auf das sicherere Ufer zu laufen, um dem Artilleriebeschuss zu entkommen, doch dort trafen sie auf den Strom derer, die, von ihren Offizieren angetrieben, Gustav über den kleinen Fluss nachfolgen sollten. So entstand auf der Brücke ein Stau. Einige stürzten über das Geländer in die Bistritza und ertranken jämmerlich. Andere wurden erdrückt. Wer auf der Brücke stürzte wurde tot getrampelt. Die preußische Artillerie bemühte sich, Artilleriegeschütze in Stellung zu bringen, doch jeder Versuch scheiterte unter den Einschlägen der Granaten der österreichischen Artillerie, die wahllos ihre Opfer unter den Menschen und Zugpferden fanden. Pferde, die gerade noch die schweren Lafetten gezogen hatten, stoben davon, befreit von der Last der Kanone, die, durch eine Granate getroffen, umgestürzt, sich von den Deichseln gelöst hatte. Die Pferde, fast wahnsinnig vor Angst von dem Inferno der einschlagenden Granaten und des Kanonendonners, rannten los, jedes in eine andere Richtung, was aber nicht ging, da sie durch das Zaumzeug des Wagens, der jetzt hinter ihnen lag, aneinander gebunden waren. Sie überschlugen sich, brachen sich die Knochen oder rannten in nicht mehr zu beherrschender Panik ziellos umher. Dabei überrannten sie alles, was ihnen in den Weg kam. Pferdekörper begruben Soldaten. Die Schreie Getroffener oder von den Pferden zermalmter Menschen vermischte sich mit dem Wiehern der geschundenen Pferde sowie dem Kanonendonner und dem Geräusch der einschlagenden Geschosse zu einer Horrorsymphonie.
Offiziere versuchten, Ordnung in das Chaos zu bekommen. Sie gaben Befehle, schlugen oder traten zu, um ihren Anordnungen mehr Nachdruck zu verleihen; aber alles Bemühen war zwecklos. Gustav machte kehrt und rannte erneut der Kanonade entgegen. Etwas ratlos lief er über die Brücke und sprang an deren Ende in die Uferböschung. Geschützt durch Bäume und hoch gewachsene Büsche und Sträucher fand er eine Stelle, die ihm für den Augenblick geeignet schien. Er warf sich hin und verharrte. Nach und nach kamen immer mehr Soldaten hinzu, die es auch geschafft hatten, lebend über die Brücke zu kommen. Unter größten Verlusten gelang es den Preußen im Verlauf des Tages, die Brücke zu sichern und die Artillerie in Stellung zu bringen. Der Fluss war rot gefärbt vom Blut der gequälten Seelen, die nicht einmal wussten, wofür sie ihren Blutzoll geleistet hatten. Die österreichische Artillerie beherrschte noch das Geschehen. Sie feuerte Salve auf Salve; doch die preußischen Soldaten, unbarmherzig angetrieben von ihren Vorgesetzten, hielten ihre Stellungen. Gustav lag im Dreck und hoffte. Fünf Stunden ging das nun schon so. Wollen die denn überhaupt nicht mehr aufhören? Gustav war am Ende. Er lag mit seinen Kameraden vom 21. Infanterieregiment am Rande eines kleinen Wäldchens direkt oberhalb der Uferböschung, an einer Stelle, wo die Bistritza einen Knick nach rechts macht. Dichte Sträucher von Holunder gaben ein wenig Schutz vor den Augen der österreichischen Artilleristen, aber nicht vor deren Granaten. Er spähte über die leicht ansteigenden Auen der Bistritza den Hügel hinauf. Dort war er, der Feind. Er wusste nicht, warum die Österreicher Feinde waren. Er hatte noch nie mit einem gesprochen, aber ihr Korporal
hatte ihnen gesagt, dass es nun endlich gegen die verdammten Österreicher ging, und der musste es ja wissen. Gustav verlor das Gefühl für die Zeit. Das Warten zerrte an den Nerven. Die Einschläge der Granaten ließen nicht nach. Es war kaum möglich, seine Nase zu heben. Die Artillerie der Österreicher feuerte aus allen Rohren. Bäume stürzten um, zerfetzt von den Granatsplittern wie die Soldaten darunter. Seine Mutter hatte ihn immer gewarnt.
»Geh nie zu den Soldaten«, hatte sie gesagt. Sie war überhaupt eine kluge Frau, hatte sich Tag für Tag für ihn und Martha abgemüht. Aber sie konnte noch so viel arbeiten; es reichte nur für das Allernotwendigste. Tränen füllten seine Augen, als er an seine Mutter dachte. Für einen Augenblick vergaß er seine Umgebung und versank in seine Kindheit. Mutter war schön. Schwarzes Haar, schlanke Hände, denen man nicht ansah, dass sie jeden Tag schwere Arbeit verrichten mussten, und einen großen Mund mit herrlichen roten Lippen. Wenn sie ihn küsste, versank er in ihr, obwohl sie seine Mutter und er ein kleiner Junge war. An seinen Vater konnte er sich nicht mehr richtig erinnern. Er war noch zu klein, als er starb. Mutters Grab hatte er lange nicht mehr besucht. Wo Martha war wusste er nicht. Vermutlich auf Schwissnitz. Wenn er den Krieg überleben sollte würde er sie besuchen. Das nahm er sich fest vor. Gustav schreckte von einem Schmerzensschrei hoch. Neben ihm war eine Granate eingeschlagen und ein Splitter hatte dem Soldaten, der neben ihm im Morast lag, den Arm abgerissen, der nur noch an ein paar Fetzen Haut und dem Stoff der Uniformjacke hing. Alles war rot vom Blut, das aus der klaffenden Wunde spritzte. Der Soldat schrie und griff an die Stelle, an der er noch seinen Arm glaubte. Angsterfüllt blickte er umher, das Gesicht zu einer schmerzverzerrten Grimasse entstellt, doch keiner kam, um ihm zu helfen. Gustav konnte das nicht länger mit ansehen. Er kroch unter dem Granatenhagel zu ihm hinüber und packte ihn. Gemeinsam mit einem anderen Soldaten zog er ihn, selbst mehr rutschend als kniend, runter zum Fluss. Gustav suchte ein Tuch. Er fand sein Halstuch und tränkte es im kalten Wasser der Bistritza. Dann sprang er zurück zu dem Verwundeten. Sie rissen ihm den Rock auf. Als Gustav den abgerissenen Arm sah wurde ihm übel. Da, wo der Arm einmal mit der Schuler verbunden gewesen war, klaffte ein riesiges, blutendes Loch. Die Schulter existierte nicht mehr, und Gustav konnte in den Körper des Soldaten hineinsehen. Er presste den Lappen auf den blutigen Stumpf und schrie um Hilfe; aber vergebens. Sie legten den Verwundeten unter einen Busch und pressten weitere Lappen und Stofffetzen, die sie aus ihren Hemden herausrissen, auf die Wunde.
»Dem ist nicht mehr zu helfen«, hörte Gustav einen seiner Kameraden sagen. Der Soldat kroch wieder an den Platz unterhalb der Böschung, wo es sicherer war, als weiter unten am Flussufer.
»Wir können ihn doch hier nicht so liegen lassen.« Gustav schrie und drehte sich wieder dem Verwundeten zu. Immer und immer wieder bemühte er sich, die Blutung zum Stillstand zu bringen; aber vergebens. Das Blut spritzte in regelmäßigen Schlägen aus der Wunde.
»Komm Gustav, das ist nicht Deine Aufgabe«, rief ihm der andere Soldat zu. »Der verreckt eh.«
Doch Gustav wich nicht von der Seite des Verwundeten. Auf dem Gutshof hatte er schon einmal gesehen, wie bei der Ernte einer beim Aufladen des Heus unter ein Wagenrad gekommen war. Das sah fast genauso aus. Der Arm hing bei ihm auch nur an einem Hautfetzen und musste später ganz abgenommen werden. Der Vorarbeiter hatte dem Verletzten nasse Tücher in die Wunde gepresst und oberhalb der Wunde den Arm zusammengepresst, bis der Arzt da war. Gustav versuchte dies auch, so gut er konnte. Durch die Kompresse ließ der Blutstrom auch etwas nach; aber zum Stillstand konnte Gustav ihn nicht bringen.
»Ich heiße Platje, Johann Platje aus Neiße. Sag meiner Mutter, wo ich liege. Bitte, sag es ihr. Sie soll zumindest wissen, wo ihr Sohn gestorben ist.«
Er röchelte nur noch. Gustav beugte sich über ihn, um ihn besser verstehen zu können.
»Ruhig Johann, Du wirst nicht sterben. Gleich wird Hilfe kommen.«
Aber Johann nahm die Worte nicht mehr wahr. Seine Augen waren bereits leer und ohne Lebenshoffnung. Gustav legte seinen Arm unter Johanns Schulter und hob seinen Kopf. Er merkte, wie das Leben Johann verließ und dass seine Bemühungen nichts geholfen hatten. Johann verblutete am Ufer der Bistritza wie viele andere auch.
Es gab seit dem Gemetzel bei Solferino 1859, bei dem 30000 Soldaten getötet wurden und weitere 40000 wegen schlechter Versorgung starben, Sanitätssoldaten, die unter dem besonderen Schutz des Roten Kreuzes die Verwundeten versorgten; aber es waren noch viel zu wenige und so lange die Kampfhandlungen im Gange waren, war an eine wirksame Hilfe für die Verwundeten kaum zu denken.
Gegen Mittag hörte die Kanonade auf. Ganz unvermittelt herrschte Ruhe. Kein Getöse und Gedonner.
»Die Österreicher!« Der Ruf elektrisierte den verdreckten Haufen. Gustav spähte über den Rand der Böschung. In Reih und Glied und schritten die österreichischen Infanteristen, die Fahne voran, in geschlossener Formation auf sie zu. Die Trommler wirbelten mit den Stöcken und marschierten mit gleichmäßigem Trommelschlag los. Ob sie wollten oder nicht, jeder wurde vorwärts gedrückt. Vorweg die Fahnen der Einheiten, getragen von den Fähnrichen. An ihrer Seite die Fahnenjunker. Dann die Soldaten. Zwischen den Kompanien marschierten die Chargierten und die Trommler. Schritt für Schritt, Trommelwirbel für Trommelwirbel schoben sich die Österreicher mit aufgepflanzten Bajonetten heran. Die preußische Artillerie schoss mit ihren Kanonen in die voranschreitenden Österreicher hinein. Nach jedem Einschlag lichteten sich die Reihen, doch die aufgerissenen Lücken wurden durch Soldaten aus den folgenden Reihen sofort geschlossen. Auf Befehl kniete die erste Reihe hin, die zweite stand aufrecht dahinter, und feuerten aus ihren Gewehren. Wer Anzeichen machte, zurück zu weichen, wurde von nachfolgenden Offizieren nach vorn in die Reihen zurück geprügelt. Manche der Getroffenen fielen wortlos, andere gaben noch ein paar gurgelnde Laute von sich. Wieder andere stürzten unter lautem Schreien und jammerten, wenn die Nachfolgenden über sie hinweg den Preußen entgegen marschierten. Das Schlachtfeld war ein einziges Schreien und Stöhnen, doch der Kanonendonner und das Knallen der Gewehre überdeckte alles. Noch lag Gustav mit seinen Kameraden im Schutz der Uferböschung. Doch dann kam der Befehl, sich mit aufgepflanztem Bajonett zu einer geschlossenen Formation aufzustellen.
»Feuer!« Gustav schoss in den Pulk der sich auf ihn zu bewegenden Leiber hinein. Die Gewehrsalven der Preußen rissen noch mehr Lücken bei den Österreichern. Gustav schoss, getrieben von der Angst um das eigene Überleben. Immer und immer wieder ohne darüber nachzudenken, was er tat.
Die preußischen Infanteristen schossen und schossen, und die Österreicher fielen und fielen; doch sie schritten weitger vorwärts. Die Bajonette blitzten furchterregend. Wenn es ihnen gelänge, so nah ran zu kommen, dass sie Mann gegen Mann mit den Bajonetten kämpfen konnten, war der Vorteil der Preußen durch das neue Gewehr verloren. Gustav konnte nicht mehr denken. Er konnte nur noch laden und schießen, doch die Menschenwand schien trotz der ungeheuerlich Vielen, die gefallen waren, nicht abzunehmen. Dann prallten die Soldaten mit der Wucht ihrer Todesangst aufeinander. Keine Zeit mehr zum Schießen. Gustav hatte sein Bajonett aufgepflanzt. Mann gegen Mann kämpften sie verbissen um ihr Leben. Es wurde mit dem Bajonett gestochen, geschlagen und gestoßen. Ein unbeschreibliches Gemetzel war im Gange. Gustav stolperte und fiel. Vn der Seite sah er einen österreichischen Füsilier auf sich zulaufen, das Bajonett zum tödlichen Stoß auf ihn gerichtet. Gustav sprang auf, drehte sich und hob sein Gewehr zur Abwehr. Aber es war zu spät. Das Bajonett hatte sich bereits in ihn gebohrt. Er knickte ein und fiel. Auf dem Rücken liegend sah er, wie der österreichische Füsilier zum tödlichen Stoß ausholte. Er erwartete seinen Tod, doch der blieb aus. Er öffnete seine Augen und sah, wie der Österreicher zusammenbrach; tödlich getroffen von einem Bajonettstoß.
Gustav durchzuckte ein stechender, höllischer Schmerz. Dann verlor er das Bewusstsein.
Als Gustav wieder zu sich kam herrschte Ruhe, himmlische Ruhe. So musste es im Himmel sein, dachte er. Kein Kanonendonner, keine Schreie tödlich Verletzter. Ängstlich vor dem, was er sehen würde, zögerte er einen Augenblick, bevor er die Augen aufschlug. Regen fiel in sein Gesicht. Es war ihm nicht bewusst, wie lange er schon hier lag. Es war kalt, und es war Nacht. Gustav fror. Er stöhnte vor Schmerzen. Doch er war nicht der einzige. Um ihn herum lagen die Opfer der Schlacht. Tote und Verwundete. Manche waren so schlimm verwundet, dass sie sich den Tod als Erlösung herbeisehnten. Das Klagelied der so sehr Gepeinigten klang durch die Dunkelheit, und es machte keinen Unterschied, ob die Klagen eher österreichisch oder mehr preußisch klangen. In ihrem Elend waren sie alle eins. Keine Feinde mehr, nur noch arme Kreaturen, die um ihr Leben zitterten und sehnlichst auf eine barmherzige Seele warteten, die ihnen ihre Not ein wenig linderte oder sie von ihren Leiden befreite.
Gustav wusste nicht mehr, welchen Tag sie hatten. War das Gemetzel erst gestern gewesen? Es lag schon so weit zurück, und doch, seine Verwundung erinnerte ihn daran, dass alles erst vor ganz kurzer Zeit geschehen sein musste. Er tastete seine Wunden ab. Ein tiefes Loch war in seiner Hüfte. Seine Hand suchte unsicher nach dem Schmerz in seinem rechten Bein. War es noch dran? Er wollte sein Bein zu heben. Es ging nicht. Der Schmerz drohte ihm das Bewusstsein zu nehmen. Gustav atmete tief durch. Brandgeruch drang in seine Nase und verursachte ihm Übelkeit. Vorsichtig versuchte er, seine Umwelt zu erkunden. In der Dunkelheit erkannte er schemenhaft Gestalten, die über das mit Körpern übersäte Schlachtfeld liefen. Manchmal bückten sie sich, um zu hören, ob einer noch atmete. Wenn sie jemanden gefunden hatten, der noch lebte, trugen sie ihn auf einer Bahre weg. Wann würden sie bei ihm sein? Würden sie ihn überhaupt finden? Schüttelfrost erfasste seinen ganzen Körper. Seine Kehle hatte der Durst ausgetrocknet. Er fühlte sich jämmerlich. Seine notleidende Seele öffnete seinen Mund zu einem Ruf nach Hilfe, jedoch erstickte die Stimme, bevor ein Laut seinen aufgerissenen Mund verlassen hatte. Dann verlor er wieder das Bewusstsein. So dämmerte er dahin.
Das spärliche Licht einer Petroleumlaterne erfasste sein Gesicht. Ganz allmählich wurden Konturen eines Mannes deutlich. Er blickte auf Gustav hinunter. Die dunkle Stimme mit dem schlesischen Tonfall beruhigte ihn.
»Er hat viel Blut verloren. Aber Glück hat er gehabt. Wäre das Bajonett nicht am Hüftknochen abgeglitten, hätte es ihm seine Eingeweide zerfetzt. Das heilt wieder. Da sieht das Bein viel schlimmer aus. Wenn der Wundbrand sich nicht bessert müssen wir morgen amputieren.«
Gustav schloss die Augen. Ohne Bein, was mach ich ohne Bein? Seine Gedanken kreisten um diesen einen Gedanken. Er nahm die ganz Kraft, die sein Körper noch hatte, und richtete sich an den Arzt.
«Wie lange bin ich schon hier?«
»Zwei Tage«, antwortete der Feldarzt, ein großer Mann von etwa fünfzig Jahren. Dazu lächelte er sanft, was man in dieser Umgebung nicht unbedingt erwarten konnte.
»Du hast zwei Tage und zwei Nächte auf dem Schlachtfeld gelegen. Da ist Dreck in die Wunde gekommen. Es eitert. Du wirst sterben, wenn wir das Bein oder einen Teil davon nicht abnehmen.«
»Aber was soll ich denn ohne Bein tun?«
Ich war Ziegler, bevor ich Soldat wurde und muss laufen können.«
»Das ist jetzt nicht so wichtig. Du musst Dich entscheiden. Bein ab oder tot!«
Er machte mit den Händen eine Hilflosigkeit ausdrückende Bewegung. Dann wandte er sich ab und ging. Gustav drehte sich um. Zu seiner Linken lag ein Mann auf einem Strohlager wie er. Ihm fehlte ein Arm. Der Kopf war verbunden. Durch den Verband drang Blut, so dass sich der Verband inzwischen rot gefärbt hatte. Eine Granate, hörte er den anderen sagen. Leere Augen starrten ihn an. Jeder hat sein Schicksal. War das Leben mit nur einem Bein meines? Gustav wandte sich ab. Morgen würde er operiert werden.
Am nächsten Morgen kam ein Mann zu ihm und brachte ihm eine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit darin. Er gab sie Gustav und forderte ihn auf, daraus zu trinken. Gustav setzte an. Schnaps. Wieso bekam er Schnaps?
»Trink aus«, sagte der Überbringer der Flasche. Gustav tat, wie ihm geheißen. Ein warmes Gefühl durchströmte ihn. Es ging von seinem Magen aus und erfasste ihn bis in die Füße und Hände. Selbst die Zehenspitzen fühlten sich warm an. Seine Wunden schmerzten nicht mehr und in seinem Kopf wurde alles leicht. Plötzlich kamen drei weitere Männer hinzu. Einer drückte ihm den Körper auf den Strohsack, ein anderer packte sein linkes Bein und hielt es so fest, dass er es nicht mehr bewegen konnte. Der Schnapsbote schob ihm einen Lederriemen zwischen die Zähne und drückte seine Schultern auf den Strohsack, in dem er sich von hinten mit seinem Gewicht auf Gustavs Schultern wuchtete. Der vierte Mann ergriff mit der Linken Gustavs Bein in Höhe des Knies und mit der Rechten setzte er die Säge etwa zehn Zentimeter unterhalb des Knies an. Erst wollte Gustavs Gehirn nicht wahrhaben, was er spürte. Dann wurde es für ihn zur Gewissheit. Die Säge zerteilte seinen Unterschenkelknochen. Erst hörte er das Geräusch der Säge in den Händen des Arztes. Dann hörte er nur noch seine Schreie. Und dann hörte er nichts mehr.
Zeit kann wie eine Ewigkeit vergehen. Gustav tobte, wandte sich vor Schmerzen, jammerte, versuchte den Sägenmann abzuschütteln und biss in seiner Verzweiflung auf den Lederriemen. Dann hörte das Geräusch von Zersägen von Haut, Muskelgewebe und Knochen auf. Gustav wehrte sich nicht mehr. Die Wunde wurde verbunden, um die Blutung zu stillen.
»Wenn die Blutung zum Stillstand kommt, wird er überleben«, drang es an sein Ohr.
»Verbindet ihn heute Abend noch einmal. Morgen sehen wir weiter.«
Die Ärzte gaben sich Mühe, die vielen Verwundeten zu versorgen, aber sie waren viel zu wenige. Äther war gerade für die Anästhesie entdeckt worden, doch es war zu teuer für die Verwendung im Feldlazarett nur ein paar Meilen hinter den Schlachtfeldern. Die medizinische Versorgung der Verwundeten hatte sich durch die Einrichtung von Feldlazaretten gegenüber früheren Zeiten schon wesentlich verbessert, denn vor Gründung des Roten Kreuzes ein paar Jahre zuvor bedeutete eine Verwundung, bei der man sich nicht selbst helfen konnte, eine Überlebenschance von höchstens fünfzehn, bei inneren Verletzungen gar nur von einem Prozent. Jetzt war der königlich preußische Sanitätsdienst Stolz darauf, dass mehr als vierzig Prozent der Verwundeten überlebten. Die Zeit im Lazarett verging langsam. Gustav lag auf seinem verlausten Strohlager und wartete darauf, endlich nach Hause zu können. Aber wo ist mein zuhause? Was soll ich tun auf dem Gutshof? Je mehr er über sein Schicksal nachdachte, desto verzweifelter empfand er seine Lage. Am Morgen des zwölften Tages seines Aufenthaltes im Lazarett kamen zwei Helfer, die ihn auf eine Trage hoben und aus dem Zelt brachten. Dort beschied man ihm, aufzustehen. Gustav stand, gestützt auf die beiden Helfer, auf. Er stand auf einem Bein. Seine Hose zierte ein großer gelber Fleck. Urin. Wo hätte er pinkeln sollen? Von Zeit zu Zeit war jemand gekommen, der ihm raus geholfen hatte. Aber meistens war er auf sich alleine angewiesen. In den ersten Tagen nach der Beinamputation ging gar nichts. Er konnte sich nicht bewegen und pinkelte einfach in die Hose. Später rutschte er auf dem Bauch raus aus dem Zelt und urinierte im Liegen neben das Zelt. Dies war auch seine Lösung des Problems, wenn sich sein Stuhlgang meldete, obwohl dies bei Wassersuppe und einem Kanten Brot täglich nicht so oft vorkam. Die Helfer hoben ihn auf einen Karren.
»Jetzt geht‘s heim”, beschieden sie ihm und überließen ihn seinem Schicksal. Er suchte sich auf dem Wagen einen Platz. Da saß er nun, umgeben von ebenso zerlumpten Kreaturen, notdürftig verbunden, unrasiert und verlaust.
Der Karren, auf den sie verfrachtet worden waren, rumpelte auf den ausgefahrenen Wegen in Richtung Schlesien. Wagen auf Wagen, gezogen von den Pferden, die gestern noch vor die Geschützlafetten gespannt waren, bildete einen fast endlosen Zug. Anfangs waren die Spuren der Kriegshandlungen nicht zu übersehen. Zerstörte Dörfer säumten ihren Weg. Häuser, die einst Familien eine Bleibe und ein Zuhause gegeben hatten, standen ohne Dächer da. Löcher in den Wänden legten Zeugnis ab von den Kanonaden, denen die Häuser schutzlos ausgeliefert gewesen waren. Verkohlte Holzbalken hingen vom Dachstuhl herunter und Vieh lag tot neben den Häusern, hingerichtet von der Zerstörungswut der Soldaten. Es war ein bizarres Bild, das sich den Soldaten auf den Wagen bot. Je weiter sie sich von den Kriegsschauplätzen entfernten wurde das Landschaftsbild freundlicher. Ausgedehnte Felder, auf denen das Getreide in voller Größe auf die Ernte wartete, lösten sich mit sattgrünen Weiden ab, auf denen Kühe und Pferde weideten. In den schlesischen Dörfern hielten die Menschen inne und schauten dem vorbeiziehenden Tross zu. Frauen und Kinder brachten Eimer mit Trinkwasser, und auch Gustav nahm dankbar etwas Wasser und trank. In der Menge stand ein Uniformierter, vielleicht der Dorfpolizist, der seine Begeisterung laut hinausposaunte.
»Der Krieg ist vorbei. Wir haben gesiegt. Österreich ist geschlagen. Es lebe König Wilhelm!«
Gustav rief dem Polizisten mit seiner Pickelhaube, der ihnen die freudige Botschaft zugejubelt hatte, zu.
»Was wird jetzt? Gibt es jetzt keinen Hunger mehr?«
»Was?« schaute ihn der Angesprochene ungläubig an.
»Jetzt kann Deutschland neu entstehen, ein einig Vaterland.« Gustav sah auf seinen Stumpf. Deutschland. Er hatte noch nie davon gehört. Deutschland musste etwas Großartiges sein.
Bei jedem Schlagloch durchzuckte Gustav ein Schmerz an seiner noch nicht verheilten Wunde. Nach vier Tagen erreichten sie ihr Ziel. Ihm war es wie eine Ewigkeit vorgekommen. Sie mussten vom Wagen runter und wurden angewiesen, sich in eine lange Schlange einzureihen. Da standen sie nun, die Sieger von Königgrätz und gleichzeitig die Unglücklichen der glorreichen preußischen Armee. Ein Bild des Elends. Die meisten trugen noch Verbände. Vielen fehlten Gliedmaßen. Kaum einer, der nicht eine Krücke brauchte. Es stank nach abgestandenem Schweiß und eingetrocknetem Urin. Es regnete nicht mehr. Fliegen schwärmten in der Sommerhitze umher und Mücken labten sich an den verkrusteten Blutverbänden. Die Wartenden hatten seit Tagen nichts Vernünftiges mehr gegessen. Während ihrer Fahrt vom Lazarett zur Kommandantur in Reichenbach hatte man ihnen jeden Tag eine gekochte Kartoffel und eine Scheibe Brot gegeben. Dazu einen Becher gefüllt mit Zichorie, die so dünn war, dass man ohne Mühe bis auf den Boden des Holzbechers sehen konnte. Kaum ein Tag verging, an dem nicht einfach einer an Schwäche umfiel und nicht mehr aufstand. Es kümmerte auch keinen sonderlich. Die Schwächsten und die mit den schlimmsten Verwundungen hielten diese Tortur nicht lange aus. Gustav hatte es überstanden und war angekommen. Langsam bewegte sich die Schlange in Richtung auf einen Tisch zu. Gustav humpelte an einer Krücke mit, in den Augen ein Blick, in dem sich seine ganze unendliche Mutlosigkeit widerspiegelte.
»Name, Einheit?« herrschte ihn der Sergeant hinter dem grob gezimmerten Tisch an.
»Gustav Szlapszy, 21. Infanterieregiment.« Gustavs Stimme war leise, bedrückt und entmutigt. Er war mit zwanzig Jahren ein Krüppel. Was sollte er anfangen? Welche Arbeit konnte er noch verrichten?
»Wo kommst Du her? Was hast Du gemacht?«
»Ich komme vom Gut Schwissnitz. Habe dort auf dem Gut gearbeitet.«
»Was hast Du da gemacht?«
»Hilfsschnitter:«
»Du warst also Hilfsknecht?«
»Ja, anfangs, als ich acht war. Dann war ich Lorenkutscher in der Ziegelei.«
Er machte eine Pause, so als wenn er nachdenken müsste. Dann ergänzte er.
»Und sonst war ich bei den Pferden.«
»Bei den Pferden? Ausmisten und Einstreuen? Oder sonst noch was?«
»Striegeln, Anschirren und auf die Weide bringen, wenn der gnädige Herr es befahl.«
»Aha. Kannst Du schreiben und lesen?«
»Ja, ich war sechs Jahre auf der Schule in Reichenbach.« Der Sergeant nahm ein Formular und schrieb Gustavs Namen darauf. Dann stempelte er es ab, unterschrieb es und reichte es Gustav.
»Melde Dich bei der Verwaltung von Gut Kuckau. Du bist jetzt ein Veteran der königlich preußischen Armee.« Gustav wusste nicht, was dies zu bedeuten hatte. Der Sergeant sah seinen fragenden Blick.
»Als preußischer Veteran erhältst Du eine Kate auf Gut Kuckau und dort wirst Du auch Arbeit bekommen. Danke Deinem König. Du siehst, er meint es gut mit seinen Soldaten.«
Er machte eine Handbewegung, die Gustav nicht daran zweifeln ließ, dass er jetzt weg zu treten hätte. Gustav humpelte auf seiner Krücke davon; in eine ungewisse Zukunft.