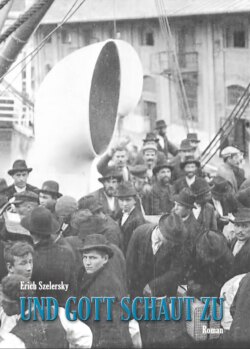Читать книгу Und Gott schaut zu - Erich Szelersky - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hungerjahre
Оглавление»Der Hunger hat uns hierher getrieben, nur der Hunger. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas gestohlen.«
Seit ihrer Ankunft auf Gut Schwissnitz waren einige Jahre vergangen. Gustav schaute den Polizisten mit traurigen Augen an. Sie hatten ihn festgenommen. Jetzt saß er auf einem Holzstuhl auf der Wache und wartete darauf, vernommen zu werden. Aufruhr, Landfriedensbruch, Einbruch und Diebstahl waren schwere Anschuldigungen. Dafür konnte es mehrjährige Zuchthausstrafen geben, selbst für Kinder, denn Strafverschonung wegen Minderjährigkeit gab es nicht. Auf der Wache herrschte reger Betrieb. Die Polizei hatte, unterstützt vom Militär, die Aufruhr niedergeschlagen und die Menschenmenge zur Räson gebracht. Etwa hundert hatte man verhaftet. Einer von ihnen war Gustav. Nach endlosem Warten wurde er in einen Raum geführt und aufgefordert, sich zu setzen.
»Gut«, sagte der Polizist, »dann erzähl mal. Wie alt bist Du?«
»Vierzehn.«
»Wo lebst Du?«
»Auf Gut Schwissnitz.«
»Und was hast Du hier zu suchen?«
»Wir hatten nichts Böses im Sinn. Wir wollten nur etwas zu essen, vielleicht ein Stück Brot.«
Gustav war noch nie mit der Polizei in Berührung gekommen. Angsterfüllt vor dem, was ihn erwartete, erzählte er die Geschichte eines Jungen, den der Kampf ums Überleben in diese Situation gebracht hatte. Die Jungen des Gutes Schwissnitz hatten sich am frühen Morgen auf den Weg nach Waldenburg gemacht.
»Wenn wir nicht etwas Brot oder etwas anderes zu essen bekommen werden wir sterben, so wie all die anderen«, hatte Johann gesagt. Johann war sechzehn und damit schon einer der größeren Jungen auf dem Gut. Er arbeitete in der Ziegelei als Lorenkutscher. Das taten meist nur die Frauen; aber durch die Hungersnot und die Krankheiten starben zu viele von ihnen. Die Frauen waren die ersten, die starben. Für sie mussten die größeren Jungen die schwere Arbeit verrichten. Jede Familie hatte Opfer durch die Hungersnot und die damit einhergehenden Massenerkrankungen zu beklagen. Die von der schweren Arbeit ausgezehrten Menschen starben und mussten ersetzt werden. Dies taten die Kinder und oft waren Jungen schon mit zwölf Jahren die Hauptverdiener und Ernährer der Familien. Für die Schule blieb bei diesem Kampf ums nackte Überleben keine Zeit mehr. Gustav hatte viel Schlimmes gesehen. Jeden Morgen wurden die Toten aus den Häusern hinausgetragen und auf einem Wagen aus dem Dorf geschafft. Eingefallene Gesichter und aufgedunsene Bäuche hatten sie alle und die Körper waren mit Flecken übersät. Epidemisches Fleckfieber. Ausgemergelt wie sie waren hatten sie der grassierenden Seuche keine Abwehrkräfte entgegen zu setzen. Da der Krankheitsverlauf mit hohem Fieber und starkem Durchfall einherging hieß die Geisel, die sie ins Grab brachte, unter den einfachen Leuten allgemein Hungertyphus. Es war die blanke Not, die die Jungen trieb. In den letzten Jahren waren die Ernten ausgefallen. Angefangen hatte es vor drei Jahren damit, dass unaufhörlicher Regen das Korn auf den Feldern verfaulen ließ. Die Kartoffelernte fiel kläglich aus und die wenigen, die sie ernteten, waren klein wie Pflaumen und weich. Sie wurden nach der Ernte sofort an das Vieh verfüttert, denn Heu konnte nicht gemacht werden und das Vieh brauchte im Winter Futter. Auf den Gütern wurde zuerst das Vieh versorgt. Die Menschen mussten zurückstehen und erhielten nur im äußersten Notfall ein paar Kartoffeln. Das waren jedoch so wenige, dass sie vorne und hinten nicht reichten. Vor zwei Jahren hatte Hagelschlag die gesamte Ernte vernichtet, und im vergangenen Jahr ließ die Trockenheit das Getreide auf den Feldern verdorren, so dass es nicht einmal mehr geerntet wurde. Keine Ernte bedeutete aber auch keine Arbeit für die Landarbeiter und ohne Arbeit gab es keinen Lohn. Maria backte Brot aus Baumrinde, die klein gemahlen wurde. Im Sommer pflückten Gustav und Martha im Wald Beeren und Pilze. Aus Klee kochten sie Gemüse. Gustav bekam davon regelmäßig schlimmen Durchfall. Trotzdem aß er das heiße Wasser mit dem zerkochten Klee. Auch wenn ein heranwachsender Junge wie Gustav davon nicht richtig satt wurde, war das Leben im Sommer noch zu ertragen. Schlimmer waren die Winter. Es gab Rüben, die sie mittags gekocht aßen. Abends wurden die mittags übriggebliebenen Rüben aufgewärmt. Dieses Essen wechselte sich ab mit Erbsen oder Linsen. Fleisch gab es nie. Schon in Jahren mit normaler Ernte war Fleisch etwas, das es nur an den Hauptfeiertagen gab. In den Notjahren ging auch das nicht mehr. Die schlesischen Landarbeiter ernährten sich in diesen Jahren fast nur von Rum, den sie süßten, was verheerende Folgen für die Zähne hatte, die schon nach ein paar Jahren nur noch verfaulte, braune Stummel waren. Maria brachte manchmal ein paar Kartoffeln aus der Küche mit. Für zwei Pfennige kaufte sie dazu Heringslake beim Kaufmann. Gustav strahlte, wenn er eine gekochte Kartoffeln in die Lake tauchen und dann essen konnte. Das war seine Lieblingsspeise, denn oft genug musste er Haferschleim und Grießbrei essen, obwohl er beides nicht mochte und sich oft davon übergeben musste. Maria tat das leid, doch sie hatte nichts anderes. Es gab Nächte, in denen Gustav von Kartoffelsuppe träumte. Die war zwar so dünn, dass ihn der Hunger schon nach einer Stunde wieder quälte, doch schmeckte sie ihm und wenn genug da war aß er zwei Teller. Seine Mutter ließ ihn und verzichtete oft. Höhepunkte waren für Gustav allerdings Kartoffelpuffer. Maria wusste das und sammelte Kartoffelschalen in der Küche. Es gab die Anweisung, die Kartoffelschalen in einen Korb zu werfen und vor die Küchentür, die zu den Stallungen führte, zu stellen, wo sie von einem der Knechte abgeholt und an die Schweine verfüttert wurden. Maria zweigte beim Schälen einige ab und versteckte sie bis zum Abend in ihrer Schürze. Wenn sie genügend zusammen hatte gab es Kartoffelschalenpuffer. Dazu zerstampfte sie die Schalen tat ein wenig Wasser und Mehl hinzu und backte sie auf der heißen Herdplatte. Nach so einem Abendessen konnte Gustav meistens, ohne vom Hunger geweckt zu werden, durchschlafen. Als die Lage immer aussichtsloser wurde kam es zu ersten Protesten in den Städten. Daraufhin veranlasste die preußische Regierung die kostenlose Ausgabe von Brot an die Bedürftigen. Das war die Situation an jenem Morgen, als sich die Jungen auf den Weg nach Waldenburg gemacht hatten.
»In der Stadt gibt es Brot. Lasst uns dorthin gehen.« Die anderen Jungen und auch Gustav schlossen sich an. Früh am Morgen gingen sie los. Es war ein langer Weg und schon fast Mittag, als sie sich der Stadt näherten. Sie waren nicht die einzigen, die sich aufgemacht hatten. Ein wortloser Strom an Menschen zog in die Stadt. Als Gustav das Chaos sah, überkam ihn Angst. Die Straßen waren überfüllt mit Menschen, denen man den Hunger ansah. Männer mit ihren Frauen und Kindern zogen durch die Straßen in Richtung Marktplatz. Dort, so hatten einige gesagt, würden sie etwas zu essen bekommen. Gustav hatte seiner Mutter nicht gesagt, dass er mit den anderen nach Waldenburg gehen würde. Er wollte sie nicht beunruhigen und hätte auch keine Genehmigung von ihr erhalten. Maria lag schwer krank im Bett.
In den vergangenen Monaten hatte sie kaum noch gegessen. Immer hatte sie zugunsten der Kinder zurückgesteckt. Jetzt waren ihre Kräfte erschöpft. Sie merkte es sofort. Erst kamen die fürchterlichen Krämpfe, dann der Durchfall und dann das Fieber, das nicht sinken wollte. So ging das jetzt schon zwei Wochen. Inzwischen konnte sie nicht mal mehr aufstehen. Dazu war sie zu schwach. Gustav spürte, dass seine Mutter endlich etwas Vernünftiges essen musste. Deshalb schloss er sich auch sofort den anderen an, als sie nach Waldenburg ziehen und um Brot betteln wollten. Auf dem Wochenmarkt angekommen sahen sie schon von weitem eine große Menschenansammlung. Frauen hielten ihre Kinder hoch und flehten die Händler und Bauern an, ihnen etwas Brot oder Kartoffeln zu geben. Das gab es auch, doch der Preis war nicht zu bezahlen. Die Händler verlangten den vierfachen Preis von dem sonst üblichen. So viel Geld hatte keiner.
»Das haben wir nicht. Wir können das nicht bezahlen!«, riefen die Menschen, doch die Verkäufer ließen sich nicht erweichen. Die Stimmen wurden immer lauter, doch die Menschenmasse verhielt sich friedlich. Hinterher konnte niemand mehr erklären, was den Ausschlag gab. Irgendetwas brachte das Fass zum Überlaufen und der Sturm der Empörung brach los.
Es waren die Frauen, die als erstes über die Stände herfielen. In der Sorge um ihre Kinder schnitten sie die wenigen Kartoffelsäcke auf und plünderten die Auslagen und Vorräte. Die Marktleute versuchten, ihre Ware auf die Pferdewagen oder Handkarren, mit denen sie am Morgen in die Stadt gezogen waren, zu retten, doch, nachdem die Plünderungen einmal begonnen hatten, gab es kein Halten mehr. Die Hungrigen stürzten sich auf alles Essbare und rafften es zusammen. Händler schrien, Marktfrauen kreischten und riefen nach der Polizei. Im allgemeinen Durcheinander erwischte Gustav einen Laib Brot, den er in seinen Beutel steckte. Über einen umgekippten Marktstand rannte Gustav hinter Johann her, der sich einer Gruppe von Männern angeschlossen hatte, die dem Haus des Metzgers zustrebte. Sie polterten gegen die Türe und riefen: »Mach auf, Du fettes Schwein, gib uns etwas von Deinem ab.«
Als sich im Haus nichts rührte begannen sie, heftig gegen die Türe zu treten. Erst als einer mit einer schweren Eisenstange des Schloss aufbrach sprang die Türe auf, und die Männer strömten in die Metzgerei. Gustav, erst noch ein wenig zaghaft und vorsichtig, folgte ihnen und sah, wie die Männer das, was sie an Wurst und Speck fanden, in ihren Beuteln und Rucksäcken verstauten. Vom Geschäft führte eine Treppe in die erste Etage, wo der Metzger offensichtlich seine Wohnung hatte. Der Mob stürzte hinauf und suchte nach den privaten Vorräten, die sie bei dem Metzger vermuteten. Gustav hatte Hemmungen, doch die Angst, ohne etwas Essbares vor seiner Mutter zu stehen, ließ ihn sie überwinden. Hastig hob er ein paar Würste, die in dem Getümmel auf den Boden gefallen waren, auf, und steckte sie zu dem Brot in seinen Beutel. Dann verließ er das Geschäft und trat auf die Straße hinaus. Die meisten Marktstände waren umgekippt. Überall waren die Türen von den Geschäften aufgebrochen. Nach und nach weiteten sich die Unruhen vom Marktviertel über die ganze Stadt aus. Überall suchten die Menschen, Männer und Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm oder an der Hand, nach Läden, in denen sie etwas Wertvolles zu finden glaubten, und wenn es schon keine Lebensmittel waren, dann sollten es zumindest Dinge sein, die man später gegen Essbares eintauschen konnte. Nach etwa einer Stunde Plünderungen rückte die Polizei an. Sie hatte Order, die Menge auseinander zu treiben, doch dies war nicht so einfach. Die Ereignisse hatten ihre eigene Dynamik entwickelt. Als die Ordnungskräfte feststellen mussten, dass ihre Anwesenheit keinen Eindruck bei den Wütenden hinterließ, schlugen sie wahllos auf die Menge ein. Die ersten fielen unter den Schlägen, und, davon beeindruckt, wichen die anderen erst einmal zurück. Für einen Augenblick schien sich die Lage zu beruhigen, doch der Schein trug. Die vielen von Hunger und Angst ums Überleben Getriebenen gaben nicht auf. Rasend schnell verteilte sich die Menge in dem Gewirr der Gassen und formierte sich neu. Gustav rannte so schnell er konnte, immer darauf achtend, dass er Johann nicht aus den Augen verlor. Für einen Moment lief Gustav Gefahr, von den zurückströmenden Menschen niedergetrampelt zu werden. Er suchte an einer Hauswand hinter einem Mauervorsprung Schutz und verfolgte, wie die Menschen in wilder Panik an ihm vorbei jagten. Kurz darauf wurde ihm bewusst warum. Die Regierung hatte zusätzlich eine Kompanie Infanteristen eingesetzt, die für Ruhe und Ordnung sorgen sollte. Mit aufgepflanzten Bajonetten marschierten die Soldaten auf die Menschenmenge zu, doch die wich nicht weiter zurück. Sie konnte nicht. In den engen Gassen hatte sich ein Stau gebildet, der sich immer mehr verdichtete. Von hinten wurde nachgeschoben, da dort hinten die heranrückenden Soldaten nicht zu sehen waren, und vorne war der Marsch der Hungernden im Angesicht der bewaffneten Soldaten zum Stehen gekommen. Angetrieben von einem berittenen Offizier und den mit gezückter Pistole hinter den vorderen Reihen der Füsiliere laut befehlenden Unteroffizieren schritten die Soldaten voran. Immer näher kamen sich die beiden Gruppen. Die Bajonette vorweg würden die Soldaten die ersten Menschen unweigerlich aufspießen, wenn sie nicht zurückwichen. Als die Soldaten die zerlumpte Menge erreicht hatten kamen sie vor den Vordersten zum Stehen.
»Vorwärts, Marsch!«
Der Befehl drang jedem durch Mark und Bein. Jeder weitere Schritt würde Menschenleben kosten.
Die Soldaten zögerten im Anblick der Wehrlosen. Not war ihnen nicht fremd. Auch in ihren Familien gab es Betroffene. Jetzt weiter zu marschieren kam vielen von ihnen so vor, als würden sie gegen ihre eigenen Geschwister oder ihre Eltern vorgehen.
Die Menschen schrien, Frauen ballten die Fäuste und hielten ihre halbverhungerten Kinder in die Höhe.
»Vorwärts, Marsch!«
Der Befehl war unmissverständlich, doch keiner der Soldaten machte einen Schritt. Da fiel ein Schuss und kurz darauf noch einer. Die Unteroffiziere brüllten ihre Befehle; die Soldaten schauten unschlüssig in die Menschenmenge. Allmählich kam Bewegung in die Kompanieformation. Langsam rückten die ersten Soldaten vor. Die Menschen in der vordersten Linie wandten sich um und wollten fliehen, doch der Weg zurück, weg von der Gefahr der Bajonette, war versperrt. Die ersten, von Bajonetten Niedergestochenen oder von Gewehrkugeln Getroffenen, stürzten zu Boden. Schreie der Verwundeten übertönten das jammernde Geschrei der Angsterfüllten. Kinder wimmerten. Eine Frau mit aufgeschlitztem Arm, der gerade noch ein kleines Mädchen getragen hatte, suchte auf dem Boden nach ihrem Kind. Als sie es gefunden hatte warf sie sich schützend darüber, doch das half beiden nicht. Von der in Panik zurückströmenden Masse wurden sie beide zu Tode getreten. In ihrer panischen Todesangst rannten die Menschen so schnell sie konnten weg. In alle Richtungen flüchteten sie, und die Soldaten feuerten, so als wenn das Unheil, das sie mit ihren Bajonetten angerichtet hatten, noch nicht genug sei, eine Salve über die Köpfe der Flüchtenden ab. Auf dem Marktplatz sammelte sich die Menschenmasse wieder. Sie konnte auch nicht anders, da der Platz im Mittelpunkt der kleinen Stadt lag und alle Straßen zu ihm führten. Die Soldaten näherten sich langsam aber unaufhaltsam. Gustav stand im Hauseingang und sah ratund hilflos dem Geschehen zu. Dann flog der erste Stein. Andere taten es dem Werfer gleich. Ein Hagel von Pflastersteinen flog den Soldaten entgegen. Die wichen leicht verwirrt zurück. Sofort wurden Barrikaden gebaut, hinter denen sich die Menschen verschanzten. Gustav rannte zu den anderen Jungen. Einige hatten bereits einige Pflastersteine aus dem Platz herausgerissen und den hinter den Barrikaden verschanzten Werfern gebracht. Die Jungen versorgten die Werfer mit den Pflastersteinen. Unter dem Hagel der heranfliegenden Steine blieben die Soldaten, die keinen Schutz dagegen hatten, stehen. Beide Seite belauerten sich. So brach die Nacht herein. Am nächsten Morgen ließ der Magistrat der Stadt Proklamationen an die Hauswände kleben, in denen die Bevölkerung aufgefordert wurde, in Ruhe und ohne Plünderungen abzuziehen. Die Soldaten hatten sich im Laufe der Nacht in ihre Kaserne zurückgezogen. Doch erst am Nachmittag kam die Masse zur Ruhe. Es gab keine Geschäfte mehr, die nicht geplündert worden waren. Die Leute irrten umher, doch sie fanden keine Beute mehr. Daraufhin richteten sie sich gegeneinander. Die, die noch nichts, oder wie sie glaubten, nicht genug hatten, begannen, ihren Leidensgenossen, die sie für schwächer hielten, alles weg zu nehmen. Es entstand eine Schreckensherrschaft des Pöbels. Männer prügelten aufeinander ein, Frauen entrissen anderen die Beutel mit den wenigen Habseligkeiten, die sie am Tage zuvor ergattert hatten.
Gegen Abend rückte das Militär aus der Garnison erneut an. Von allen Seiten drängten sie die Masse aus der Stadt in Richtung Nordosten, wo die Landstraße in sanften Biegungen nach Breslau verlief. Wieder flogen Pflastersteine. Die Soldaten bekamen Befehl zu schießen. Die Schüsse dröhnten durch die Stadt. Daraufhin zerstreute sich die Menschenmenge ängstlich und suchte Schutz im Dunkel der hereinbrechenden Nacht. Zurück blieben die Toten und Verletzten. Eine gespenstische Ruhe lag über dem sonst so friedlichen Ort. Gustav ging durch die Straßen und suchte Johann. Er wollte nach Hause. Das Brot und die Würste würden seiner Mutter ein wenig helfen. Als Gustav in eine Nebengasse des Marktplatzes einbog, sah er Johann im Toreingang zu einer Bäckerei stehen. Er blutete am Kopf.
»Ein Stein hat mich getroffen.«
Gustav schaute ihn an. Es war nicht schlimm.
»Wo sind die anderen, Johann?«
»Ich weiß nicht.«
»Lass uns nach Hause gehen, Johann. Ich habe Angst. Wer weiß, was morgen noch alles passieren wird.” Johann schüttelte den Kopf.
»Nein. In der Bäckerei ist Mehl. Ohne einen Sack Mehl gehe ich nicht heim.«
Gustav wollte nicht mehr mitgehen, doch er ließ sich überreden, mit Johann in die Bäckerei einzubrechen und den Sack Mehl zu stehlen. In dem Torbogen zu der Bäckerei war eine hölzerne Tür in das Tor eingelassen, die ihnen den Zugang zum Hof versperrte. Johann zog aus seinem Rucksack ein Brecheisen heraus und stemmte es ohne Geräusche zu machen in den Spalt zwischen Tür und Tor. Nach einigen heftigen Rucken sprang die Tür auf. Knarrend ließ sie sich öffnen und ermöglichte den beiden einen Blick in den völlig dunklen Hof des Bäckerhauses. Sie huschten in den Torbogen und lehnten die Türe an, dass es so aussah, als wenn sie verschlossen wäre. Vorsichtig, jedes Geräusch vermeidend, schlichen sie weiter und gelangten zu einer schmalen Tür. Johann drückte die Klinke herunter. Die Tür sprang auf. Sie standen in der Backstube. Es war stockfinster.
»Wohin?«
Gustav schaute Johann fragend an.
»Warte einen Moment. Wir müssen ins Vorratslager, wo das Mehl ist.”
Langsam gewöhnten sich die Augen der Jungen an die Dunkelheit. Schemenhaft konnten sie Tische erkennen. Johann ging an der Wand entlang und tastete sie ab.
»Hier muss doch irgendwo eine Tür sein.«
Nach fast endlosen Minuten der Suche fand er sie und trat in den neben der Backstube gelegenen Vorratsraum hinein.
»Kannst Du einen Sack alleine schleppen?« Gustav hob einen Sack an.
»Nein. Zu schwer.«
»Dann lass uns die Schubkarre von draußen nehmen.« Gustav ging hinaus und wollte die Schubkarre vor die Tür zum Hof schieben. In dem Moment, als er die Schubkarre anhob, fielen die Ofenschieber, die an die Karre angelehnt waren, mit lautem Gepolter um. Ein Höllenlärm entstand, und es dauerte keine Minute, da gingen die Petroleumlampen im Haus an. Ein Fenster öffnete sich.
»Wer ist da?”
Der Bäcker stand im Fenster und schaute auf den Hof hinunter. Gustav verharrte wo er gerade stand. Johann kam heraus. Auf seinem Rücken trug er einen Mehlsack. Sie hörten Schritte von mehreren Leuten auf der Treppe.
»Hierher, hierher. Sie sind in der Backstube.«
»Weg hier, Johann, weg!«
Er rannte zu Torbogen. Johann keuchte hinter ihm her, den schweren Sack noch immer auf den Schultern.
»Dort hinten ist er. Dort!« Der Bäcker zeigte auf Johann und sofort nahmen die Verfolger Johanns Spur auf. Der ließ den Sack fallen und rannte so schnell er konnte weg. Gustav hinter ihm her. Nach ein paar Minuten bog er in eine kleine Gasse ein. Es war dunkel. Johann war weg. Alleine in der Dunkelheit der Nacht lauschte er, ob die Verfolger noch hinter ihm wären. Doch er hörte nur das Rasseln seines Atems. Sein Beutel war weg. Er hatte ihn in der Aufregung verloren. Kein Brot, keine Wurst. Nur wegen Johann, dachte er bei sich. Er setzte sich in einen Hauseingang und lehnte sich an den Türrahmen an. Er weinte. So verharrte er und wartete im Schutz der Dunkelheit ab. Völlig übermüdet fiel er in einen tiefen Schlaf. Als er wieder wach wurde graute schon der Morgen des nächsten Tages. Gustav machte sich auf den Weg nach Hause. Als er aus der Gasse trat stand er am Rande des großen Platzes, auf dem zwei Tage zuvor die Ausschreitungen begonnen hatten. Und auch heute ging es schon im Morgengrauen wieder los. Die Hungernden formierten sich erneut und zogen in Richtung des Rathauses der Stadt. Viele hatten sich inzwischen mit Äxten, Beilen und Hämmern bewaffnet. Die so marschierenden Scharen verbreitenden eine bedrückende Atmosphäre. Es waren zerlumpte Gestalten. Männer blickten finster drein. Frauen mit schreienden Kindern auf dem Arm schritten entschlossen voran. Eine unheimliche Stille herrschte in der Stadt, nur von Zeit zu Zeit unterbrochen von dem stakkato ähnlichen Ruf.
»Wir wollen Brot! Wir wollen Brot!«
Vor dem Rathaus hatte das Militär Stellung bezogen. Als die Menge näher kam legten die Soldaten ihre Gewehre an. Die Volksmenge kam zum Stehen. Der Garnisonskommandeur, General von Feldschow, trat vor die schussbereiten Soldaten und hob den Arm.
»Auf Veranlassung des Magistrats wird an jeden Erwachsenen ein Pfund Brot ausgegeben. Das Brot bekommt jeder von Euch auf dem Marktplatz.«
Die Masse kam in Bewegung. Mitgerissen von dem Strom der Hungernden strebte Gustav dorthin. Als sie auf dem Platz ankamen waren bereits Stände aufgestellt worden, die von Soldaten bewacht suchten. In langen Schlangen standen die Menschen an, um sich ihr Brot zu holen. Gustav wartete mehr als zwei Stunden, bis die Reihe an ihm war. Als er das Brot in Empfang nehmen wollte verweigerte man es ihm.
»Du bist noch nicht erwachsen. Geh und hole Deine Mutter.«
»Meine Mutter liegt sterbenskrank im Bett. Wenn ich nichts zu essen bekomme wird sie sterben.« Er streckte seine Hand nach dem Brot aus, doch es wurde ihm nicht gegeben, und die nachfolgenden stießen und drückten immer heftiger und bald hatten sie ihn am Stand vorbei geschoben. Da stand er nun, ohne Brot, all die Mühe der letzten Tage, die Angst, alles umsonst. Große Ratlosigkeit überkam ihn. Nun war er zwei Tage in dieser Stadt. Um ein Haar hätte man ihn umgebracht. Und wofür? Für nichts. Er stand mit leeren Händen da.
»Das ist er. Der und noch ein anderer waren in der Backstube.«
Der Bäcker schrie und kam mit einem Polizisten auf ihn zugelaufen. Gustav rannte los und versuchte, in der Menschenmenge unterzutauchen. Der Bäcker und der Polizist verfolgten ihn. Als er vom Marktplatz durch einen Torbogen in eine der schmalen Gassen abbog traf ihn unvermittelt ein Schlag auf den Rücken. Er taumelte unter der Wucht des Schlages und stürzte. Da erwischte ihn der zweite Schlag. Schemenhaft erkannte er vor sich einen Hünen von Mann in dunkelblauer Uniform mit einem riesenhaften Tschako auf dem Kopf. In seiner rechten Hand hielt er einen Schlagstock. Ob der Polizist weiter auf ihn einprügelte bekam er nicht mehr mit. Sein Gehirn ersparte ihm die weitere Qual und nahm ihm die Besinnung. In seinem Kopf hämmerte ein unerträglicher Schmerz als er wieder zu Bewusstsein kam. Er war auf einer Polizeiwache. Die Polizisten nahm er zuerst nur von Ferne wahr. Alles verschwamm vor seinen Augen. Zwei Arme rissen ihn unsanft von der Bank, auf der er lag, hoch.
»War er das?«
Der Bäcker, der ein paar Minuten zuvor noch laut gebrüllt hatte, ihn wieder zu erkennen, zuckte etwas unsicher mit den Schultern.
»Ja. Ich glaub schon.«
»Aber sicher wissen Sie es nicht?«
»Es war dunkel.«
Sie schickten den Bäcker weg. Der Polizist sah Gustav lange an.
»Erzähl. Was war los?«
»Ich wollte nur um etwas Brot bitten. Meine Mutter stirbt, wenn sie nichts zu essen bekommt. Zwei Stunden habe ich bei der Brotausgabe gewartet, und als ich dran war hat man mir nichts gegeben.«
»Bist Du in die Bäckerei eingebrochen?«
Gustav zögerte mit seiner Antwort. Mutter hatte ihn erzogen, nie zu lügen. Aber was wäre, wenn er jetzt die Wahrheit sagen würde.
»Nein. Ich war es nicht.«
Der Bäcker konnte nicht mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass es Gustav war, den er in der Nacht in seiner Backstube überrascht hatte. Also ließ man ihn laufen. Eilig machte sich Gustav auf den Heimweg. Brot hatte er seiner Mutter mitbringen wollen und jetzt hatte er gar nichts. Als er heimkam war seine Mutter in Aufregung.
»Wo warst Du?«
»Ich war in der Stadt«, antwortete Gustav.
»Wir haben um Brot gebettelt. Aber die Soldaten kamen und jetzt habe ich nichts mehr.«
Tränen liefen ihm über die Wangen. Er drehte sich um, um sie zu verbergen. Seine Mutter nahm ihn in den Arm.
»Lass nur, Gustav. Es wird schon.« Doch auch sie wusste, dass sie nicht mehr gesund werden würde. Ihr Körper war schon zu geschwächt. Er hielt die Strapazen des Hungerns nicht mehr aus.
»Ja, Mutter.«
Einige Wochen später starb Maria, gerade einmal vierzig Jahre alt. Gustav hatte ihr nicht helfen können.