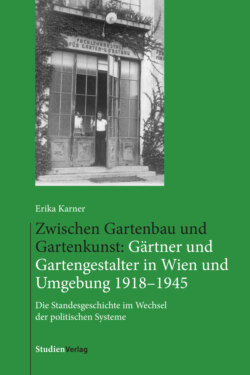Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 12
1.3 Forschungsstand im Überblick
ОглавлениеDer Forschungsstand4 in Österreich zum Thema ist leicht überschaubar. Ein umfassendes Werk, das diese Zeit beschreibt, liegt bis dato nicht vor.
Österreichische Gartenbauvereine und -institutionen befassten sich bislang wenig bis gar nicht mit ihrer Geschichte. Die „Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur“, eine „Nachfahrin“ der „Vereinigung österreichischer Gartenarchitekten“, verfasste 2012 eine Festschrift anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens mit einem kurzen Beitrag über die historische Entwicklung, eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte fehlte jedoch.
Die theoretische Auseinandersetzung mit Gartenbau und Gartenarchitektur in Österreich zwischen 1918 und 1950 setzte an den Universitäten relativ spät, um 1990, ein und beschränkt sich auf einige wenige Arbeiten. Es gibt einige Diplomarbeiten, die sich durchwegs mit Einzelpersonen und deren Werk befassen, diese gehen aber über biografische Angaben und Werkbeschreibungen nicht hinaus. Eine Einordnung der Personen und Werke in soziale und politische Kontexte fehlt.
Lieselotte Strohmayr schrieb 1990 an der Universität für Bodenkultur eine Diplomarbeit über Albert Esch und seine privaten Gartenanlagen. Ebenfalls 1990 wurden von Edgar Kohlbacher und Karl Gottfried Rudischer Diplomarbeiten über Josef Oskar Wladar und sein Werk bis 1950 vorgelegt. Diese wurden zusammengefasst und erschienen in der Schriftenreihe des Institutes für Landschaftsplanung und Gartenkunst an der TU Wien. Auch ihre Beiträge beschäftigen sich ausschließlich mit Planungen von Josef Oskar Wladar.
1991 erarbeiteten Maria Auböck, János Kárász und Stefan Schmidt eine, leider nie veröffentlichte, umfangreiche Studie zu den Wiener Wohnhausanlagen der Zwischenkriegszeit „Die Freiräume der Wiener Wohnhausanlagen 1919–34. Gestern und Heute“. Sie beschäftigt sich mit dem kommunalen Wohnbau in Wien, entwickelt eine Freiraumtypologie und beschreibt anhand von fünf Fallbeispielen die Planungsgeschichte, Entwurfsbausteine, den damals aktuellen Pflegestand und das Nutzungsbild der Wohnhausanlagen. Ein Exemplar der verschollen geglaubten Studie konnte von Eva Berger aufgespürt werden und befindet sich seit 2014 in der Bibliothek des Institutes für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der TU Wien.
Barbara Bacher legte 1994 am Institut für Landschaftsgestaltung der Universität für Bodenkultur ihre Diplomarbeit über Gartengestaltung in Deutschland und Österreich zwischen 1919 und 1933/38 vor.
Judith Formann verfasste 2002 an der Universität für Bodenkultur eine Diplomarbeit, die die Geschichte der Landschaftsplanung in Österreich vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart zum Gegenstand hatte, und 2004 schrieb Gudrun Schneider an der Uni Wien ihre Diplomarbeit über „Freiraumgestaltung, Siedlungsgrün und Gartenbaukunst in Deutschland und Wien 1938–1955“.
Es gibt architekturhistorische Arbeiten, die am Rande auch Gartenarchitektur und Gartengestalter erwähnen. Eine dieser Arbeiten ist die von Iris Meder im Jahr 2004 vorgelegte Dissertation „Offene Welten. Die Wiener Schule im Einfamilienhausbau 1919–1938“.
Am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien lief von Jänner 2007 bis Ende 2010 ein Forschungsprojekt, das von Corinna Oesch bearbeitet wurde und sich mit dem Leben von Yella Hertzka beschäftigte. Yella Hertzka war auch Untersuchungsgegenstand bei Elisabeth Malleier, die 2001 in einer unveröffentlichten Forschungsarbeit für das österreichische Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Arbeitsbereich Gender Studies, zum Thema „Jüdische Frauen in der Wiener bürgerlichen Frauenbewegung“ arbeitete.
Eva Berger publizierte mehrere Artikel über Albert Esch, Hartwich & Vietsch und Josef Oskar Wladar, und Brigitte Mang veröffentlichte im Jahr 2000 einen Beitrag über Viktor Mödlhammer in der Fachzeitschrift „Historische Gärten“.
1994 veranstaltete die Österreichische Gesellschaft für historische Gärten eine Tagung zum Thema „Gartenkunst des Jugendstils und der Zwischenkriegszeit“. Die Tagungsbeiträge wurden 1995 in der Zeitschrift „Die Gartenkunst“ veröffentlicht. Danach beschäftigte sich längere Zeit niemand mit diesem Zeitraum.
Am Institut für Landschaftsarchitektur der Universität für Bodenkultur gab es laut Forschungsdatenbank, im Zeitraum vom 2. Jänner bis 23. März 2007 ein Projekt zum Thema Austrofaschismus: „Entwicklung der Profession in Österreich zwischen 1934 und 1938“. Die Ergebnisse wurden, soweit bekannt, nicht veröffentlicht.
Am selben Institut wurde von Juni 2008 bis Ende Mai 2010 ein Forschungsprojekt zum Thema „Landschaftsarchitektur in Österreich zwischen 1912 und 1945“ abgewickelt. Die Projektmitarbeiterinnen Iris Meder und Ulrike Krippner hielten dazu einige Vorträge und im Juni 2010 erschien ein Artikel in der Zeitschrift „Zoll+“ sowie ein weiterer im November 2010 in der Zeitschrift „Die Gartenkunst“; Barbara Bacher publizierte im Rahmen dieses Projektes einen Artikel in der Zeitschrift „Historische Gärten“. Im Dezember 2010 gab es eine Veranstaltung mit Vorträgen der drei Projektmitarbeiterinnen. Sie präsentierten Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Inhalte ihrer Vorträge waren nahezu ident mit denen der bereits veröffentlichten Artikel. Barbara Bacher publizierte 2011 einen weiteren Artikel zum Thema „Beruf: Gartenarchitekt, Gartenarchitektin“ in der „Zeitschrift für historische Gärten“. Eine umfassende Veröffentlichung der Forschungsergebnisse lag bis zum Ende der Abfassung dieser Arbeit nicht vor.
Anja Seliger, bis 2014 beschäftigt am Institut für Landschaftsarchitektur der Universität für Bodenkultur, arbeitete an einer Dissertation über Josef Oskar Wladar die neben der Einordnung seiner Werke in das historische Umfeld auch ein Werkverzeichnis mit einer dazugehörigen digitalen Datenbank enthalten sollte.5 Die Arbeit wurde bis dato noch nicht vorgelegt.
Ein weiteres diesem Themenfeld zugeordnetes Forschungsprojekt dieses Instituts mit dem Titel „Frauen in der Landschaftsarchitektur in Österreich und Zentraleuropa“ startete im Dezember 2011 und endete im Februar 2014. Eine umfassende Veröffentlichung dieser Forschungsergebnisse lag bis zum Ende der Abfassung dieser Arbeit ebenfalls nicht vor. Ulrike Krippner und Iris Meder veröffentlichten weitere Artikel in in- und ausländischen Medien in Anlehnung an die bereits erschienen. Sie beschränkten sich in ihren neuen Publikationen auf die mittlerweile bekannten jüdischen Frauen und deren Milieu. Sie verabsäumen es jedoch deren Tätigkeiten oder beispielsweise den von ihnen verwendeten Begriff „Gartenarchitektin“ – (es wird darauf verwiesen, dass von 1900 bis 1930 dieser Begriff, der vorrangig verwendete war, wie sie zu dieser Annahme kommen wird nicht näher ausgeführt6) – umfassend zu Kontextualisieren. So wie auch in ihrem 2015 erschienenen Artikel „Ann Plischke and Helene Wolf: designing gardens in early twentieth-century Austria“ welcher im Tagungsband der Konferenz „Woman and Modernism in Landscape Architecture der Havard Graduate School of Design (GSD) veröffentlicht wurde.
Im September 2013 fand in Wien die 14. Jahrestagung des Netzwerkes „Frauen in der Geschichte der Gartenkultur“ statt. Es gab unter anderem auch Beiträge über Gärtnerinnen und deren Ausbildungsmöglichkeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese wurden in der Zeitschrift „zoll+“7 veröffentlicht.
Noch spärlich erforscht sind die Architekten, Gartenarchitekten, Gärtner und Gartengestalter die „Altösterreicher“ waren und nach Beendigung des Ersten Weltkrieges Angehörige eines Nachfolgestaates waren. Eine diesbezügliche Arbeit ist die von Steven A. Mansbach, der sich mit dem Architekten Josef Plečnik und seinen Arbeiten in Prag und Ljubljana befasst.
In Deutschland begann die Erforschung der Professionsgeschichte wesentlich früher als in Österreich. Daher liegt eine umfangreiche Reihe wissenschaftlicher Arbeiten vor, die sich mit der Geschichte und dem ideologischen Hintergrund der Garten- und Landschaftsarchitektur und deren Protagonisten im beginnenden 20. Jahrhundert befassen.
Besonders die Arbeiten von Gert Gröning und Joachim Wolschke-Bulmahn, die sich ab den 1980er-Jahren intensiv mit dem Themenfeld auseinandersetzten, seien hier erwähnt. Exemplarisch hervorgehoben werden sollen hier „Zur Entwicklung der Interessenverbände der Gartenarchitekten in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“, in welchem sie den Verlauf der Geschichte dieser Vereinigung nachzeichnen, „Die Liebe zur Landschaft“ Teil I und Teil III, die sich ideologiekritisch mit der Professionsgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen, und „Grüne Biographien“ eine biografisches Handbuch, das auch kurze Einträge über in Österreich tätige Gartenarchitekten erhält. Die ersten Auseinandersetzungen mit den Interessenverbänden der Gartenarchitekten (BDGA, VDG, DGGL) und ihrem Wirken während des Nationalsozialismus entstanden ebenfalls zu dieser Zeit wie auch die kritische Nachzeichnung der Geschichte der kommunalen Grünflächenverwaltung in Hannover. In Österreich fehlen kritische Auseinandersetzungen mit kommunalen Gartenverwaltungen bis heute. Ein weiteres Werk ist „Gartenkultur und nationale Identität“ aus dem Jahr 2001, herausgegeben von Gert Gröning und Uwe Schneider. Weitere Publikationen aus der regen Forschungstätigkeit dieser Professoren und weiterer Personen, die nicht in dieser Arbeit zitiert werden, finden sich im Literaturverzeichnis unter „Weiterführende Literatur“.
Die 2001 publizierte Dissertation von Charlotte Reitsam mit dem Titel „Das Konzept der ‚bodenständigen Gartenkunst‘ Alwin Seiferts“ befasste sich mit Leben und Werk von Alwin Seifert und seiner Rolle als „Reichsautobahnbegrüner“ während der NS-Herrschaft. Die Autorin beschäftigte sich zuvor bereits mit Biografien deutscher Gartenarchitekten, die sie in der Zeitschrift „Garten & Landschaft“ veröffentlichte.
Margit Bensch veröffentlichte 2002 „Die ‚Blut und Boden‘-Ideologie. Ein dritter Weg der Moderne“, in dem sie sich intensiv mit der Ideologie des deutschen Landwirtschaftsministers und „Reichsbauernführers“ Richard Walther Darré beschäftigte.
Eine herausragende biografische Arbeit ist „Hermann Mattern. Gärten – Landschaften – Bauten – Lehre. Leben und Werk“ von Vroni Heinrich. Es gelingt ihr Hermann Matterns historische Wurzeln, die zeitgenössischen Gegebenheiten und die Aktualität seiner Arbeit umfassend darzustellen. Dies war unter anderem deshalb möglich, weil der umfangreiche künstlerische Nachlass Hermann Matterns der Universität Berlin übergeben wurde und so reichlich Material für Forschungen zur Verfügung stand. Jeong-Hi Go schloss mit ihrer Arbeit über die deutsche Gartenarchitektin Herta Hammerbacher eine Forschungslücke. Sie widmete sich ausführlich Leben und Werk der eng mit Staudenpionier Karl Förster zusammenarbeitenden ersten Professorin und Jahre später ersten Ordinaria für Landschaftsund Gartengestaltung an der TU Berlin.
Neben den biographischen Arbeiten wurde auch Werke zu unterschiedlichen Aspekten des Gärtnertums und der Gartenarchitektur veröffentlicht. Beispielsweise die 2006 erschienene Arbeit von Johannes Schwarzkopf „Der Wettbewerb in der Gartenarchitektur“ beschäftigt sich mit der Geschichte des freiraumplanerischen Wettbewerbswesen in Deutschland zwischen der Gründung des Kaiserreiches 1871 und dem Ende des Dritten Reiches 1945. Für Österreich liegt leider nichts Vergleichbares vor.
Mit der Buchreihe „Stolo – Bibliographische Findmittel zur Gartenkultur“ legen Gert Gröning und Uwe Schneider eine umfassende Übersicht der Referenzwerke zur Geschichte und Theorie der Gartenkultur in Europa vor.8 Geplant sind neun Bände darunter einer über Österreich, bisher sind drei Bände (Italien, Schweiz, Spanien) erschienen. Der österreichische Band wird hier sehnsüchtig erwartet, da die einzige vorliegende diesbezüglich Publikation aus dem Jahre 1996 stammt und die darin enthaltenen Informationen zu Nachlässen nicht mehr aktuell sind.9
In den letzten Jahren fanden vermehrt international besetzte Symposien, Konferenzen und Kongresse statt, die sich mit dem Themenkreis Gärtner, Gartenbau und Gartenkunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts befassten. Beispiele dafür sind Veranstaltungen wie:
„Modernism in Landscape Architecture 1890–1940“10: 2008 veranstaltet vom Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) der Leibnitz Universität Hannover in enger Kooperation mit dem Center for Advanced Studies in the Visual Arts (CASVA) der national Gallery of Art, Washington D.C. und der Stiftung Bauhaus Dessau. Diese Tagung wurde in zwei Teilen – jeweils zwei Tage Washington und Hannover im Abstand von sieben Monaten – abgehalten. Der englischsprachige Tagungsband erschien 2015 und umfasst 12 Beiträge mit unterschiedlichen Betrachtungen der Themen Landschaftsarchitektur und Moderne welche die Entwicklungen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Europa, Lateinamerika und Nordamerika nachzeichnen.
„Natur und Landschaftswahrnehmung in deutschsprachiger jüdischer und christlicher Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“11: wurde ebenfalls 2008 vom Franz Rosenzweig Minerva Research Center for German-Jewish Literature and Cultural History, der Hebrew University of Jerusalem und dem Van Leer Jerusalem Institute in Jerusalem ausgerichtet. Der diesbezügliche Tagungsband erschien 2010 als Band 7 der CGL-Studies. Dieses Symposium war eine Fortsetzung des bereits 2006 in vom CGL der Leibnitz Universität Hannover organisierten und auf dem Gelände des ehemaligen Israelitischen Gartenbauschule Ahlem abgehaltenen Symposiums „Gärten und Parks im Leben der jüdischen Bevölkerung nach 1933“. Die Tagungsbeiträge wurden im gleichnamigen Band 5 der CGL-Studies 2008 publiziert.
„Kunst-Garten-Kultur“12: diese Tagung eröffnete Perspektiven auf die gartenkulturelle Forschung im 21. Jahrhundert. Der veröffentlichte Tagungsband enthält 15 Beiträge welche sich mit der Vielfältigkeit und Interdisziplinarität des Gartenthemas befassen wie „künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Garten als Objekt interdisziplinärer Forschung, mit der Gartenkunst im Spannungsfeld der benachbarten schönen Künste, mit der Gartenkultur als Ausdruck gesellschaftlicher Strömungen und politischer Instrumentalisierung sowie mit dem Garten als Spiegel kultureller Sehnsüchte und Zuschreibungen“13.
„Zwischen Jägerzaun und Größenwahn. Freiraumgestaltung in Deutschland 1933 – 1945“14: dieses Symposium wurde anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Landesverbandes Bayern Nord e.V. der DGGL im Jubiläumsjahr 125 Jahre Bundesverband DGGL 2012 in Nürnberg abgehalten und beschäftigte sich mit verschiedenen Aspekten der Freiraumplanung in der NS-Zeit. Der Tagungsband dazu erschien ebenfalls 2012. Zum Themenbereich, NS-Zeit und wie mit ihren bauwerklichen Hinterlassenschaften denkmalpflegerisch umgehen, fand 2014 die Tagung „Unter der Grasnarbe – Freiraumgestaltung in Niedersachsen während der NS-Diktatur als denkmalpflegerisches Thema“ statt. Der Tagungsbericht erschien 2015 als Band 45 der Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen.
Auch Frauen rückten immer stärken in den Focus der Forschung. Das Netzwerk „Frauen in der Geschichte der Gartenkultur“ leistet hier mit Konferenzen und Vernetzungstreffen Pionierarbeit und Anke Scherkhan veröffentlichte bereits 2000 ihre Ergebnisse zu den gärtnerischen Ausbildungsmöglichkeiten von Frauen in Deutschland. Im englischsprachigen Raum, speziell in den Vereinigten Staaten gab es in den letzten Jahren eine Reihe an Publikationen zum Thema Frauen und ihre Rolle Landschaftsplanung/Gartenarchitektur (Dümpelmann 2015, Herrington 2015 und 2014, Major, 2013, Miller 2013, Nolin 2015, Way 2015) sodass sich jetzt ein klareres Bild über deren Einfluss und Wirken ergibt.
In Deutschland gibt es, anders als in Österreich, bedeutende Forschungseinrichtungen für den Bereich Gartenkunst. Etwa das Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) an der Leibnitz-Universität in Hannover. Dort werden neben der Forschungstätigkeit auch Ausstellungen, Vorträge, Tagungen und Symposien veranstaltet und in der Buchreihe „CGL-Studies“ Forschungsergebnisse zur Geschichte der Gartenkunst und Landschaftsarchitektur veröffentlicht.15 So publizierte das CGL beispielsweise 2005 drei Beiträge zum Themenbereich „Gartenarchitektur und Moderne in Deutschland im frühen 20. Jahrhundert“, 2008 das umfassende Werk „Gärten und Parks im Leben der jüdischen Bevölkerung nach 1933“ oder 2012 die Ergebnisse der Tagung „Zwischen Jägerzaun und Größenwahn“. Inzwischen liegen 23 Bänder der CGL-Studies vor.
Ein anderes Beispiel für gezielte Forschungsförderung zur Gartenkunst in Deutschland ist die 2005 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf von der Stadt Düsseldorf gestiftete Juniorprofessur für Gartenkunst. Mit dieser Stiftung konnte ein Lehr- und Forschungsschwerpunkt Gartenkunstgeschichte etabliert werden.16 Dr. Stefan Schweizer, der erste Inhaber dieser Stiftungsprofessur, veröffentlichte beispielsweise 2009 in Kooperation mit dem Verein „Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.“ und Studierenden der Universität eine Biographiensammlung von Landschaftsarchitekten und Gartenkünstlern die im Rhein- und Maasland ab dem 16. Jahrhundert wirkten.17 Nur kurze Zeit später, 2012, publizierte er gemeinsam mit Sascha Winter, „Gartenkunst in Deutschland. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart“, ein umfassendes Werk über Gartenkunst in Deutschland.
Wie internationale Zusammenarbeit funktionieren kann ist am Beispiel der von der Comission Landscape an Urban Horticultur der International Society for Horticultural Sciences (ISHS) veranstalteten Konferenzen „International Conference on Landscape and Urban Horticultur“ ersichtlich. 2009, auf der zweiten diesbezüglichen Tagung, die in Bologna stattfand, nahmen beispielsweise über 200 Teilnehmer aus mehr als 40 Ländern teil.18 Diese Konferenzen führen zu intensivem Austausch zwischen Forschern aus aller Welt. Die sechste Konferenz findet 2016 in Athen statt.19
Um das Bild abzurunden, sei als herausragende außereuropäische Forschungseinrichtung, die sich mit „Garden Landscape Studies“ der postgradualen Erforschung gartenkultureller Themen widmet, das zur Havard University gehörende Dumbarton Oaks in Washington D.C. erwähnt. Durch die großzügige Spende des Ehepaares Bliss an die Havard University in den 1940, steht ihr ehemaliges Anwesen nun ForscherInnen aus aller Welt und unterschiedlichsten Disziplinen – nicht nur gartenbaulichen – als Arbeitsstätte zur Verfügung.20 Das quartalsweise erscheinende Magazin „Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes“ herausgegeben von der „University of Pennsylvania (USA)“, gibt zudem einen guten Überblick über aktuelle internationale Forschungen zu diesem Themenbereich.