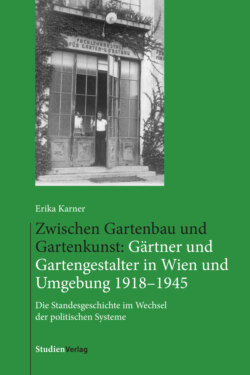Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 17
2.1.1 Die Stellung des Gartenbaus vor und während des Ersten Weltkrieges
ОглавлениеWährend der Habsburger-Monarchie war ein Großteil der Gärtner in herrschaftlichem Dienst. Nur wenige führten Zier-, Handels- oder Gemüsegärtnereien und selbstständige Gartenarchitekten scheinen erst 1905 in branchenspezifischen Adressbüchern auf.26 Die Ausbildung der Gärtner war zudem schlecht und sie genossen nur geringes soziales Ansehen.
„Daß der Gartenbau in Österreich zum größten Teil noch nicht auf der Höhe der Zeit steht, das wird niemand leugnen, der nicht still und zurückgezogen in seiner Klause gesessen, sondern sich ein wenig weiter umgeschaut hat. England, Frankreich und das uns am nächsten liegende Deutschland sind uns entschieden über. Man sehe nur heute zu, welche Stellung dem Gärtner in Österreich eingeräumt wird, welches Ansehen er gesellschaftlich genießt, und was man von ihm und seinem Berufe, seinem Studium, seinem Können bei uns zu Lande denkt, und man vergleiche dieselben Punkte anderwärts, so wird man unschwer zu dem Schlusse kommen, daß bei uns noch viel nachzuholen ist.“27
Diesen Befund erstellte R. Solkim im Jahre 1905 in einem Artikel in der „Wiener Illustrierten Garten-Zeitung“.
Eine Ursache für diese Missstände sah Solkim im geringen Spezialisierungsgrad vor allem der Handelsgärtner, aber auch bei der Ausbildung der Gärtner käme Spezialisierung, zum Beispiel auf Obstbaumzucht, Baumschulwesen oder die damals noch moderne Teppichgärtnerei, kaum vor.28
Die Gartengestalter und Landschaftsgärtner diskutierten zwar die modernen Strömungen in der Landschaftsgärtnerei – gemeint war damit die Rückkehr der formalen Gärten und dazugehörig eine starke „Übereinstimmung“ zwischen Haus und Garten –, diese wurden jedoch nur sehr zögerlich von der konservativen österreichischen Gärtnerschaft aufgenommen, sodass ernsthafte Vorstöße in diese Richtung zumeist von Seiten der Architekten, abfällig auch als „Reißbrettgärtner“29 bezeichnet, kamen.
Der Gärtner Erich Wibiral30 ortet 1908 in seinem Artikel „Moderne Bestrebungen auf dem Gebiete der Landschaftsgärtnerei“ die Schuld an dieser Entwicklung eindeutig bei seinen Berufsgenossen:
„Die Gärtner sind, wie ich meine, selbst schuld daran, daß hier der Anstoß von außen, nicht immer von berufener Seite, kommt. Während Architektur und Kunstgewerbe seit Jahren bestrebt sind, der neuen Zeit ein neues Heim zu schaffen, steht die Gärtnerwelt mit wenig Ausnahmen noch heute teilnahmslos, oft feindlich der ‚neuen Mode‘’31 gegenüber. Aber die ‚neue Mode‘ hat gesiegt und wird weiter siegen; so wie in früheren Zeiten jede ‚Renaissance‘ der Kunst, des öffentlichen Lebens, auch in der Gartenkunst neue Ideale hervorrief, so muß der Gärtner auch heute seiner Zeit folgen.“32
Beispielhaft für die zögerliche Haltung der Gärtnerschaft den neuen Strömungen gegenüber ist die Anmerkung der Redaktion der „Österreichischen Gartenzeitung“ zu diesem Artikel – sie schrieb dazu, dass die Behauptung, „die neue Mode würde siegen“, wohl als verfrüht angesehen werden müsse, wiewohl sich die Gärtner diesen Neuerungen nicht ganz verschließen sollten.33
Den Gärtnern und Obergärtnern stand bis zum Ende des Ersten Weltkrieges durch die weit verstreuten Liegenschaften des Adels ein großes Netz an praktischen Aus- und Weiterbildungsstätten zur Verfügung. Sie kamen auf diesem „Bildungsweg“ beruflich durch ganz Europa. Die Praxis des Adels, Gärtner gegenseitig zu „verborgen“ oder weiterzuvermitteln, förderte diese Form der beruflichen Weiterbildung.34
Beispielhaft zeigt sich das im beruflichen Werdegang des deutschen Gärtners Albrecht Löscher. Er arbeitete nach seiner Gärtnerlehre, dem Besuch der Gartenbauschule in Berlin-Dahlem und abgeleistetem Militärdienst 1884 in der Gärtnerei von Baron Nathaniel von Rothschild auf der Hohen Warte in Wien. 1885 wechselte Löscher in den Dienst des Schwagers von Nathaniel Rothschild, Baron Adolphe von Rothschild, in dessen Gärten in Paris und Genf (Prégny) er bis 1889 arbeitete.35
Diese umfassende Ausbildung und deren Auswirkungen beschrieb der in Budweis tätige Stadtgärtner Josef Sobischek und er verwies in seinen Zeilen auch auf die Eignung der Gärtner innerhalb des Militärs:
„Die meisten unserer Obergärtner haben das Leben in halb Europa kennen gelernt, sie verfügen über bedeutende Sprachkenntnisse, sie haben Fachschulen besucht und sind mit der Erledigung von Kanzleigeschäften vollkommen vertraut. Die Gärtnerschaft liefert auch dem Staate Soldaten, die neben großen körperlichen Vorzügen bedeutende Bildung und Erfahrung mitbringen, weshalb man im Mannschaftsstande unserer Armee nur wenige Gärtner finden wird, die nicht eine Unteroffizierscharge erreicht hätten. Das ist einer der sinnfälligsten Beweise für die geistige Potenz der Gärtnerschaft.“36
Als Beleg für die Richtigkeit seiner Ausführung seien beispielhaft folgende Gärtner angeführt: Josef Calta war während des Ersten Weltkrieges Zugsführer des k. k. Landst.-Etappen-Baon 40037 und Franz Nothhacksberger Fähnrich und ab 1916 Führer des „schweren Minenwerferzuges 13“.38 Auch Anton Eipeldauer, er diente im Infanterieregiment Nr. 81, rüstete als Feldwebel ab und wurde mit der bronzenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet.39 Fritz Kratochwjle, der spätere Leiter des Wiener Stadtgartenamtes, rückte am 1. August 1914 als Leutnant ein und wurde mehrmals schwer verwundet, meldete sich jedoch wieder freiwillig an die Front und war bis Kriegsende als Kompaniekommandant bei Verdun im Einsatz. Er wurde mehrfach ausgezeichnet: mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse, der Verwundungsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz.40