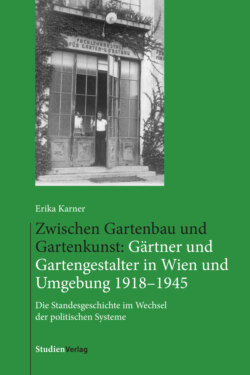Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 8
Prolog
ОглавлениеVom Paradiesgarten der Hesperiden bis zum „Garten Eden“: Die Menschen haben sich Parks und Gärten immer als utopische Gegenentwürfe zur Widersprüchlichkeit und Unvollkommenheit der Realität erträumt, als bukolische Traumgefilde, in denen der Wolf neben dem Lämmlein schläft und die Gesetze der Welt keine Gültigkeit haben. Die Geschichte zeigt: Nichts ist unpolitisch – auch nicht die Gärtner.
Gartenbau war im zwanzigsten Jahrhundert immer auch ein Feld ideologischer Auseinandersetzungen. „Der deutsche Garten muss herbe sein und keusch, muss die Heimat sein können von starken, geraden Menschen“,1 forderte etwa 1934 der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur2 Johann Boettner. Der obligatorische Verweis auf die Blut-und-Boden-Ideologie des Nationalsozialismus konnte da nicht unterbleiben: „Der deutsche Mensch soll wieder in Fühlung kommen im Garten mit der Scholle seines Landes.“3
Die nationalsozialistische Umgestaltung des Gartenbauwesens ab 1938 hatte tiefgreifende Auswirkungen:
• massive Säuberungen innerhalb der gärtnerischen Berufsverbände
• systematische Vertreibung jüdischer Gärtnerinnen und Gärtner
• konsequente Gleichschaltung des gärtnerischen Schul- und Ausbildungswesens.
Schon 1918/19, zwanzig Jahre vor dem sogenannten „Anschluss“, wurde das österreichische Gartenbauwesen einem revolutionären Umgestaltungsprozess unterworfen. Der Erste Weltkrieg und der Untergang der k. u. k. Monarchie hatten zahlreiche Adelsdynastien in den ökonomischen Abgrund gerissen – mit weitreichenden Folgen: Schlösser konnten nicht mehr erhalten werden, Gärten und Parks verfielen. Ein Gutteil der Ländereien und Besitzungen lag zudem außerhalb der Grenzen des neuen Österreich. Zahlreiche Gärtner und ihre Familien verloren ihren Arbeitsplatz.
Die wirtschaftlich desaströsen zwanziger Jahre brachten auf dem Gebiet des Gartenbaus aber nicht nur Niedergang und Verfall, sondern auch Ansätze zu einer Neugestaltung des Ausbildungswesens sowie zur Stärkung der gärtnerischen Arbeitnehmervertretung. In Wien beispielsweise gelang es gewerkschaftlich organisierten Landschaftsgärtnern, einen eigenen Kollektivvertrag mit geregelten Mindestlöhnen und Überstundenzuschlägen abzuschließen.
Der ideologische Grundkonflikt der Ersten Republik – jener zwischen Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen – fand auch im Gartenbauwesen seinen Niederschlag: Erbitterte Auseinandersetzungen entbrannten etwa um die Frage, ob der Gartenbau dem Bereich Landwirtschaft oder dem Bereich Gewerbe zugehörig sei. Firmenbesitzer hätten von Variante eins, Arbeitnehmer von Variante zwei profitiert. Die Regierung Dollfuß löste den Konflikt 1934 auf diktatorische Weise: Rund zwei Drittel der Betriebe, allesamt produzierende Gärtnereien, wurden der Landwirtschaft zugeschlagen, der Rest verblieb beim Gewerbe. Schon während des Ständestaats (1934–1938) kam es zu politischen Säuberungen auch im Gartenbau: Sozialdemokratische Funktionäre und Lehrende wurden inhaftiert oder entlassen.
1 Boettner, 1934 (zit. nach Götze, 1934, S. 18).
2 Gegründet 1933 in Erfurt – siehe auch Kap. 3.3.4.3.
3 Boettner, 1934 (zit. nach Götze, 1934, S. 18).
Die Verwerfungen des zwanzigsten Jahrhunderts haben auch im Gartenbauwesen tiefe Spuren hinterlassen, die – wie man sehen wird – zum Teil bis heute fortwirken.