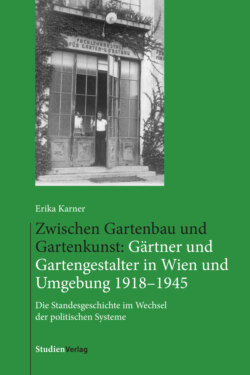Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 13
1.4 Quellen
ОглавлениеEinen Teil der Datengrundlage bildete Archivmaterial aus den Beständen des Österreichischen Staatsarchivs und des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Quellenkritische Schwierigkeiten gab es bei der Auswertung der hier vorgefundenen Gau- und NS-Registrierungsakten. Dabei war zu beachten, dass es sich bei beiden Aktenbeständen um subjektive Angaben der Betroffenen oder sie beschreibender Auskunftspersonen handelte. Dementsprechend war der Kontext der Aussagen zu berücksichtigen, da Personen, die in die NSDAP aufgenommen werden wollten, ihre „Taten für die Partei“ ins beste Licht rückten, während dieselben Personen nach Kriegsende im Zuge der Registrierung von NSADP-Mitgliedern (Entnazifizierung) ihre eigene Unwichtigkeit innerhalb der des Systems beteuerten.21
Bei den vorgefundenen jüdischen Personen stellte die erzwungene Flucht nach dem „Anschluss“ eine zusätzliche Erschwernis der Recherche dar, da persönliche Dokumente und berufliche Unterlagen großteils vernichtet wurden oder verloren gingen.22
Im Bereich der gärtnerischen Schulausbildung wirkte sich die unklare Kompetenzverteilung zwischen den Verwaltungsträgern erschwerend auf das Auffinden von Akten aus. So zählte der Gartenbau zum Gewerbe, manche Schulen wurden jedoch als landwirtschaftliche Schulen geführt. Die Verwaltungsagenden lagen im Falle der Zugehörigkeit zur Landwirtschaft beim Ministerium für Landwirtschaft, im Falle der Gewerbezugehörigkeit beim Ministerium für Unterricht und dementsprechend lagen die Agenden der Schulverwaltung entweder beim Bund oder bei den Ländern.
Weiters wurde Material aus dem Archiv der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft, hier vorwiegend Sitzungsprotokolle, und dem Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde verwendet. Auch ausländische Archive wie das Deutsche Bundesarchiv in Berlin, das Sigmund Freud Archiv in London und das Archiv der Library of Congress in Washington wurden in die Recherche einbezogen.
Gärtnerische Fachzeitschriften aus Österreich und Deutschland stellten eine weitere Quelle dar. Sie spiegelten die Konflikte und Differenzen innerhalb der Gärtnerschaft wider. Zumeist kamen nur Repräsentanten der jeweils dominierenden Fraktion zu Wort, die Unterschiedlichkeit der Interessen wurde verschwiegen oder verschleiert. Es war daher wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen, um dahinterstehende Interessenslagen freizulegen und in oppositionellen Medien Gegenpositionen zu erforschen. Anhand der Beiträge in den Zeitschriften „Der Erwerbsgärtner“ und „Allgemeine Österreichische Gärtner-Zeitung“ war es möglich, die Konfliktlinien innerhalb der Gärtnerschaft nachzuzeichnen und das Verhältnis zwischen Meistern und Gehilfen zu beleuchten. Ersteres war das Organ der Wiener Gärtnergenossenschaft und Letzteres das Blatt des Gehilfenausschusses der Gärtner, das eng mit der sozialdemokratischen Freien Gewerkschaft kooperierte.
Die nicht namentlich gekennzeichneten Artikel in den Zeitschriften „Gartenzeitung“, „Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung“ und „Der Erwerbsgärtner“ werden in den Fußnoten als Kurzbelege angeführt – das Langzitat findet sich im Literaturverzeichnis unter „Artikel ohne Verfasser“ und dem jeweiligen Medium. Alle anderen Zeitungsartikel ohne Verfasserangaben werden in den Fußnoten als Langzitate angeführt.
Die Zeitschrift der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft mit dem Titel „Gartenzeitung“ sowie die Publikationen „Illustrierte Flora“, „Wiener Garten-Börse“, „Nach der Arbeit“ und „Allgemeine Gärtner-Zeitung“ stellten weitere wichtige Informationsquellen dar. Architekturzeitschriften und Magazine, wie zum Beispiel „Die Bühne“, „Mein Garten“ oder „Architektur und Baukunst“, wurden für ergänzende Recherchen herangezogen.
Quellenkritische Schwierigkeiten ergaben sich bei der Betrachtung von Festschriften und Tätigkeitsberichten von Verbänden. Der Historiker Stefan Eminger beschreibt diese treffend:
„Im Falle öffentlich-rechtlicher Organisationen mit Pflichtcharakter darf nicht umstandslos von der Politik der Verbandsführung auf die Interessen der Mitglieder geschlossen werden. Als intermediäre Instanzen transportieren Verbände nicht nur Anliegen von unten nach oben, sondern auch Zumutungen von oben nach unten. Sie waren also mehr oder weniger immer auch Partner und Adressaten. Zudem bedeutet Verbandspolitik zumeist nicht einfach den Ausgleich der Interessen seiner Basis, sondern sie spiegelte vielfach die Interessen der in der Organisation dominierenden Gruppen. Und drittens verfolgten Verbandsfunktionäre immer auch spezifische Eigeninteressen, von denen der Erhalt der Organisation und der Ausbau der Einflussmöglichkeiten besonders hervorzuheben ist.“23
Die Onlinedatenbank www.garden-cult.de erleichterte das Recherchieren in deutschen Zeitschriften wie „Die Gartenkunst“ und „Die Gartenwelt“ enorm.
Interviews mit Zeitzeugen und Nachkommen von Gartenarchitekten runden die Datensammlung ab.