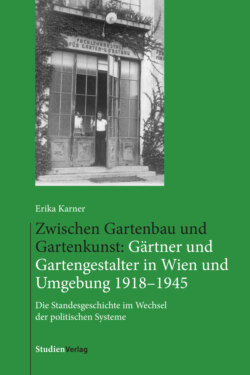Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 5
Inhalt
ОглавлениеAbbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Prolog
1 Einleitung: Zielsetzung und Abgrenzung
1.1 Die Forschungsfrage
1.2 Abgrenzung zu anderen Forschungsbereichen
1.3 Forschungsstand im Überblick
1.4 Quellen
1.5 Vorgehen
2 Politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen 1918–1945
2.1 Habsburger-Monarchie und Erster Weltkrieg
2.1.1 Die Stellung des Gartenbaus vor und während des Ersten Weltkrieges
2.1.2 Förderung der Gärtner durch den Adel
2.2 Erste Republik 1918–1933
2.2.1 Wirtschaftliche Situation
2.2.2 „Rotes Wien“ versus „schwarze“ Bundesländer
2.2.3 Sozialgesetzgebung
2.2.4 Arbeitslosigkeit
2.3 Austrofaschismus 1933–1938
2.3.1 „Berufsständische Ordnung“
2.3.2 Austrofaschismus in Wien
2.3.3 Landschaftsgärtner und Gartengestalter und der „Freiwillige Arbeitsdienst“
2.3.4 Exkurs: Gärtnerische Verflechtungen
2.4 Drittes Reich 1938–1945
2.4.1 Nationalsozialismus in Wien
2.4.2 Parteimitgliedschaft in der NSDAP
2.4.3 Widerstand, Vertreibung, Ermordung
2.4.4 Auswirkungen des „Anschlusses“ auf die jüdische Bevölkerung
2.5 Nachkriegszeit
2.5.1 „Entnazifizierung“
2.5.2 Restitution
2.6 Zusammenfassung
3 Gärtnerische Verbände und Berufsorganisationen in Wien
3.1 Die geplante Gartenbaukammer
3.2 Gesetzliche Berufsorganisationen für selbstständige Gärtner
3.2.1 Gewerberecht – Gewerbegenossenschaften
3.2.2 Genossenschaft der Gärtner von Wien und Umgebung
3.2.3 Exkurs „Gewerbebundgesetz“
3.2.4 Die Innung der Gärtner und Naturblumenbinder
3.2.5 Exkurs: Jüdische Gärtnereien
3.2.6 Bundesverband der Erwerbsgärtner Österreichs
3.2.7 Reichsnährstand / Reichskammer der bildenden Künste
3.3 Unternehmerverbände – freiwillige Interessensvertretungen
3.3.1 Der Wirtschaftsverband der landschaftsgärtnerischen Betriebe Österreichs
3.3.2 Vereinigung österreichischer Gartenarchitekten (V.Oe.G.A.)
3.4 Gesetzliche und freiwillige Berufsorganisationen für Gärtnereiarbeiter
3.4.1 Die Gehilfenversammlung der Genossenschaft der Gärtner von Wien und Umgebung
3.4.2 Gewerkschaft und Gartenbau
3.5 Sonstige Vereine
3.5.1 Verein der Gärtnerinnen Österreichs
3.5.2 Gruppe Deutsch-Österreich der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst
3.5.3 Österreichische Gartenbau-Gesellschaft (ÖGG)
3.5.4 Absolventenverbände
3.6 Zusammenfassung
4 Brennende Berufsfragen
4.1 Die Zugehörigkeitsfrage: Landwirtschaft oder Gewerbe?
4.1.1 Landwirtschaft oder Gewerbe 1920–1933
4.1.2 Gewerbeordnungsnovelle 1934
4.1.3 Verbleibende Schwierigkeiten nach der Gewerberechtsnovelle
4.1.4 „Schmutzkonkurrenz“ und „Pfuschertum“ im Gartenbau
4.2 Die Titelfrage: Welche Berufsbezeichnung für wen?
4.2.1 Die Titelfrage beschäftigt die Gartenbau-Gesellschaft
4.2.2 Die ungelöste Titelfrage bis 1938
4.2.3 Neue Aufgabenfelder für Gartenarchitekten
4.3 Gehilfen- und Lehrlingsfrage
4.3.1 Küchengärtner, Lustgärtner, Privatgärtner, Villengärtner, Handelsgärtner und deren Rechte
4.3.2 Arbeitssituation von Gehilfen in gewerblichen Gärtnereien
4.3.3 Kollektivverträge
4.3.4 Lehrlingswesen
4.3.5 Lehrlinge im Gartenbau
4.4 Die Frauenfrage
4.4.1 Mögliche Arbeitsstätten für Gärtnerinnen
4.4.2 Weibliche Lehrlinge und Gehilfen
4.5 Zusammenfassung
5 Schulische Ausbildung für Gärtner
5.1 Fachliche Fortbildungsschulen für Gärtnerlehrlinge
5.1.1 Fachliche Fortbildungsschulen für Gärtnerlehrlinge in Wien – ÖGG
5.1.2 Die fachliche Fortbildungsschule für Gärtnerlehrlinge in Wien – Fortbildungsschulrat Wien
5.2 Niedere Schulen
5.2.1 Die Gartenbauschule der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft (Gehilfenschule)
5.2.2 Gartenbauschule „Elisabethinum“ – Mödling
5.2.3 Die Fachlehranstalt für Garten- und Obstbau in Wien-Kagran
5.2.4 Die Gartenbauschule der Salesianer Don Boscos in Wien
5.2.5 Gartenbauschule zur Fürsorge für Gehörlose und Hörlose
5.3 Mittlere Schulen
5.3.1 Höhere Obst- und Gartenbauschule in Eisgrub / Lednice
5.3.2 Die Höhere Gartenbauschule der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft
5.3.3 Die Höhere Bundeslehranstalt und Bundesversuchsstation für Wein-, Obst- und Gartenbau in Klosterneuburg
5.3.4 Die Bundeslehr- und Versuchsanstalt für den Gartenbau Hetzendorf-Schönbrunn
5.4 Hochschulen/Universitäten
5.5 Gartenbauschulen für Frauen
5.5.1 Höhere Gartenbauschule für Frauen
5.5.2 Döblinger Gartenbauschule
5.5.3 Hortensium – Wiener Gartenbauschule für Knaben und Mädchen
5.5.4 Die Höhere Gartenbauschule für Frauen des Vereines für praktische Frauenbildung in Esslingen bei Wien
5.6 Zusammenfassung
6 Ausgewählte Personen und Betriebe
6.1 Frauen im Gartenbau
6.1.1 Yella Hertzka
6.1.2 Paula von Mirtow
6.1.3 Grete Salzer
6.1.4 Hanny Strauss
6.1.5 Helene Wolf
6.2 Gartenarchitekten
6.2.1 Adalbert Camillo (A. C.) Baumgartner
6.2.2 Robert Benesch
6.2.3 Josef Calta
6.2.4 Wilhelm Debor
6.2.5 Anton Eipeldauer
6.2.6 Albert Esch
6.2.7 Otto Gälzer
6.2.8 Willi Hartwich und Willi Vietsch
6.2.9 Eduard Maria Ihm
6.2.10 Fritz (Friedrich) Kratochwjle (Kratochvyle)
6.2.11 Viktor Mödlhammer
6.2.12 Josef Stowasser
6.2.13 Otto Trenkler
6.2.14 Josef Oskar Wladar
6.2.15 Willy Wolf
6.3 Zusammenfassung
7 Abschließende Betrachtungen zu den Auswirkungen der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen auf den Gartenbau und die Gartenarchitekte
7.1 Auswirkungen des Zerfalls der k. u. k. Monarchie auf den Gartenbau
7.2 Auswirkungen der Politik des „Roten Wien“ auf Gärtner und Gartengestalter
7.3 Auswirkungen des Austrofaschismus auf die Berufsgruppe
7.4 Auswirkungen des „Dritten Reichs“ auf die Gärtner und Gartenarchitekten
7.5 Nachwirkungen
7.6 Zusammenfassung
8 Epilog
Literatur
Quellen
Personenregister
Anhang