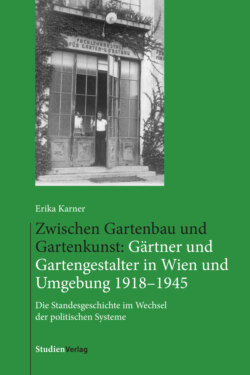Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 19
2.2 Erste Republik 1918–1933
ОглавлениеDer Zusammenbruch der Habsburger-Monarchie bedeutete für die meisten Nachfolgestaaten die Erfüllung des lange gehegten Wunsches nach territorialer und politischer Selbstständigkeit. In Österreich wurden diese Veränderungen großteils als Schock empfunden und die Reaktionen waren zwiespältig. Für viele Aristokraten und im bürgerlichen Lager waren diese Umwälzungen mit einem statusmäßigen und materiellen Verlust verbunden, unter der Arbeiterschaft jedoch herrschte zumindest anfänglich Aufbruchsstimmung.47 Dieser scharfe gesellschaftliche Kontrast prägte die am 12. November 1918 ausgerufene Republik.
Im neuen Österreich gab es nun den Wunsch des „Zusammengehens“ mit Deutschland. Der am 10. September 1919 unterzeichnete Friedensvertrag von Saint-Germain gab dem neuen Staat den Namen „Republik Österreich“ und beinhaltete ein Anschlussverbot an Deutschland. Allerdings war damit das Thema einer „Annäherung“ an Deutschland oder die Schweiz in Österreich keinesfalls vom Tisch. Denn nun kamen die Anschlussforderungen nicht aus der Bundeshauptstadt Wien, sondern aus den Bundesländern.48
In Vorarlberg gab es einige wenige Jahre hindurch eine starke Gruppierung, die für den Anschluss an die Schweiz eintrat.49 In Vorarlberg, Tirol und Salzburg wurde in Volksabstimmungen eine sehr hohe Zustimmung für den Anschluss an Deutschland erreicht. In Tirol plädierten am 24. April 1921 98,8 % der Wähler für den Zusammenschluss.50 Die Stimmung in Salzburg, Oberösterreich und in der Steiermark war vergleichbar. Die Bundesländer wollten weg vom „roten“ Wien. Abstimmungen in Oberösterreich und in der Steiermark wurden aber nicht mehr gestattet.51
Die Konflikte zwischen den zwei großen, sich in einer weltanschaulichen Polarität befindlichen politischen Lagern Österreichs, den Christlich-Sozialen und den Sozialdemokraten, sollte die weitere Geschichte des Staates – besonders nach den Geschehnissen rund um den Justizpalastbrand im Juli 1927 – bestimmen. Als drittes politisches Lager in Österreich müssen die Großdeutschen und Deutschnationalen angeführt werden. Die wachsende Feindschaft zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten zeigte sich am deutlichsten in der Aufstellung bewaffneter Verbände: auf der einen Seite die Heimwehr der Christlich-Sozialen, auf der anderen Seite der Schutzbund der Sozialdemokraten.52
Aufgrund der sich aufheizenden politischen Situation nach dem Justizpalastbrand 1927 kam es zur verstärkten Militarisierung der Verbände und schließlich im Februar 1934 zum Bürgerkrieg.53