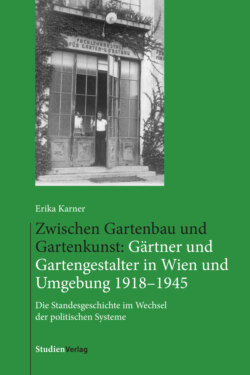Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 22
2.2.2 „Rotes Wien“ versus „schwarze“ Bundesländer
ОглавлениеWien hatte von 1918 bis 1934 eine wirtschaftliche und politische Sonderstellung inne.
Die Stadt war während der Habsburger-Monarchie aufgrund ihrer Funktion als zentrale wirtschaftliche Schaltstelle zum Angriffspunkt der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen geworden. Auf Wien lastete damit eine schwere Hypothek, zu der sich bald eine weitere – die der politischen „Andersartigkeit“ – gesellte.84
Nach dem Wahlsieg der Wiener Sozialdemokratie 1919 kam es alsbald zu großen Spannungen „zwischen dem „roten“ Wien und den „schwarzen“ Bundesländern.“85
Mit dem Beschluss der Loslösung Wiens von Niederösterreich am 29. Dezember 1921 und seiner Konstituierung als Bundesland mit 1. Jänner 1922 ergab sich für Wien eine spezielle Konstellation. Der Bürgermeister Wiens erlangte nun zusätzlich die Rechte eines Landeshauptmanns und konnte nun eine eigenständige Sozial- und Wirtschaftspolitik betreiben. Die „rote“ Sozialdemokratie hatte dadurch die Möglichkeit, einen mächtigen Gegenpol zur „schwarzen“ konservativen Vorherrschaft auf Bundesebene zu bilden.86
Wien erhielt ferner das nach der Verfassung den Ländern zustehende Steuerfindungsrecht. Ziel der Steuerpolitik des „Roten Wien“ war die Umverteilung von den oberen zu den unteren Einkommensschichten mittels der Besteuerung von Luxuskonsum.87
Diese Eigenständigkeit Wiens brachte aber nicht nur Vorteile, sondern führte zu einer zunehmenden ökonomischen und politischen Isolierung der Stadt innerhalb Österreichs.88
Die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben der neuen Stadtregierung bestanden in der Belebung der Wirtschaft und der Linderung der Wohnungsnot durch die Bereitstellung gesunder und billiger Kleinwohnungen.
Die private Wohnbautätigkeit in Wien war nach dem Ersten Weltkrieg völlig zum Erliegen gekommen – dies gab den Anstoß zu den kommunalen Wohnbauprogrammen der Stadtregierung unter der finanzpolitischen Federführung von Stadtrat Hugo Breitner. Diese Programme bildeten den wichtigsten Nachfrageimpuls, für sie wurde vorübergehend mehr als ein Viertel der Gesamtausgaben im Stadtbudget bereitgestellt, sodass sie während der 1920er-Jahre den Schwerpunkt des Gemeindehaushaltes bildeten.89
Neben dem kommunalen Wohnungsbau bildeten die Schulreform unter Otto Glöckel und die soziale Fürsorgepolitik unter Julius Tandler die drei Säulen der sozialdemokratischen Politik in Wien.90 Darüber hinaus wurde diesen drei traditionellen Säulen der Arbeiterbewegung noch eine vierte, die „kulturelle Bildungsarbeit“, hinzugefügt.91 In seiner kulturpolitischen Dimension wies das „Rote Wien“ weit über die ursprüngliche Dimension eines wohlfahrtsstaatlichen und sozialpolitisch inspirierten Modells hinaus und sicherte sich so auch die Unterstützung der Intellektuellen.92
Während der Wirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre war der Haushalt der Stadt Wien mit bedeutenden Einnahmeverlusten konfrontiert und 1931 wurde zudem der Aufteilungsschlüssel der gemeinschaftlichen Bundesabgaben zum Nachteil Wiens geändert. Nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 setzte die Regierung Dollfuß die finanzielle „Einschnürung“ der Gemeinde Wien fort und entzog ihr die Steuereinhebung der Bundesabgaben. Verzweifelt versuchte die sozialdemokratische Stadtregierung das entstehende Defizit zu begrenzen, wodurch die Wohnbautätigkeit der Gemeinde völlig zum Erliegen kam.93
Die Historikerin Maren Seliger beschrieb zusammenfassend die Situation der Sozialdemokraten in Wien und deren Gegenmodell zur Politik der Bürgerblockregierung auf Bundesebene als Kulturkampf in dem „die laizistische Sozialdemokratie als Anwältin der Moderne“ galt und das bürgerlich-bäuerlich-feudal-katholische Lager eine in vormodernen Traditionen verhaftete antiliberale Bewegung darstellte.94