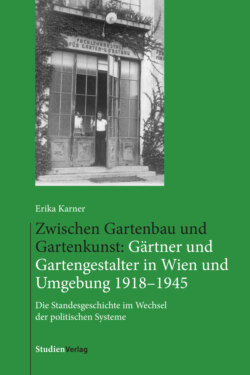Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 31
2.3.4.2 Deutsche Gärtner und Gartenarchitekten in Österreich
ОглавлениеNach dem „Anschluss“ 1938 kamen natürlich auch „reichsdeutsche“ Gartenarchitekten in Österreich zum Einsatz und sie brachten zumeist eigenes Personal mit. Der bekannte Gartenfachmann Hermann Mattern war mit der Planung und Ausführung der Außenanlagen der „Krupp-Anlage“ im niederösterreichischen Berndorf beauftragt und setzte seinen Mitarbeiter Heinz Schulze als Bauleiter ein.150 Er war auch als „Landschaftsanwalt“151 für Alwin Seifert tätig und mit der Gestaltung der Grünflächen der Autobahn Wien – Brünn – Breslau beauftragt.152 Neben Mattern arbeiteten Ludwig Schnizlein153 und Friedrich Heiler154 als Landschaftsanwälte in Österreich (damals Ostmark).
In Wien avancierte 1941, nach der Zwangspensionierung von Fritz Kratochwjle, der deutsche Gartentechniker Rudolf Stier zum Wiener Gartenamtsleiter. Er hatte diese Position bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs inne.155
Rudolf Stier war allerdings nicht der erste deutsche Leiter des Wiener Stadtgartenamtes. Bereits 1861 wurde der gebürtige Leipziger Rudolph Siebeck zum ersten Wiener Stadtgärtner und 1871 zum ersten städtischen Gartendirektor bestellt. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten zählt die – gemeinsam mit dem Landschaftsmaler Josef Selleny geplante – Anlage des Wiener Stadtparks. Siebeck hatte die Leitung der Stadtgartendirektion bis 1878 inne.156
Nur wenige Jahre später, 1884, wurde der in Frankfurt am Main geborene Gustav Sennholz zum Leiter des Stadtgartenamtes bestellt. Er hatte zuvor eine Ausbildung an der Gärtnerlehranstalt Wildpark-Potsdam absolviert und danach bei den Gebrüdern Siesmayer gearbeitet.157 Sein Name ist in Wien fest mit der Anlage des Türkenschanzparks verbunden. Während seiner Amtszeit – sie dauerte bis 1895, verbesserte er die Standortbedingungen der Ringstraßenbäume, wandelte den alten Hernalser Friedhof in einen Park um und gestaltete die Grünflächen bei der Karlskirche.158
Auch abseits der städtischen Gärten zog es Baumschulisten und Gartenarchitekten nach Wien. So etwa Gustav Frahm159, er stammte aus Holstein und gründete 1898 in Tullnerbach-Preßbaum die Baumschule Holsatia. Er selbst kehrte 1910 wieder in seine Heimat zurück. Die Baumschule wurde von seinem Schwiegersohn Wilhelm Dressen weitergeführt und 1920 an den jüdischen Unternehmer Siegfried Kann verkauft.160 Im März 1903 übersiedelte der in Münsterberg in Schlesien geborene Viktor Goebel nach Wien.161 Bereits 1905 schien sein Büro im Branchenverzeichnis in der Rubrik „Landschaftsgärtner und Garten-Architekten“ auf.162 Er gründete eine Baumschule samt Staudengärtnerei und war als Planer, etwa für Erzherzog Franz Ferdinand, sehr erfolgreich. Goebel war bis zu seinem Tod 1924 in Wien aktiv.163
Im Jahre 1912 übersiedelte der am 23. September 1888 in Berlin geborene Alfred Kasulke nach Wien um als Geschäftsführer der Firma J.L. van Eynelhoben ein Jahr lang tätig zu sein. Im darauffolgenden Jahr arbeitete er als Gartenarchitekt im „Gartenbauetablissement“ W. Stingl, dorthin sollten noch einige Landsmänner nachfolgen.164
In den 1920er-Jahren zog es viele Deutsche nach Wien. Der Gartenbaubetrieb Hermann Rothe A.G. plante eine Zweigniederlassung in Wien und rekrutierte Gartentechniker.165 Auf diesem Weg kam Wilhelm Hartwich nach Wien, etwas später traf Wilhelm Vietsch ein. Die beiden gründeten die Unternehmung Hartwich und Vietsch.166
Ungefähr zur selben Zeit übersiedelte auch Wilhelm Wolf nach Österreich. Er arbeitete zunächst als Gartentechniker in Wien, heiratete aber 1926 Helene Pollak und führte mit ihr bis 1938 gemeinsam die Gärtnerei „Helenium“. Wolf war auch berufspolitisch sehr aktiv und gründete gemeinsam mit anderen die „Vereinigung der Gartengestalter Österreichs“.167
Um 1923 kam Wilhelm Schmidt nach Wien.168 Er war zunächst bei Wilhelm Debor, später bei der Firma Gebhardt & Füssl beschäftigt und übersiedelte 1929 nach seiner Berufung in das städtische Gartenamt Essen wieder nach Deutschland. Schmidt war maßgeblich an der Gründung der Gruppe Deutsch-Österreich der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst beteiligt und war bis 1929 auch deren Vorstand.169
Ebenfalls Mitte der 1920er-Jahre verschlug es den gebürtigen Rheinländer Otto Gälzer nach Wien. Er arbeitete zunächst bei Wilhelm Debor, später bei Wenzel Stingl und gründete 1930 seinen eigenen Betrieb, der rasch zu einem der größten landschaftsgärtnerischen Betriebe Österreichs wurde. Aufgrund seiner deutschen Herkunft und der Kontakte zur NSDAP bekam er 1939 auch den Auftrag zur Ausführung der landschaftsgärtnerischen Arbeiten der eingangs erwähnten „Krupp-Anlage“ in Berndorf.170
Wie stark die Konkurrenz zwischen den in Wien ansässigen deutschen Gartenarchitekten und den einheimischen Gartenarchitekten war, ist schwer zu sagen. Es gibt viele Hinweise auf eine gute berufliche Zusammenarbeit und freundschaftliche Verbindungen. Die Bruchlinien innerhalb der Berufsgruppe der Gartenarchitekten verliefen eher entlang politischer und weltanschaulicher Grenzen. Mit dem „Anschluss“ 1938 änderte sich dieses Bild jedoch, da nun „Reichsdeutsche“ sowohl bei der Ämtervergabe als auch bei Aufträgen eher bedacht wurden. Dies belegt unter anderem eine Aussage Albert Eschs, der 1946 erklärte, durch Otto Gälzer und Alwin Seifert künstlerisch (gemeint war damit wohl auch ökonomisch) unterdrückt worden zu sein.171