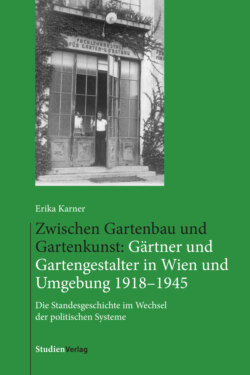Читать книгу Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945 - Erika Karner - Страница 32
2.3.4.3 Entwicklungen im deutschen Gartenbau ab 1933
ОглавлениеMit der im Jänner 1933 erfolgten Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler begann die Transformation Deutschlands zu einem totalitären Staat. Erklärtes Ziel der Machthaber war die absolute Kontrolle von Bürgern und Organisationen durch die NSDAP und ihre Organe.
Für den deutschen Gartenbau bedeutete dies die Neuordnung der Berufsgruppe172 auf allen Ebenen. Gustav Allinger, ab 1933 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, begrüßte diese Neuorganisation und kündigte eine radikale Änderung der Verbandsstrukturen an:
„Nachdem die Idee des Nationalsozialismus nach jahrelangem Kampf den Sieg errungen und Adolf Hitler die Reichsgewalt übernommen hatte, sind die politischen und wirtschaftspolitischen Ziele eindeutig festgelegt. Gleichzeitig aber ist von der Führung des Reiches und der Länder und mit maßgebender Unterstützung der dafür eingesetzten parteiamtlichen Stellen der NSDAP. auch die große berufsständische und kulturelle Neuordnung zielbewußt eingeleitet worden. Es ist selbstverständlich, daß im Zuge dieser Neuordnung auch die bisher vorhandenen Berufs- oder Liebhaberverbände des Gartenbaues und der Gartengestaltung von der Bewegung erfaßt werden müssen, daß ihre Arbeit auf eine neue Grundlage gestellt wird und daß sie gleichzeitig auf Grund der neuen Eingliederung auch neue Aufgaben zugewiesen erhalten. Ebenso selbstverständlich aber ist, daß diejenigen Verbände oder Vereinigungen, die in den letzten Jahren schon nicht recht lebensfähig waren, oder die sonst wie als entbehrlich und überflüssig, vielleicht sogar als für die Berufseinheit schädlich bezeichnet werden müssen, restlos zu verschwinden haben.“173
Es sollte die „Einheitsfront des Gartenbaues“ geschaffen werden die sich aus dem „berufsständischen Aufbau“, dem „kulturellen Aufbau“ und dem „Aufbau der Arbeitsfront“ zusammensetzte.174 Die Umsetzung der Neuorganisation des berufsständischen Aufbaues wurde im Auftrag des Reichsbauernführer Darré vom „Reichsverband des Deutschen Gartenbaues“ übernommen. Dieser Verband wurde bereits im April 1933 mit der „Zusammenfassung und Gleichschaltung aller Vereine und Verbände des Erwerbsgartenbaues einschließlich der Landschaftsgärtner […] durch das Amt für Agrarpolitik der NSDAP. beauftragt“,175 im Herbst 1933 war dieser Auftrag beinahe vollständig ausgeführt.
Der „Reichsverband des Deutschen Gartenbaues“ übernahm zusehends die Funktion der Interessenvertretung des gesamten Gartenbaues und untergliederte sich in folgende Fachgruppen: Obstbau, Gemüsebau, Samenbau, Blumen- und Pflanzenbau, Baumschulen, Garten-, Park- und Friedhofsgestaltung und Behördengartenbau. Jede dieser Gruppen hatte einen ehrenamtlichen „Führer“ und konnte nach Bedarf in Sondergruppen aufgeteilt werden. So differenzierte sich beispielsweise die Gruppe Garten-, Park und Friedhofsgestaltung, deren „Führer“ Gustav Allinger war, in die Sondergruppen Deutsche Gartenarchitekten, Gartenausführende und Friedhofsgärtner.176
Der Reichsverband wurde unter der Leitung von Johann Boettner später zur Gänze in den Reichsnährstand eingegliedert und Boettner zum ehrenamtlichen Leiter des Erwerbsgartenbaues ernannt.177 Wilhelm Ebert wurde Leiter der Unterabteilung Gartenbau im Reichsnährstand.178
Um auch den kulturellen Aufbau voranzutreiben, wurde „im Einvernehmen mit dem Kampfbund für deutsche Kultur“ und im Auftrag von dessen Reichsorganisationsleiter Hans Hinkel die „Deutsche Gesellschaft für Gartenkultur“ gegründet und alle Gartenbauvereine – seien es gartenkünstlerische, wissenschaftliche oder Laienvereine – wurden ihr eingegliedert, jüdische Mitglieder waren selbstverständlich bereits vorher ausgeschlossen worden.179 Die Gesellschaft für Gartenkultur war ebenfalls untergliedert und zwar thematisch in einen Bereich für gartenkünstlerische Vereine (hier sollte die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst die Führungsrolle übernehmen), einen Bereich für botanische Vereine (Deutsche Dahliengesellschaft, Kakteenfreunde, Rosenfreunde etc.) und einen Bereich für allgemeine Gartenkultur (Deutsche Gartenbau-Gesellschaft). Präsident der Gesellschaft für Gartenkultur war Johann Boettner.180 Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst (DGfG) wurde im Zuge dieser Zusammenlegungen deutlich in ihrer pluralistischen Ausrichtung beschnitten.
„Die DGfG. wird sich künftig auf ihre kulturellen Aufgaben beschränken und kein Tummelplatz mehr sein zur Austragung von Sonderinteressen beamteter oder freischaffender Berufsgenossen. […] Die Geschäftsstelle der DGfG. wird nach Berlin verlegt, so daß die Erledigung der Arbeiten von zentraler Stelle rasch und reibungslos möglich sein wird. Es wird ferner sorgfältig überprüft werden, ob die Gestaltung, Erscheinungsweise und die Schriftleitung der Zeitschrift ‚Gartenkunst‘ im Zusammenhang mit den Maßnahmen der ‚Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur‘ Änderungen erfahren soll und kann, mit dem Ziel, die Zeitschrift und die von ihr erörterten Ideen einem weit größeren Kreis von Personen, vor allen Dingen aber der Jugend, zugänglich zu machen.“181
Die Zeitschrift „Gartenkunst“ diente ab diesem Zeitpunkt der Verbreitung der NSIdeologie im Gartenbau – sie war zu einem Propagandainstrument geworden. Auf diese Weise kamen auch die Mitglieder der Sektion Österreich der DGfG in direkten Kontakt mit den Anschauungen des NS-Regimes.