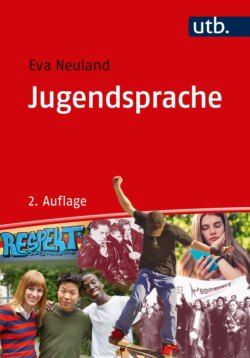Читать книгу Jugendsprache - Eva Neuland - Страница 12
2.3 Brennpunkte der aktuellen SprachkritikSprachkritik
ОглавлениеDie Brennpunkte der aktuellen SprachkritikSprachkritik sind wiederum zeitdiagnostisch aufschlussreich im Hinblick auf die Analyse von heute vorherrschenden Vorstellungen von Sprachgebrauch und Sozialverhalten. Jugendliche und ihre Eltern unterscheiden sich heute – im Unterschied zu der „skeptischen“ und der „antiautoritären“ Nachkriegsgeneration – kaum mehr in Kleidung, Freizeitvorlieben und Lebensstil, und auch der Sprachstil von Erwachsenen ist heute informeller als früher geworden. Im Unterschied zu der Großelterngeneration sind die meisten Eltern heute nicht mehr so schockiert über „unanständige Ausdrücke“ wie frühere Generationen. Im Zuge sozialer und kultureller Entgrenzungen sind Grenzüberschreitungen, auch verbale, heute zumindest seltener als früher geworden.
Dennoch bleiben im medialen Diskurs hauptsächlich die folgenden 4 Brennpunkte der aktuellen Kritik am Sprachgebrauch von Jugendlichen.1
Jugendsprache als FäkalspracheFäkalspracheDer Vorwurf der „unanständigen“ Ausdrücke von Jugendlichen wurde schon in früheren Phasen der Sprachgeschichte erhoben. Und auch aktuell erregen Fäkal- und Sexualausdrücke (z.B. fick dich, Wichser) öffentliche Missbilligungen. Ob solche Ausdrücke tatsächlich von Jugendlichen häufiger als von Erwachsenen verwendet werden, ist wissenschaftlich nicht belegt. Vielmehr hat die Jugendsprachforschung inzwischen nachgewiesen, dass solche Ausdrucksweisen in der intragruppalen Jugendkommunikation überwiegend nicht in beleidigender provozierender, vielmehr oft auch in scherzhafter Absicht verwendet werden.2 In jugendtypischer Hinsicht werden die Bedeutungen gegenüber der Standardsprache oft erweitert, wie das Beispiel des Ausdrucks geil als positive Wertungsbezeichnung zeigt.
Jugendsprache als ComicspracheComicspracheEs ist ein weitverbreitetes Vorurteil, dass Jugendliche sich nur noch in einer Art „,LallwörterLallwörter“-Kommunikation ausdrücken, keine Grammatik mehr beherrschen und kein SprachgefühlSprachgefühl mehr besitzen würden. Die moderne Variante dieser These bezieht sich auf den medientypischen Sprachgebrauch des sog. „Simsens“ und „Chattens“ mit seinen AbkürzungenAbkürzungen (z.B. cu für see you, lol für laughing out loud), InflektivkonstruktionenInflektivkonstruktion (grins, heul, freu) und nicht normgerechten Schreibweisen (froi, 4u) und führt zu der Befürchtung, dass sich ein solcher Sprachgebrauch allgemein bei Jugendlichen einbürgern könne. Abgesehen davon, dass der witzige Effekt gerade den medialen Kontext voraussetzt, findet diese Befürchtung keine wissenschaftliche Bestätigung.3Dürscheid, Christa
Jugendsprache als DenglischDie öffentliche Kritik an einem Übermaß an EntlehnungenEntlehnungen aus Fremdsprachen ist ebenfalls aus der Sprachgeschichte bekannt. Im 18. Jahrhundert nahm es die Form einer Kritik an Entlehnungen aus dem Französischen an. Damals lautete der Vorwurf „Petitmätereipetits maîtres, Petitmäterei“.4 Heute wird, vor allem in der medialen Berichterstattung, die Furcht vor „Denglisch“„Denglisch“, einer deutsch-englischen SprachmischungSprachmischung, geschürt, die als Hauptursache eines vermeintlichen „SprachverfallsSprachverfall“ des Deutschen angesehen wird. So lamentiert die Zeitung „Sprachnachrichten“ des Vereins für deutsche Sprache:
Mittelgroße Katastrophe: Eine Million sprachloser Jugendlicher
Ein alltägliches Ausnahmeerlebnis: Dönerbude oder Kassenschlange im Supermarkt. Deutsche, türkische und aus Rußland stammende Jugendliche reden miteinander. Ihr gesprochenes Deutsch ist fehlerhaft. Grammatik, LexikLexik und Aussprache weichen ganz erheblich von den anerkannten Regeln ab. Zunächst möchte der Zuhörer gern glauben, Zeuge einer sprachlichen Spielerei zu sein, doch lässt sich diese Illusion nur kurze Zeit aufrechterhalten. Nach einigen Minuten ist die Erkenntnis nicht mehr zu unterdrücken: Diese jungen Menschen können kein Deutsch. […]
(In: VDS Sprachnachrichten 1/2008, S. 1. von R. Pogarell)
Jugendsprache als KanakspracheKanaksprache, Kanak-SprakDie Sorge vor fremdsprachlichen Elementen in der deutschen Sprache war in der Geschichte des SprachpurismusSprachpurismus schon immer ein Spiegel der Furcht vor „Überfremdung“, die auch in Zeiten einer zunehmenden multikulturellen Zusammensetzung der heutigen Gesellschaft fortlebt. Die Kritik an SprachmischungenSprachmischung wird aktuell zugespitzt mit dem Terminus „KanakspracheKanaksprache, Kanak-Sprak“ ausgedrückt. Damit ist die Befürchtung gemeint, dass sich nun auch deutsche Jugendliche nur noch in einer Mischung von Deutsch und Türkisch oder auch in einer Mischung von Deutsch und Russisch verständigen würden. So folgerte bereits die Süddeutsche Zeitung am 20.03.2007:
Yalla, lan! Bin ich Kino? Heute verändern Arabisch, Russisch oder Türkisch die UmgangsspracheUmgangssprache der Jugendlichen stärker als alle AnglizismenAnglizismus/Anglizismen.
Tatsächlich lassen sich in Untersuchungen des Sprachgebrauchs Jugendlicher Wendungen wie hadi tschüss (Neuland/Schubert/Steffin 2007) als VerabschiedungsformelVerabschiedungsformeln oder lan als AnredeformAnredeformen entdecken. Sie lassen sich als Sprachkontaktphänomene aus den multilingualen Zusammensetzungen von Schulklassen in Deutschland erklären. Ausdrucksweisen wie: ich geh Kino, die wegen der fehlenden Präposition als typisch für KanakspracheKanaksprache, Kanak-Sprak oder KiezdeutschKiezdeutsch angesehen werden,5 offenbaren jedoch nicht unbedingt Defizite in der Beherrschung der Grammatik der deutschen Sprache. Vielmehr können sie auch bewusst als AnspielungenAnspielung auf ein solches Klischee funktionieren und machen in jedem Fall eine genaue Kontextanalyse erforderlich.
Jugendliche Sprach- und Lebensstile bilden Projektionsflächen für diese und weitere Kritikpunkte und Besorgnisse. Kontrastiert man die medial vermittelten öffentlichen Kritikpunkte an der Jugendsprache mit Ergebnissen sprachwissenschaftlicher Forschung, so können nahezu alle Kritikpunkte relativiert oder widerlegt werden. Deshalb liegt die Schlussfolgerung nahe, dass sich diese Kritik gar nicht auf den tatsächlichen Sprachgebrauch Jugendlicher richtet, sondern dass sie sich vielmehr auf die in den Medien selbst präsentierte „Jugendsprache“ bezieht. Im Brennpunkt der öffentlichen SprachkritikSprachkritik steht weniger der authentische Sprachgebrauch der Jugendlichen als die medial konstruierte „Jugendsprache“. Insofern ergibt sich geradezu ein circulus vitiosus: In den Medien wird genau das kritisiert, was zuvor selbst erzeugt wurde.