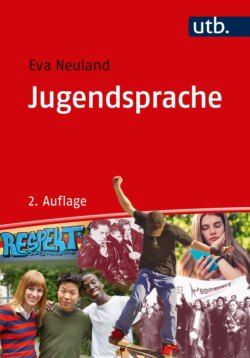Читать книгу Jugendsprache - Eva Neuland - Страница 7
1.2 Jugendsprache als Symptom für „SprachverfallSprachverfall“?
ОглавлениеMit den JugendrevoltenJugendrevolte sind aber auch die sprachlichen Äußerungsformen Jugendlicher zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung geworden. In ganz unterschiedlich motivierten Zusammenhängen wurde in der damaligen Zeit „die Jugendsprache“ von Vertretern aus Politik und Wirtschaft, aber auch von Eltern- und Lehrerschaft als „FäkalspracheFäkalsprache“ oder auch „ComicspracheComicsprache“ abgewertet und als Exempel für Normverweigerung, für SprachverfallSprachverfall bis hin zur SprachlosigkeitSprachlosigkeit kritisiert. Während der Vorwurf der Verwendung „unanständiger“ Ausdrücke von Jugendlichen sich bis in die Sprachgeschichte zurückverfolgen lässt, ist die Kritisierung als eine „Comicsprache“ terminologisch neu und lenkt den missbilligenden Blick auf die Verwendung von Laut- und Kurzwörtern.1 Doch ist das dahinter stehende Argument, dass Jugendliche keine Grammatik mehr beherrschen und kein SprachgefühlSprachgefühl mehr haben würden, zumindest aus der Tradition der SprachpflegeSprachpflege und SprachkritikSprachkritik der Nachkriegszeit bekannt.
Der Topos der SprachlosigkeitSprachlosigkeit und speziell der Gesprächsunfähigkeit ist im politischen Kontext der Zeit besonders aufschlussreich. Die Dokumentation des Schriftstellers Peter RoosRoos, Peter „Kaputte Gespräche“ hat solche Äußerungen von Vertretern der politischen Öffentlichkeit und fast aller Parteien festgehalten.
Abb. I.1.2:
Titelblatt RoosRoos, Peter 1982
So klagte die Literaturwissenschaftlerin und damalige CDU-Abgeordnete Gertrud Höhler in einer Wochenzeitung über ein Gespräch mit Gymnasiasten:
Diese Jugend, wenn sie uns ihre Formeln fürs Weltgeschehen auftischt, redet gar nicht mehr mit uns. Sie schirmt sich durch Sprachsignale ab, die ihre Gruppensolidarität stabilisieren.2Roos, Peter
Und ein ähnlicher Tenor spricht aus dem folgenden Zitat des damaligen SPD-Abgeordneten Peter Glotz:
Es gibt ja eine breiter werdende Diskussion über den Narzissmus der jungen Generation, also einen ganz bestimmten psychologischen Zug, das In-sich- selbst-Zurückziehen und die Nachteile, die daraus für das Persönlichkeitsbild entstehen, eben die Kommunikationslosigkeit, dieses stumme In-sich-Zurückziehen-und-dort-die-Gefühle-Selbermachen, sozusagen ohne Außenwelt.3Roos, Peter
Verallgemeinernd kann festgehalten werden: Wann immer vom drohenden „SprachverfallSprachverfall“ oder gar vom „Verlust der Schriftkultur“ die Rede ist, wurde und wird die Sprache der Jugendlichen als abschreckendes Beispiel genannt:
Vertreter aus Industrie und Wirtschaft beklagen nachlassende Grammatik- und vor allem Rechtschreibkenntnisse bei jugendlichen Berufsanfängern.
Lehrer wie Hochschullehrer kritisieren Ausdrucksschwächen und mangelndes SprachgefühlSprachgefühl bei Schülern und Studierenden.
Politiker und Journalisten haben bei einer ganzen Generation „DialogverweigerungDialogverweigerung“, ja, „DialogunfähigkeitDialogunfähigkeit“ diagnostiziert.
In Leserbriefen machen Zeitungsleser ihrer Empörung über den „Vulgärjargon“„Vulgärjargon“ und das „Comicdeutsch“ Jugendlicher Luft.
Solche Negativurteile über die Sprache Jugendlicher sind in der deutschen Sprachgeschichte nicht neu. Neu jedoch ist ihre massenmediale Verbreitung in der Öffentlichkeit. Presseberichterstattung und publizistische SprachkritikSprachkritik tragen oft maßgeblich zu solcher Meinungsbildung bei.
Dies demonstriert exemplarisch jener bereits oft zitierte Titel der Wochenschrift DER SPIEGEL „Deutsch: Ächz, Würg. Eine Industrienation verlernt ihre Sprache“ vom Juli 1984:
Abb. I.1.3:
Titelblatt DER SPIEGEL 1984
Zum Beleg der These vom SprachverfallSprachverfall werden in bunter Mischung Zitate und Beispiele präsentiert: kommunikationstechnologische Entwicklungen, zunehmender Gebrauch der neuen elektronischen aber auch extensive Nutzung der audiovisuellen Medien, das Vorherrschen von Piktogrammen und Formularvordrucken im alltäglichen Leben. Bemerkenswerterweise werden aber auch die Reformkonzepte des Deutschunterrichts und der BildungspolitikBildungspolitik der 70er Jahre in einem Atemzug für die vermeintlichen Verluste an Schriftsprachkultur verantwortlich gemacht.
Die öffentliche Verbreitung solcher subjektiven Meinungsäußerungen, die durch keinerlei wissenschaftliche Belege gestützt werden, erweist sich als mehrfach problematisch4Neuland, Eva:
Einerseits trägt sie zu einer vorschnellen und einseitigen bis hin zu sachlich falschen Meinungsbildung in der Öffentlichkeit bei mit dem Effekt, dass Veränderungen im Sprachgebrauch oft als Fehler, Mängel oder Defizite angesehen werden, während sie vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus als übliche Prozesse von SprachwandelSprachwandel beschrieben werden. Die Linguistik bezeichnet solche Laienurteile über „SprachverfallSprachverfall“ als einen „Mythos“5Klein, Wolfgang und als „Mär vom Yeti“6Sieber, Peter/Sitta, HorstSitta, Horst.
Andererseits ist aber eine solche Berichterstattung problematisch im Hinblick auf die Folgerungen, die daraus gezogen werden. Diese zeigen sich vor allem im Bereich der BildungspolitikBildungspolitik, wenn etwa gefordert wird, dass im Deutschunterricht wieder mehr traditioneller Grammatikunterricht erteilt und klassische Literatur auswendig gelernt werden soll.
Diese Prozesse veranschaulicht das folgende Beispiel eines Pressekommentars der Tageszeitung: Die Welt aus dem Jahr 1986 über eine wissenschaftliche Konferenz, auf der eine Meinungsumfrage zu Thema: Veränderungen im heutigen Deutsch vorgestellt wurde.7Stickel, Gerhard/Volz, Norbert Meinungen über den Sprachgebrauch werden dabei vorschnell als Tatsachenfeststellungen ausgegeben und die Schuld am vermeintlichen „SprachverfallSprachverfall“ den Reformen des Deutschunterrichts zugeschrieben.
Der Kommentar: Sprachverfall
[…] Mehr als achtzig Prozent der Befragten sehen das Deutsche auf der Straße des Verfalls. Die Verschlampung der Sprachregeln, das Fachchinesisch der Experten, die Null-Bock- und Sprechblasensprache der Jugendlichen und die Überflutung mit Fremdwörtern werden meistens beklagt – und es ist kein Wunder, daß diese Erscheinungen den Älteren am meisten auffallen: sie haben in ihrer Jugend noch einen gründlichen, an der Hochsprache der Klassiker geschulten Deutschunterricht erhal- ten. […] Was man die gehobene, formvollendete Ausdrucksweise nennt, was in unse- ren Nachbarländern im Westen wie übrigens im Osten mit Recht Kultursprache heißt, das verhöhnen Linguisten und Didaktiker als „elaborierten Code“. Statt Grammatik und Goethe setzten sie den Kindern Bierdeckel und Plakate als Themen des Deutsch- unterrichts vor. Man muß sich nicht darüber wundern, daß dadurch Sprachwissen und Sprachbeherrschung für eine ganze Generation vergeudet und zerstört wurden. […]
(In: Die Welt, 15.03.1986: Sprachverfall, Kommentar von D. Guratzsch)
Eine andere Sicht auf die These von der Jugendsprache als Symptom für SprachverfallSprachverfall sowie für DialogunfähigkeitDialogunfähigkeit erschließt sich allerdings, wenn einige der damals tatsächlich stattgefundenen Gespräche zwischen Politikern und Jugendlichen mit den Mitteln der GesprächsanalyseGesprächsanalyse genauer untersucht werden. Die o.g. Publikation des Schriftstellers Peter RoosRoos, Peter von 1982 unter dem bezeichnenden Titel „Kaputte Gespräche“ dokumentiert ein solches Gespräch des damaligen Bundeskanzlers Schmidt mit einer Gruppe von Lehrlingen im Bundeskanzleramt. Roos hat dieses Gespräch nicht nur auszugsweise dokumentiert, sondern zugleich auch aus zeitgenössischer Sicht und stellvertretend für die Jugendlichen kommentiert. Dabei weist er auf, dass die Gründe für das Misslingen von Gesprächen nicht einseitig und verkürzt den Jugendlichen angelastet werden können, die sich mit ihren ZwischenrufenZwischenrufe aus der Sicht der Politiker und der von ihnen bestimmten Gesprächsführung nicht mehr an die Regeln halten.
Gesprächsanalytisch lässt sich zeigen, dass im Verlauf des politisch inszenierten Dialogs den Jugendlichen immer mehr die Rolle von Zwischenrufern zugewiesen wird. Die in den 80er Jahren vorgebrachte These von der vermeintlichen „DialogunfähigkeitDialogunfähigkeit“ von Jugendlichen kann zum großen Teil als eine vordergründige politische Taktik entlarvt werden, missliebige Meinungen und veränderte Sprachgewohnheiten Jugendlicher zu diskreditieren. Dass eine solche „Dialogunfähigkeit“ von Jugendlichen nicht generell gegeben ist, sondern vielmehr punktuell hergestellt wurde, dies zeigen andere „Dialoge“ mit der Jugend von Politikern, denen es besser gelungen ist, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.8