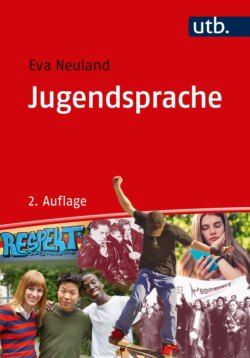Читать книгу Jugendsprache - Eva Neuland - Страница 8
1.3 Jugendlicher Sprach- und Lebensstil als Projektionsobjekt
ОглавлениеFragen wir weiter nach Gründen für die durch die Intensität der öffentlichen Diskussion dokumentierte Anziehungskraft des Themas „Jugend“ und „Jugendsprache“ auf „erwachsene“ Vertreter älterer Generationen und für das damalige Vorherrschen kritischer Sichtweisen und Negativurteile, rücken neben dem gesellschaftspolitischen Rahmen des Spannungsverhältnisses zwischen den Generationen auch sozialpsychologische Aspekte der Identifikation und ProjektionProjektion in den Blick. So lässt sich zumindest ein Teil der Negativurteile der älteren Generationen aus dem Funktionieren jenes Projektionsmechanismus erklären, durch den die „ehemaligen“ Jugendlichen ihre eigene Lebensgeschichte mit ihren erfüllten und unerfüllten Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen auf die heutigen Jugendlichen übertragen. Insofern machen die in der Öffentlichkeit als auch in vielen privaten Diskussionen vorgebrachten Argumente stets auch und vielleicht sogar eher Aussagen über die Diskutanten selbst.1Neuland, Eva
Dabei ist der Projektionsvorgang sicherlich nicht vordergründig allein so zu verstehen, dass die Erwachsenen in den Jugendlichen ihre eigenen Verhaltensweisen und Wertvorstellungen nur unzureichend verkörpert sehen, wie es eine sprachpflegerische These vom SprachverfallSprachverfall der heutigen Jugend nahelegen könnte. Eine nicht nur sprachliche Sittenlosigkeit – die „wir uns früher nie gewagt hätten“, um es an einem Alltagsargument zu verdeutlichen – kann daneben auch als Zeichen einer selbst nie gelebten Normübertretung oder Befreiung von gesellschaftlichen Konventionen gelten. Diese ist allenfalls ein Privileg der Jugend, das allerdings sogleich als Zeichen einer kindlichen Unreife wieder stigmatisiert wird.
Dies verdeutlicht auch das Beispiel jener Argumentationsrichtung aus den 80er Jahren, die den damaligen Jugendlichen nicht nur ein Abschirmen durch Wortsignale und Sprüche, sondern darüber hinaus auch eine Rationalitätsfeindlichkeit und Unlust zu argumentativer Auseinandersetzung, einen Mangel an analytischer Begrifflichkeit und theoretischer Abstraktionsfähigkeit vorhält. Diese Urteile können zumindest teilweise aus einem historischen Hintergrund erklärt werden: Sie resultieren vor allem aus einem Vergleich späterer Jugendsprachen mit der Schüler- und Studentensprache der „APO-Generation“, aus der Teile der so argumentierenden Eltern- und Lehrergeneration hervorgegangen sein mögen.2
In diesem Sinne begründet Klaus HolzkampHolzkamp, Klaus in seiner kulturpsychologischen Analyse dieses Spannungsverhältnis zwischen den GenerationenGeneration, das zum Teil auch Züge des Entwicklungsneids und der Jugendfeindlichkeit annehmen kann, mit einer Bedrohung des Abwehrsystems und der Lebensbewältigungsstrategien der durchschnittlich angepassten, kompromissgenötigten Erwachsenenexistenz in Form einer „Wiederkehr des Verdrängten“3 aus den verschütteten Alternativen des Kampfes um ein erfüllteres Leben“4Holzkamp, Klaus, wobei dieser Prozess dann wieder zu einer verstärkten Abwertung und Ausgrenzung der Jugendlichen führt.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein solches Motiv bei den periodisch wiederkehrenden und sich in der Argumentationsstruktur durchaus ähnelnden sprachkritischen Stimmen zur Jugendsprache in den verschiedenen historischen Epochen eine Rolle gespielt haben mag.
Daraus lässt sich schließen, dass die öffentlichen kritischen Diskurse über Jugendsprache durchaus nicht universell, sondern zeitdiagnostisch im Hinblick auf die jeweils vorherrschenden Normvorstellungen von Sprachgebrauch und Sozialverhalten zu analysieren sind. Spannungsverhältnisse zwischen den Generationen und darauf basierende ProjektionsprozesseProjektionsprozess setzen allerdings eine GenerationendifferenzGenerationendifferenz voraus, die für die 80er Jahre noch angenommen werden kann, die sich aber seitdem zunehmend zu verringern scheint.
Gegenüber der vorherrschenden Außensicht auf Jugendsprache als Objekt der SprachkritikSprachkritik soll aber auch ein Beispiel aus der damaligen öffentlichen Berichterstattung Erwähnung finden, das eine Innensicht der Jugendlichen selbst präsentiert. Und zwar verwenden diese die Jugendsprache als Mittel der Sprachkritik, vor allem als Kritik des Sprachgebrauchs von Politikern.
Dieses Beispiel stammt aus dem schulischen Kontext, und zwar aus der Beschäftigung einer Projektgruppe eines Bonner Gymnasiums mit dem Thema Jugendsprache.5 Die Schülerinnen und Schüler haben hier eine jugendsprachliche ÜbersetzungÜbersetzung einer Rede des damaligen Bundeskanzlers Kohl erarbeitet. Dabei ging es ihnen allerdings nicht um eine Wort-zu-Wort-Übersetzung; vielmehr macht ihr Textvergleich neben der Entlarvung von Phrasenhaftigkeit des politischen Sprachgebrauchspolitischer Sprachgebrauch auch auf die unterschiedlichen Erfahrungsbereiche und Sichtweisen zwischen den Generationen deutlich, und zwar sowohl in Form von Aussparungen als auch von Differenzierungen. Dazu ein Beispiel:
| Originaltext Kohl | Jugendsprachliche Übersetzung |
| Unser Staat braucht die zupackende Mitarbeit der jungen Generation. | Das Antörnen der Teenies ist für unser Land eine echt coole Sache. |
| In diesem Jahr werden alle Jugendlichen, die ausbildungswillig und ausbildungsfähig sind, eine Lehrstelle erhalten können. […] | Auch wird jeder ne geile Azubistelle raffen können. […] |
| Wir müssen der jungen Generation Hoffnung geben. | Wir müssen es als Laberköpfe endlich raffen, eh, den langhaarigen Körnerfressern, Poppern, Punks, Schleimern, Schnallis, Tunten, Prolis und Alkis den Null-Bock auf Future zu nehmen. |
Ein solches sprachkritisches und sprachspielerisches Potential der Jugendsprache wurde von der öffentlichen Kritik der damaligen Zeit völlig übersehen.