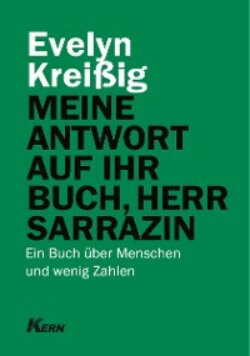Читать книгу Meine Antwort auf Ihr Buch, Herr Sarrazin - Evelyn Kreißig - Страница 21
Sprachkenntnisse und Einbürgerungstest
ОглавлениеMeine bisherigen Reisen haben sich nur auf europäische Länder beschränkt. Sie führten mich achtmal nach Kroatien, zweimal nach Slowenien und Spanien, einmal nach Italien, Dänemark, Polen, Ungarn, in die Schweiz, nach Luxemburg, nach Frankreich, nach Russland und viele Male nach Tschechien. In diesen Staaten kommt man so gut wie ohne Kenntnisse der Landessprache aus. Doch immer habe ich gemerkt, dass Englischkenntnisse von Vorteil sein können. Als ich zum Beispiel im Landesinneren von Kroatien einmal nach dem Weg fragte, verstand niemand deutsch, aber englisch schon eher. In einem Hotel in Frankreich kam ich nicht mal damit weiter, als ich einen „apple juice“ bestellen wollte, um einen Apfelsaft zu bekommen. Meine älteste Tochter, die damals in Frankreich arbeitete und später dazu kam, rettete die Situation durch Anwendung ihrer Französischkenntnisse, indem sie einen „jus de pomme“ verlangte. Auch wenn man die Landessprache eines Urlaubsortes nicht beherrscht, sehe ich es als freundliche Geste an, sich einige Worte wie „danke“, „bitte“ und Wendungen wie z. B. „Entschuldigen Sie bitte!“ und „Können Sie mir helfen?“ usw. anzueignen.
Fast am Ende der DDR-Ära bin ich 1989 mit einer Schulklasse als Auszeichnung nach Leningrad, dem heutigen Petersburg, geflogen. Ich erinnere mich, wie viel Bürokratie ich als Klassenleiterin überwinden musste, um diese Reise genehmigt zu bekommen. Das war der einzige Kontakt mit Russen, die damals noch Sowjetbürger hießen, bei dem ich meine mehr oder weniger guten Russischkenntnisse, die ich mir nach zehnjährigem Unterricht angeeignet hatte, anwenden konnte. Bis heute ist leider nicht mehr viel davon übriggeblieben, abgesehen von ein paar „Brocken“, die ich manchmal in Gespräche mit Jugendlichen aus dem russischen Sprachraum einflechte und meine Gesprächspartner aufgrund meiner andersartigen Aussprache zum Schmunzeln bringe. Dann wird mir bewusst, wie schwer es ist, eine andere Sprache zu lernen und dabei die Regeln der Aussprache und Grammatik zu beachten. Die Schwierigkeit des richtigen Schreibens kommt dazu, wenn die Buchstaben nicht dem lateinischen Alphabet entsprechen oder umgekehrt und die Schreibrichtung die entgegengesetzte, wie im Arabischen, ist. Von Timucin, der aus der Inneren Mongolei kommt, erfuhr ich, dass dort die klassische mongolische Schrift heute noch primär von oben nach unten verläuft. Wie einfach erscheint doch unsere deutsche Sprache, wenn man an die chinesische denkt, in der 3000 bis 4000 Schriftzeichen für den allgemeinen Bedarf notwendig sind.
Eine Sprache lernt man am besten, wenn man sie so oft wie möglich anwendet. Zu dieser Erkenntnis komme ich immer wieder bei meiner Arbeit mit den Jugendlichen aus den verschiedensten Sprachräumen. Wer zum Beispiel von den älteren Bewohnern des Asylbewerberheims keine Chance hat, einen Sprachkurs zu besuchen, der spricht logischerweise mit seinen Landsleuten in seiner Muttersprache. Grundlage für ein Leben in einem anderen Staat als dem Herkunftsland ist aber nun mal das Beherrschen der Landessprache in Verbindung mit der Amtssprache, erst recht, wenn man die entsprechende Staatsbürgerschaft annehmen will. Bei den Lernern meiner Gruppe spielt häufig auch der sächsische Dialekt eine Rolle beim Kommunizieren mit Einheimischen, denn die Hochsprache wird im Alltag von den wenigsten Menschen gesprochen. So geht es natürlich ebenfalls den Migranten, die sich zum Beispiel mit dem bayrischen, hessischen oder plattdeutschen Dialekt anfreunden müssen.
Ich kann nachvollziehen, dass die vielen Migranten in Deutschland ihre eigene Staatsbürgerschaft behalten wollen oder höchstens eine Doppelstaatsbürgerschaft annehmen wollen. Das weiß ich auch aus meinen Gesprächen mit vielen von ihnen, die sich damit eine mögliche Rückkehr in ihr Land offen halten wollen. Für Ausländer, die jedoch die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, wurde 2008 von der Humboldt-Universität Berlin zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen für die Bundesregierung ein 310 Fragen umfassender Test erarbeitet, den die Einbürgerungswilligen bestehen müssen. Wer 17 von 33 zufällig ausgewählte Fragen richtig beantwortet, besteht den Einbürgerungstest und darf als deutscher Staatbürger alle Rechte in Anspruch nehmen.
Im Rahmen des Tages der offenen Tür am BSZ in Freiberg habe ich die Prüfung mit deutschen Schülern und Erwachsenen gemacht, von denen sie weniger als die Hälfte bestanden haben. Zum Beispiel bei der Frage, wo man seinen Hund anmelden muss, kamen viele ins Grübeln. Ich selbst wäre auch nie auf das Einwohnermeldeamt gekommen. Aber wer beschäftigt sich schon mit solch einem Problem, bevor er nicht wirklich die Absicht hat, sich des Deutschen liebstes Haustier anzuschaffen. Ich habe die Fragen, die Kenntnisse über die Geschichte, Sprache, Kultur und das Staatswesen des Landes beinhalten, auch in der einen oder anderen Deutschstunde mit Schülern der Förderschule diskutiert und bei vielen Wissenslücken festgestellt. Fragen nach Einstellungen und Gesinnungen werden übrigens nicht gestellt, seit nach dem hessischen Entwurf eine einheitliche Regelung für Deutschland gefunden wurde.
Der aus Syrien stammende Said hat den Einbürgerungstest vor ein paar Wochen bestanden, obwohl er noch immer um seine Niederlassungserlaubnis kämpft, wo ihm andere bürokratische Hürden im Wege stehen.
Interessant ist, dass in den USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nur 10 von 100 Fragen gestellt werden, von denen sechs richtig beantwortet werden müssen. Vorausgesetzt werden allerdings eine permanente Aufenthaltsdauer von fünf Jahren und „ein guter moralischer Charakter“. Wenn man diesen nur immer so leicht erkennen würde!