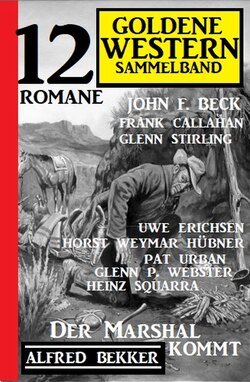Читать книгу Der Marshal kommt: Goldene Western Sammelband 12 Romane - Frank Callahan - Страница 79
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAndy Keefe dreht den Docht der Lampe höher. Die Wohnhalle wird jäh in grelles Licht getaucht, und Bryant Washburns weißes Gesicht erscheint grau. Der Rancher bewegt seinen Rollstuhl auf den Tisch zu, neben dem der Bankier steht.
Andy geht zum Fenster und lehnt sich dagegen. Am Kamin steht Roger, der auf den Bankier blickt, dem offenbar alle Felle weggeschwommen sind.
„Ich schwöre es Ihnen, Mister Keefe!“, ruft der Mann eben. „Ich habe ihm bestimmt kein Geld gegeben. Und hätte er irgendwo anders in der Stadt fünfhundert Dollar bekommen, dann wüsste ich es.“
„Irgendwoher muss er es schließlich haben“, knurrt der Rancher. „Washburn, wenn Sie gegen mich arbeiten, hebe ich mein Guthaben ab! Und zwar auf einen Schlag. Was das für Ihr Geschäft bedeutet, wissen Sie wohl.“
„Ja, Mister Keefe. Aber ich schwöre Ihnen, dass ich keine Ahnung habe!“
Berton Keefe mustert den vornehmen Bankier im Prince-Albert-Rock noch immer scharf. Dann nickt er kaum sichtbar.
„Gut, Washburn. Haben Sie noch mehr Schuldscheine von Pegg, oder von Vester Buck?“
„Nein, Mister Keefe.“
Der Rancher nickt noch einmal und macht eine abschließende Handbewegung. Der Bankier verneigt sich und geht.
Roger folgt ihm langsam. Im Flur hört er Andys Schritte hinter sich.
„Wir danken Ihnen für den Besuch, Mister Washburn“, sagt Roger, als der Bankier die Treppe hinuntersteigt.
Washburn blickt sich um und lächelt schwach. Dann geht er weiter und steigt auf sein Pferd, das ein Cowboy von der Zügelstange am Brunnen losgemacht und herangeführt hat.
Andy lehnt sich gegen einen Stützpfosten. Er schaut seinen Bruder von der Seite an.
„Seltsam, nicht wahr?“, meint er.
„Was?“
„Nun, dass dieser arme Schlucker plötzlich fünfhundert Dollar hatte. Oder hat dich das nicht verblüfft?“
Roger bemerkt den forschenden und leicht ironischen Blick.
„Doch“, sagt er gedehnt. „Es hat mich sehr gewundert.“ Er wendet sich um und geht ins Haus zurück. Andy folgt ihm.
Der Rancher hat seinen Rollstuhl neben den Kamin gefahren und Holz auf das Feuer geworfen. Die Nächte sind schon sehr kühl, obwohl die Tage noch heiß sind. Der rötliche Flammenschein leuchtet im rauen Gesicht des Ranchers wider.
„Washburn hat ihm kein Geld gegeben“, sagt er. „Ich kenne ihn. Er ist ein Feigling. Wahrscheinlich hasst er mich, weil ich mächtiger bin als er. Aber seine Angst vor mir ist groß. Größer als der Hass auf jeden Fall.“
Andy nickt. „Sonst dürfte es in Collins aber keinen Mann geben, der fünfhundert Dollar einem Mann geben kann, von dem er mit ziemlicher Sicherheit weiß, dass er sie nie mehr zurückbekommt“, wendet Andy ein, der immer noch auf seinen Bruder blickt. „Jeder kann sich an den Fingern abzählen, dass Pegg so und so nicht mehr lange machen kann.“
„Wir haben gegen ihn nichts mehr in der Hand“, knurrt Berton Keefe. „Jedenfalls im Moment nicht.“
„Vielleicht gibt er von selbst auf, wenn er einsehen muss, dass er die nächste Ernte auch nicht einbringen kann.“ Andy grinst kalt.
Roger schaut ihn an. Es ist ihm, als grinse ihm der Teufel aus Andys Augen entgegen.
Der Rancher trommelt mit den Fingerspitzen auf die Armlehnen des Rollstuhles. Sein Blick ist finster in die Flammen gerichtet.
„Natürlich bringt er keine Ernte mehr ein“, schnaubt er. „Aber was nützt uns das. Er ist einer von den sturen Präriebauern, die man töten muss, damit sie aufgeben. Er und Vester Buck werden mir Schwierigkeiten machen, so lange sie leben.“
„Dann solltest du endlich einsehen, dass die Ranch groß genug ist“, sagt Roger leise. „Seine Wasserstelle brauchst du nicht. Der Snake River fließt durch dein Land. An ihm kann man mehr Rinder tränken, als es in ganz Idaho gibt.“
Der Rancher wirft den Kopf mit einem heftigen Ruck herum.
„Was“, fragt er scharf und zischend. „Was soll das heißen?“
„Er hat etwas dagegen, dass du die Ellbogen gebrauchst“, sagt Andy, dessen Grinsen schärfer geworden ist. „Er hatte schon immer etwas dagegen. Hat er es dir noch nie gesagt?“
„Roger, ich will das nie wieder hören. Die Prärie gehört den Rindern. Nicht den Schollenbrechern. Hier ist kein Platz für sie!“
Sonnenglut lastet über der Hütte und dem sandigen Platz davor. Die wenigen Rinder im Korral haben die Köpfe gedreht und blicken dem Reiter stumpf aus unterlaufenen Augen entgegen.
Knarrend öffnet sich die Tür. Ein blondes, schlankes Mädchen kommt heraus. Sie trägt ein grobes Kattunkleid und derbe Schuhe. Ein herzliches Lächeln steigt in ihr Gesicht und lässt die Augen noch blauer erscheinen.
Roger Keefe ist abgestiegen. Er lockert den Sattelgurt, zieht den Eimer aus dem Brunnenschacht und gießt Wasser in den Trog, vor dem das Pferd steht.
„Hallo, Roger“, sagt das Mädchen und bleibt vor ihm stehen. Sie hebt die Hand, um über die Nüstern des Pferdes zu streicheln.
In der Tür taucht ein alter, gebeugter und runzliger Mann auf, der die Parkerflinte an den Pfosten lehnt. Tom Pegg ist sechzig Jahre alt. Für einen Präriebauern eigentlich die Zeit, da er sich zur Ruhe setzen sollte. Aber hier wird er keine Ruhe finden, ganz davon abgesehen, dass er niemanden hat, der seine Arbeit übernehmen könnte. Seine sinnlose Arbeit, die die Rinder der großen Keefe-Ranch vernichten werden.
Roger hat es ihm mehrmals zu erklären versucht. Doch es war umsonst gewesen. Ja, Pegg ist einer der sturen Präriebauern, die nicht aufgeben. Er weiß es.
„Hallo, Helen“, murmelt er und blickt an dem Mädchen vorbei. Er fühlt sich hier unsicher, weil er genau weiß, dass der Schatten der Ranch wie ein Fluch auf dem Tal liegt. Und er gehört zu dieser Ranch, was immer er auch gegen sie unternehmen oder sagen mag. Er ist ein Teil davon. Ein Teil der Macht, auf der die Kraft des verkrüppelten und unfähigen Berton Keefe ruht. Und doch fühlt er sich machtlos. Es ist, als würde er in einem reißenden Strom schwimmen, aus dem er sich nicht zu befreien vermag.
Der Siedler nähert sich langsam.
„Ich hätte nicht gedacht, dass du mitkommst“, meint er. „Ich rede von gestern.“
„Ich konnte nicht anders. Er hat es so befohlen.“
„Und wenn er dir morgen den Befehl gibt, diese Hütte niederzubrennen? Was machst du dann? Reitest du dann?“
„Dad, du bist ungerecht“, sagt das Mädchen scharf. „Natürlich musste er mitreiten. Sonst hätte sein Vater noch Verdacht geschöpft. Ohne ihn wäre der Sturm gestern über uns hinweggegangen. Du bist undankbar! Niemand sonst hätte dir auch nur einen Dollar gegeben.“
Der Siedler wendet sich ab und stampft zum Haus zurück. Mit seinem Gewehr verschwindet er im Inneren. Roger setzt sich auf den Brunnenrand. Er ertappt sich bei der Frage, ob er zu viel riskiert.
„Hat dein Vater etwas gemerkt?“, fragt Helen.
„Nein. Noch nicht. Aber er hat Washburn kommen lassen.“
„Du hättest es nicht tun dürfen, Roger. Wenn er es merkt, wird er dich davonjagen.“
„Ja, es kann sein. Dann hat er mir eine Entscheidung abgenommen. Helen, du weißt, ich hätte die Ranch schon verlassen, wenn du mit mir von hier fortgehen würdest. Aber du willst nicht.“
„Ich kann nicht. Roger, ich kann meinen Vater nicht alleinlassen.“
„Er wird also immer bleiben?“
„Ja. Man kann ihn so wenig umstimmen wie deinen Vater. Sie sind beide stur. Nur hat mein Vater das moralische Recht auf seiner Seite. Roger, wir hätten uns nie kennenlernen dürfen. Es führt zu nichts.“
„Vielleicht sieht mein Vater doch noch ein, dass er nicht ...“
„Nein!“, unterbricht sie ihn hastig. „Niemals sieht er etwas ein. Gewiss, er wird immer älter, und einmal muss er die Leitung endgültig aus der Hand geben. Andy wird die Ranch dann führen. Glaubst du, dass es dadurch besser wird?“
„Er wäre nicht mein Vater und könnte es nie werden, Helen.“
„Und?“
„Es würde manches ändern.“
„Es würde nur einen Bruderkrieg geben. Etwas Schlimmeres kann nicht kommen.“
„Du solltest deinem Vater noch einmal erklären, dass es besser ist, wenn er sich entschließt, von hier fortzugehen. Es wäre für uns alle das beste! Wir könnten spurlos verschwinden. Das Land ist unendlich weit!“
Helen schaut ihn einen Moment an, blickt dann zum Haus und wieder zu Roger Keefe zurück.
„Ich werde es versuchen. Aber es wird sinnlos sein. — Ist es wahr, dass Rinderdiebe an der Ranch nagen?“
„Ja.“ Unbewusst macht Roger ein hartes Gesicht.
„Mein Vater hat es gehört. Er denkt, dass die Rustler auch für ihn arbeiten.“
„Er irrt sich. Sie nehmen stets nur wenige Rinder. Sie betreiben das Geschäft auf eine Art, die meinen Vater niemals ruinieren wird.“
„Noch machen sie das, Roger. Aber wenn sie erst genug Erfolg gehabt haben und auf den Geschmack gekommen sind, werden sie mehr wollen. Mehr und immer mehr! Mehr Geld bedeutet mehr Rinder! Und dann wird gegen sie etwas unternommen werden. Manchmal ist es mir, als würden wir zwei zwischen den Parteien stehen“, sagt sie versonnen. „Dabei gehören wir zu ihnen. Und was wir auch denken und wie wir fühlen mögen, wir müssen Gegner sein, Roger.“
Er hört die Bitterkeit aus ihren Worten deutlich heraus und schüttelt den Kopf.
„Du musst daran glauben, dass sofort alles anders ist, wenn wir von hier fort gehen. Das ist der reelle Weg für uns.“
„Du willst fortlaufen? Mein Vater sagt, nur Feiglinge gehen fort!“
„Ich bin dann eben ein Feigling. Vielleicht denkt jeder anders darüber. Ich meine, man muss ein Narr sein, um aussichtslose Kämpfe führen zu können.“
„Mein Vater hat es dreimal mitgemacht, Roger. Zweimal jagten sie ihn fort. Er meint, dass es überall am Ende das gleiche sein wird. Deshalb will er nicht gehen.“
Roger zieht den Bauchgurt des Sattels wieder an. Es hat keinen Sinn, weiter darüber zu reden.
„Versuche es oder lass es sein“, sagt er bitter und steigt in den Sattel.
Helen hebt die Hand, als wollte sie ihn aufhalten. Aber sie lässt sie wieder herabsinken, als er mit der Zunge schnalzt.