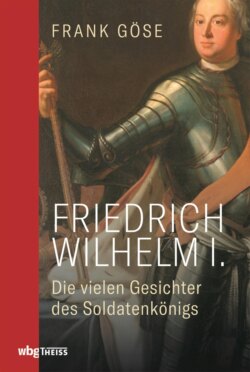Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 10
Beginnende »Soldatenspielerei« und Jagdpassion
ОглавлениеEs belegt das recht harmonische Vater-Sohn-Verhältnis und sprach zugleich für ein gewisses Gespür Friedrichs III. für die Interessen und Neigungen des Kurprinzen, dass er seinem damals zehnjährigen Sohn zu Weihnachten 1698 ein Geschenk machte, das im weiteren Leben Friedrich Wilhelms noch eine wichtige Rolle spielen sollte: Weil »Unser lieber Sohn, Chur Printz Friedrich Wilhelm, bisher nicht allein allen schuldigen Respect und Gehorsam gegen Uns bezeiget, sondern auch Fleiß und Begierde an sich spüren lassen, ein würdiger Zweig des hohen Stammes, aus welchem er entsproßen ist, zu werden«, überließ er ihm das Gut (Wendisch) Wusterhausen, etwa 30 Kilometer südlich der Residenz.19 Dieser Ort mit einem damals noch wenig anheimelnden und eher spärlich ausgestatteten Gebäude – von »Schloss« wagt man kaum zu sprechen –, aber von einem riesigen geschlossenen Waldgebiet umgeben, wurde eine Art Refugium für ihn. Nicht nur in den verbliebenen anderthalb Jahrzehnten bis zu seiner Thronbesteigung, sondern auch danach gehörten die zumeist während der herbstlichen Jagdsaison gewählten Aufenthalte zu den von ihm so geschätzten Lebensphasen. Neben seiner Jagdleidenschaft, die sich bereits früh entwickelt hatte – schon als Neunjähriger nahm er an der Jagd auf Rebhühner, Lerchen und Hasen teil –, prägte sich an diesem Ort, für den ab 1718 der bis heute gültige Name Königs Wusterhausen üblich wurde, noch ein weiteres, nicht minder wichtiges Interesse des jungen Prinzen aus: seine Begeisterung für das Militärwesen. Aus kindlicher Perspektive bedeutete dies zunächst, die Beobachtungen, die er in den Residenzen angesichts der dort exerzierenden Einheiten und der Aufführungen der Palastgarden während solcher »solennen« Anlässe wie Fürstenbegegnungen machen konnte, zu verarbeiten und nachzugestalten. Daraus entwickelte sich geradezu eine Passion. Zunächst begann Friedrich Wilhelm im Garten von Lietzenburg, dem späteren Charlottenburg, mit kindlichen »Soldaten«, die mitunter nur wenig älter als er waren, zu exerzieren und legte dabei eine Ernsthaftigkeit an den Tag, die sein Lehrer Rebeur zwar lobend erwähnte, für die anderen Unterrichtsgegenstände jedoch schmerzlich vermisste. Ab 1702 veranstaltete er solcherlei militärische Übungen auch in Wusterhausen. Die hier von ihm gedrillte Einheit, die sogenannte Wusterhausener Jagdgarde, wurde aus groß gewachsenen Jagdhelfern der umliegenden Orte gebildet.20 Bald schon wurde aus diesen kindlich-jugendlichen Spielereien Ernst – zwar noch nicht in Form einer aktiven Beteiligung an den damals voll entbrannten großen europäischen Kriegen, wohl aber auf administrativem Gebiet: So beschäftigte sich Friedrich Wilhelm mit Fragen der Uniformierung sowie der Ausrüstung mit Waffen und Munition. In jene Zeit fällt der Beginn der Bekanntschaft mit dem in preußischen Diensten stehenden Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, der nach der für die antifranzösische Allianz siegreichen Schlacht von Höchstädt 1704 in höchsten Ehren stand. Anfangs gestaltete sich ihre Beziehung noch recht locker und beschränkte sich auf die Zusendung von Geschenken zu den beide Männer besonders interessierenden Metiers – Leopold sandte seinem jugendlichen Bewunderer zum Beispiel Feldzugsjournale, die dieser aufmerksam studierte, bzw. erhielt von ihm Jagdhunde –, bis dann ab etwa 1709 eine regelmäßige Korrespondenz einsetzte und häufige persönliche Begegnungen zustande kamen.21 Eine ähnliche Vorbildrolle hat für die militärische Erziehung des Kronprinzen der Markgraf Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt gespielt. Dieser Angehörige einer hohenzollernschen Seitenlinie diente als Generalfeldzeugmeister in der brandenburgisch-preußischen Armee.22
1709 war es für den damals 20-jährigen Kronprinzen schließlich soweit, dass er erste unmittelbare Erfahrungen im Krieg erwerben konnte. Er wähnte sich »auf dem Gipfel der Freude«, endlich dem von ihm verehrten Prinzen Eugen von Savoyen und dem Herzog von Marlborough auf dem Kriegsschauplatz in den Österreichischen Niederlanden persönlich begegnen zu können.23 Obschon er ursprünglich auf eine schnelle Schlachtentscheidung gehofft hatte, erhielt er zunächst Einblick in die zur damaligen Zeit favorisierte methodische Kriegführung mit ihren kunstvollen Manövern und Belagerungen. Dann aber nahm er am 11. September 1709 aktiv an der Schlacht von Malplaquet teil.24 Zumeist an der Seite Marlboroughs reitend habe der Kronprinz, der sich mehrfach im Kugelhagel befand, »kaltes Blut und eine Unerschrockenheit bewiesen«. Wenngleich diese Feuertaufe lange bei ihm nachwirkte – an den Malplaquettag wurde bis zu seinem Lebensende jährlich erinnert –, war er auch Zeuge des ungeheuren Blutzolls einer solchen Schlacht geworden, die etwa 35.000 Tote und Verwundete gefordert hatte. Dies schien nicht ohne Eindruck auf den jungen Friedrich Wilhelm geblieben zu sein. An einen Verwandten schrieb er, dass »Mir der Verlust so vieler braver Offiziere sehr schmerzet und habe Ich sie ungern verloren«.25 Aus den freilich nur bruchstückhaften Informationen ließe sich ableiten, dass er in dieser durch Schlachtenlärm geprägten Zeit und trotz seiner unmittelbaren Beobachtungen der Feldherrnkunst eines Prinzen von Savoyen oder eines Herzogs von Marlborough nicht auf die Bahn einer Nachahmung gelenkt wurde. Er konzentrierte sich in dem von ihm so favorisierten Militärwesen vor allem auf organisatorische und logistische Fragen – eine Orientierung, die sein späteres Agieren auf diesem Feld prägen sollte.
Bei Friedrich Wilhelm ließen sich bereits damals Verhaltenszüge beobachten, die das Bild vom hartgesottenen, gefühlskalten »Kommisskopp« zumindest etwas zu relativieren vermögen und von einer gewissen Empathie zeugen. So versprach er, damals 17½ Jahre alt, dem Fürsten Leopold, für einen von diesem vermittelten verwundeten Gefreitenkorporal zu sorgen, denn »in der That es unbarmherzig sein würde, sich derselben, so ihre gesunde Gliedmaßen vor den Feind verloren, nicht anzunehmen«.26
Im Übrigen konnte man auch bei anderen Monarchen und Fürsten eine solche fast schon als exzessiv zu bezeichnende Hinwendung zum militärischen Metier beobachten, so zum Beispiel im Falle des vier Jahre älteren württembergischen Prinzen Carl Alexander, der jedoch erst 1733 als Herzog die Landesherrschaft in seinem Territorium übernehmen sollte. So erregte das »ungewöhnliche Avancement des erst 25-Jährigen … an den deutschen Höfen einiges Aufsehen«.27 Und auch das vom russischen Zaren errichtete Preobraschenski-Regiment ging bekanntlich aus der einst spielerischen Beschäftigung des jungen Peter mit Exerzierübungen hervor.