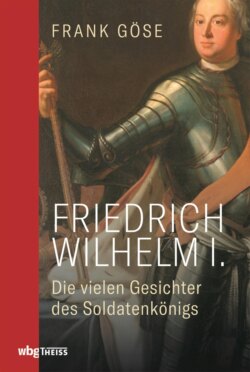Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 17
Die Hof- und Residenzgesellschaft zwischen Traditionsbruch und Kontinuität
ОглавлениеSchaut man sich die Struktur der Hofgesellschaft nach 1713 etwas näher an, fällt trotz der Reduzierung einiger Chargen durchaus eine Kontinuität in der personellen Zusammensetzung auf. Darunter fallen auch jene Angehörigen der politisch-höfischen Führungsgruppe, die wie insbesondere Friedrich Wilhelm von Grumbkow45 und Fürst Leopold von Anhalt-Dessau46 schon vor dem Herrscherwechsel in der kronprinzlichen »Partei« über einen beträchtlichen Einfluss verfügt hatten. Mit dem König verband v. Grumbkow die gemeinsame Teilnahme an der Schlacht von Malplaquet von 1709 – ein Erlebnis, das für das weitere Leben Friedrich Wilhelms bekanntlich eine kaum zu überschätzende Bedeutung besaß. Grumbkow stand in dem Ruf, ebenso rücksichtslos wie bösartig zu sein – ein Urteil, das sich freilich vor allem durch die Memoiren Wilhelmines von Bayreuth verfestigt haben dürfte. Er galt aber auch als derjenige, »der den nötigen Mut und die Nerven besaß, dem König entgegenzutreten«.47 Ein wichtiger Vorteil v. Grumbkows bestand darin, dass er den König vergleichsweise häufig sehen konnte, schließlich war er nicht nur Vizepräsident des General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen-Direktoriums, sondern zugleich Chef eines vom König hoch angesehenen Regiments und stieg die militärische Karriereleiter letztlich bis zum Rang eines Generalfeldmarschalls hinauf. Nicht unüblich für einen so hohen und einflussreichen Amtsträger wie ihn erschien die Anhäufung weiterer Titel, so das Amt eines kurmärkischen Erbjägermeisters und eines Domprobstes im Domkapitel Brandenburg. Damit genoss er zugleich eine entsprechende Reputation innerhalb der Adelsgesellschaft der märkischen Zentralprovinz. Und dank zahlreicher informeller Kontakte, die er während der regelmäßig stattfindenden Jagden, Assembleen und der häufigen Teilnahme an den Zusammenkünften des Tabakskollegiums pflegen konnte, verfügte v. Grumbkow über viele Möglichkeiten, den König zu sprechen. Die geradezu wortwörtlich zu verstehende »Nähe« zum König spiegelte sich auch darin wider, dass nicht selten er es war, der anderen Personen den Zugang zum Monarchen ermöglichte bzw. dessen Meinung zum Anliegen eines Bittstellers beeinflussen konnte. »Es hat der General v. Ranck um audience bey Mir angehalten«, ließ Friedrich Wilhelm zum Beispiel am 22. März 1729 an v. Grumbkow ausrichten. »Ihr sollet aber vorher mit Ihm sprechen, was er haben wollte.«48 Da es unbestritten war, dass Grumbkow von allen Mitgliedern der politischhöfischen Führungsgruppe das größte Vertrauen des Königs besaß, schien aus der Sicht der britischen Diplomaten im »Krisenjahr« 1730 die Einbeziehung Grumbkows der einzig erfolgversprechende Weg zu sein, um aus der Sackgasse des mittlerweile festgefahrenen Projektes der englisch-preußischen Doppelhochzeit wieder herauszukommen. Er hätte »den meisten credit beym Könige, kennete den Herrn und wüste mit seinem Wort mehr anzurichten als andere mit viel Kunst und argumenten«.49 Unangreifbar war seine Stellung im unmittelbaren Umfeld des Königs allerdings nicht. Ihm sei durchaus bewusst, so berichtete im Dezember 1736 der kaiserliche Gesandte über eine Äußerung Friedrich Wilhelms I., dass v. Grumbkow »sich gewöhnlich in allen sachen Verdächtiger Intrigues zu bedienen pflegte«.50
Auf einer etwas anderen Grundlage beruhte das Verhältnis Friedrich Wilhelms I. zum Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau. Bei ihm handelte es sich um einen Reichsfürsten, was letztlich auch die Beziehung der beiden Männer beeinflussen sollte, die trotz einer Attitüde als »Männerfreundschaft« gleichwohl nicht von Belastungen frei blieb. Friedrich Wilhelm hat den zwölf Jahre älteren Fürsten lange Zeit als Mentor und – nicht nur in militärischen Fragen – als Vorbild angesehen. Schließlich galten die von ihm in seinem Fürstentum durchgeführten Reformen dem Kronprinzen bzw. jungen König als nachahmenswert.51 Dennoch kam der Fürst im Umfeld des Thronwechsels nicht in die von ihm erhoffte Sonderstellung an der Seite des neuen Monarchen. Die Behandlung, die er dem nach Berlin eilenden Leopold angedeihen ließ, gab den auswärtigen Gesandten Anlass zur Vermutung, dass dem Fürsten Leopold »eben keine sonderliche Autorität werde in die Hände gegeben werden«.52 Aus dem edierten Briefwechsel erhellt zwar ein vertraulicher Umgang der beiden Männer, der auf ähnlichen Interessen und Lebensstilen beruhte, jedoch wird man den Einfluss des Anhaltiners auf den König nicht überbewerten dürfen.53 Im Unterschied zu v. Grumbkow weilte er eine geringere Zeit in der Residenz, schließlich hatte er auch landesherrliche Aufgaben in seinem Fürstentum wahrzunehmen, und sein Regiment stand in Halle (Saale) in Garnison.
Wenn wir unseren Blick von diesen beiden prominentesten Repräsentanten des engeren Umfeldes des Königs auf die Hof- und Residenzgesellschaft in ihrer Gesamtheit erweitern, hat es die angenommenen Brüche im Zusammenhang mit dem unterstellten antihöfischen Politikstil nicht, zumindest nicht in der häufig angenommenen Weise gegeben. Alle Inhaber der sechs höchsten höfischen Ämter blieben nach 1713 im Amt: Paul Anton von Kameke blieb Erster Kammerherr. Der zugleich als Konsistorialpräsident, Schlosshauptmann und Lehndirektor amtierende Marquard Ludwig von Printzen übte bis zu seinem Tode 1725 weiterhin die Charge als Oberhofmarschall aus. Auch in den Ämtern des Oberstallmeisters (Friedrich Gottwart Freiherr von Syberg), des Oberschenken (Karl Christoph Graf Schlippenbach) und des Oberjägermeisters (Samuel Freiherr von Hertefeld) gab es keinen Wechsel. Ebenso blieben die Präsidenten des Konsistoriums (Marquard Ludwig von Printzen) und des Berliner Kammergerichts (Johann Sigismund von Sturm) über den Thronwechsel von 1713 hinaus im Amt wie der Generalkriegskommissar Johann Moritz von Blaspiel sowie die Inhaber der führenden höfischen Chargen.54
Was sich indes partiell änderte, war die konkrete Ausfüllung der Ämter im Alltag. Hier lassen sich vornehmlich jene Anhaltspunkte finden, die die jüngere Forschung von einer gewissen »Entpolitisierung des preußischen Hofes« haben sprechen lassen.55 Damit wird insbesondere auf die Entleerung vieler höfischer Ämter zu sogenannten Sinekuren abgehoben, die – wie bereits erwähnt – zunehmend durch Offiziere besetzt wurden. Vor allem wird diese »Entpolitisierung« aber mit dem Rückzug des Königs aus dem höfischen Leben der eigentlichen Hauptstadt in die bisherige Nebenresidenz Potsdam begründet. Die im Zuge der »Kabinettsregierung« voranschreitende Aufteilung zwischen der eigentlichen Machtzentrale, dem gewöhnlich in Potsdam in den Räumen des Königs und in seinem Beisein ohne ministerielle Beeinflussung arbeitenden »Kabinett«, einerseits und dem in Berlin bleibenden und zumeist ohne Anwesenheit des Monarchen agierenden »Hof- und Residenzzentrum« andererseits förderte diesen Prozess entscheidend.56 Die unter seinem Vorgänger intensive, fast tägliche Verbindung zwischen dem Herrscher und den führenden Amtsträgern in der Zentralverwaltung wich einem anderen, unpersönlicher strukturierten Prozedere.
Gleichwohl dürfen trotz dieser nachvollziehbar erscheinenden Bewertungen nicht solche Beobachtungen außer Acht gelassen werden, die auf traditionelle Elemente sowohl im Binnenverhältnis innerhalb der politisch-höfischen Elite als auch zwischen der Hof- und der Adelsgesellschaft insgesamt verweisen. Legt man den Fokus bei der Betrachtung des preußischen Hofes nicht nur auf seine »Funktion hinsichtlich politischer Entscheidungsfindung und monarchischer Repräsentation«, sondern auch auf den Aspekt seiner »kommunikativen Struktur« und auf seine gerade für den Adel so existenziell wichtige Bedeutung als »Ort gesamtgesellschaftlicher Rangmanifestation«, wird man seiner tatsächlichen Funktion und seiner zeitgenössischen Wahrnehmung eher gerecht.57 Denn gerade für die Ritterschaft der Provinzen des Gesamtstaates bildete der Hof – selbstverständlich in unterschiedlicher Intensität – einen Ort der Statussicherung, wo Patronage- und Klientelverbindungen etabliert wurden sowie »Ämter, Privilegien und ökonomische Chancen aller Art verteilt und erworben [und] Geldgeschäfte getätigt« werden konnten.58