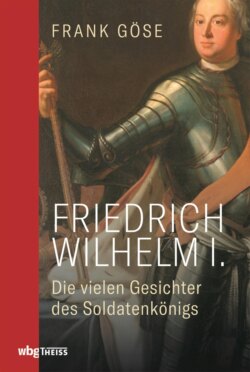Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Jagden
ОглавлениеEine ähnlich gelagerte Möglichkeit, über informelle Kontakte in die Nähe des Königs zu gelangen, boten die Jagden – neben dem Militär und den lukullischen Genüssen ein weiteres Vergnügen, das sich Friedrich Wilhelm gönnte. Hier soll nicht vornehmlich den Details der Jagdpraxis nachgegangen und die Professionalität Friedrich Wilhelms in diesem Metier geprüft werden132, vielmehr interessiert die Funktion der Jagd für die Herrschaftspraxis des Königs.
Rein von ihren offiziellen Ämtern her waren die Oberjägermeister innerhalb der politisch-höfischen Führungsgruppe mit jener Materie befasst. Während seiner Regierungszeit amtierten in dieser Charge Samuel Freiherr von und zu Hertefeld (bis 1727) und Georg Christoph Graf von Schlieben.133 Aufgrund der großen Bedeutung, die die Jagdleidenschaft bei den bisherigen brandenburgisch-preußischen Herrschern eingenommen hatte, wird man das Gewicht dieser Charge hoch zu veranschlagen haben. Schließlich befanden die Oberjägermeister sich über längere Zeit – manche Jagden zogen sich über mehrere Tage hin – in unmittelbarer Nähe zum Monarchen, so dass durchaus davon ausgegangen werden kann, dass der informelle Kontakt mitunter über den Austausch bezüglich des Jagdmetiers hinausging. Hertefelds Stellung wurde zum Beispiel im letzten Regierungsjahr Friedrichs I. durch den Kronprinzen Friedrich Wilhelm als sehr einflussreich geschildert.134 Außerdem resultierte das Renommee dieses Amtes auch aus den forstwirtschaftlichen Kompetenzen. Samuel von Hertefeld stand zum Beispiel in hohem Ansehen beim König aufgrund seiner Verdienste bei der Urbarmachung des havelländischen Luches und der Ansiedlung von niederländischen Kolonisten.135 Obendrein bildete die Gewährung bzw. Ausweitung von Jagdrechten eine nicht zu unterschätzende Form der Erteilung von Gunst und Gnade innerhalb der Adelsgesellschaft. 1729 hatte der König zum Beispiel angeordnet, dass dem Generalmajor Karl Ludwig Graf Truchseß von Waldburg, dem man bei der Ausübung seiner Jagdfreiheit »allerhand Schwierigkeiten gemachet«, das Jagen in den »königlichen Holzungen und Revieren ungehindert« zu erlauben sei.136 Die Quellen belegen darüber hinaus, dass vor allem Offiziere in besonderer Weise von solchen Gunsterweisen profitieren konnten. Bei der Einziehung der mit der Ausübung des Jagdrechtes verbundenen Gebühren zeigte sich Friedrich Wilhelm I. mitunter flexibel. Dem Obristen Graf v. Dohna, der in einem in Magdeburg garnisonierenden Regiment diente, wurde gestattet, dass er für sein im Biederitzer Gehege ausgeübtes Jagdrecht statt der üblichen Pacht nunmehr jährlich 50 Paar Rebhühner liefern solle.137 Dem neuen Festungskommandanten im hinterpommerschen Kolberg, Generalmajor Erhard Ernst von Roeder, wurde auf seinen Wunsch das Jagdrecht, das der bisherige Gouverneur innegehabt hatte, übertragen.138 Und der Capitain Alexander Emil Graf von Dohna erhielt das Privileg, in der »Osterodischen Heyde« (Ostpreußen) jagen zu dürfen.139
Die Jagdaufenthalte in Wusterhausen, aber auch in den anderen Wäldern der Residenzlandschaft genoss der König sichtlich. Voller Stolz berichtet er – nicht nur in den zahlreichen Briefen an den Fürsten Leopold140 – über seine Erfolge und geschossenen Trophäen. Am 17. September 1728, also gleich zu Beginn der Jagdsaison, schrieb er, dass »wir einen Hirsch von 16 Enden gefangen …, die jagd ist admirable gewesen«. Dass ihm dieses Vergnügen schon damals körperliche Probleme bereitete, klang zumindest in einer scherzhaften Nebenbemerkung an: »… wie es aber morgen mit dem podex und der Rücken Schulter aussehen, das wird die Zeit lehren.«141 Diese Jagden wurden nicht nur in kleinem Familienkreis zelebriert, obzwar die beengten räumlichen Möglichkeiten und die bescheidene Ausstattung des Jagdschlosses Königs Wusterhausen darauf hinzudeuten schienen. Hier finden wir zum Teil jene hohen Militärs, Amtsträger und Diplomaten, die auch im Tabakskollegium saßen.142 Zudem schien Friedrich Wilhelm I. an den Aufenthalten in freier Natur nicht nur wegen der damit verbundenen Ausübung des Waidhandwerkes Gefallen gefunden zu haben. Auch in seinen Residenzen verlangte er, seine Wohnräume lichtdurchflutet zu gestalten. So gab es eine ganze Reihe von Fenstern im Berliner Schloss, »welche er über ihr vom Architekten vorgeschriebenes Maß rücksichtslos gegen die architektonische Erscheinung höher und breiter machen ließ«.143
Die Vorliebe des Königs für Wildbret und Fisch war gemeinhin bekannt, so dass er nicht selten solcherart Präsente von Angehörigen der politisch-höfischen Elite und auswärtigen Gesandten erhielt. Darunter waren Jagdbeute wie Auerhähne und Birkhühner, aber auch Delikatessen wie Krebse, Kabeljau oder Austern.144 Ähnlich wie in militärischen Angelegenheiten wandte sich Friedrich Wilhelm I. in diesem Metier sehr detailliert den eingehenden Anfragen zu. Waren es Bemühungen um den Ausbau von Parforcegärten145, die Anschaffung von geeigneten Jagdhunden146 oder die Freilandhaltung von Rebhühnern147 – stets erwartete er, um eine Entscheidung gebeten zu werden, und zeigte sich in der Regel über die ihm vorgelegten Materien gut informiert.