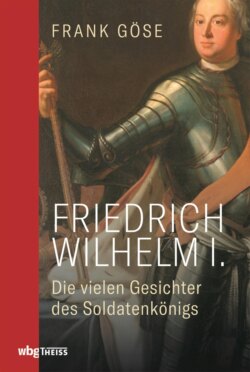Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 19
Der König als Silbersammler und Bauherr
ОглавлениеIm besonderen Maße aber hat der zweite preußische König durch die Bewahrung und Erweiterung des Silberschatzes versucht, nicht nur das Niveau der materiellen Hofkultur in der preußischen Residenz zu heben, sondern in gewissem Sinne gar ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren. Schon im Zusammenhang mit der Beisetzungszeremonie seines Vaters hat er in seiner Bemerkung zu dem Plan des Zeremonienmeisters v. Besser gefordert: »Alles mein Silber, das ich in der Welt habe, muß da auch logiret werden. Meine Oncels muß man ersuchen alles Ihrige zu leihen, so auch die Ministers. Es muß ebloniren von Lichten und Silber, alles was in der Stadt ist.«92 Und die Silbervorräte wurden eben nicht, wie mitunter in der älteren Literatur glauben gemacht wurde, von Friedrich Wilhelm I. aus pekuniären Motiven zur Gewinnung von Münzen eingeschmolzen93, gleichwohl es entsprechende Befürchtungen im unmittelbaren zeitlichen Umfeld des Thronwechsels gegeben hatte.94 Eine solche Vermünzung hat zu einem großen Teil erst Friedrich II. im Zusammenhang mit der finanziellen Krise am Ende des Zweiten Schlesischen Krieges 1745 veranlasst.95 Während der gesamten Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. wurde vielmehr eine Vielzahl an Aufträgen sowohl bei Augsburger Gold- und Silbermanufakturen als auch bei Berliner und Potsdamer Goldschmieden erteilt; der Schwerpunkt lag jedoch auf den Jahren nach 1728.96 Mit gutem Grund, denn es war der Besuch in Dresden im selben Jahr, der ihn in seiner schon zuvor bestehenden Sammelleidenschaft bestärkt hatte. Ein wichtiger Anhaltspunkt dafür findet sich in den Memoiren Prinzessin Wilhelmines: »Mein Vater, der König, hatte all dies Silberzeug nach seiner ersten Dresdener Reise beschaffen lassen. Er sah in dieser Stadt den Hausschatz des Königs von Polen; er wollte ihn überbieten, und da er nicht so viele und seltene Edelsteine sammeln konnte, verfiel er auf den Gedanken, einen ebensolchen Aufwand mit Silberzeug zu treiben, um etwas zu haben, was kein Monarch in Europa noch gesehen hatte.«97 Diese Erklärung findet ihre Bestätigung im Übrigen auch aus der Feder des Königs selbst: Am 13. Februar 1728 berichtete er dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, noch ganz unter dem Eindruck seines Besuches am Dresdener Hof stehend: Das, was er dort an Pracht und Ausstattung der Schlösser zu sehen bekommen habe, sei »extra Magnificke«, jedoch »Silber glaube das ich mehr habe«.98 Vor diesem Hintergrund bedarf die von Paul Seidel getroffene Einschätzung, dass die von Friedrich Wilhelm I. bei Augsburger und Berliner Goldschmieden in Auftrag gegebenen Arbeiten »wohl nur den Zweck einer soliden Kapitalanlage« gehabt hätten, der Korrektur.99
Mit sehr detaillierten Anweisungen hat sich der Monarch in der Folgezeit immer wieder persönlich in die Auftragsvergabe eingeschaltet. Am 31. Oktober 1732 bestätigte er zum Beispiel den Erhalt von sechs silbernen Wandleuchtern und drängte auf die Lieferung weiterer 18.100 Und am 28. Februar 1733 wurde von ihm die Bezahlung an den Augsburger Goldschmied Gulmann in Höhe von 20.340 Talern für einen Silbertisch und zwei große silberne Wandleuchter angewiesen.101 Laut den Hauptbüchern des Bankhauses von Splitgerber & Daum, über das diese Aufträge vermittelt wurden, sind allein in den Jahren 1730–1733 aus dem königlichen Tresor 650.719 Taler an die Firma Gulmann gezahlt worden.102 Ein wahres »Highlight« unter dem Silberschatz Friedrich Wilhelms I. bildete der silberne Chor im Rittersaal des Berliner Schlosses, zu dem der Auftrag im Januar 1738 an den Hofgoldschmied Lieberkühn erteilt worden war. Und in der Tat dürfte die Ausstattung der Schlossgemächer und Festsäle so manchen Gast nicht unbeeindruckt gelassen haben. Schließlich befanden sich in den Gemächern, »um die Wirkung dieser Objekte im Schein der Kerzen zu steigern, eine Reihe von Silberspiegeln sowie eine nicht zu übersehende Zahl von Gueridons, Girandolen und Blakern, die ebenfalls aus diesem Material hergestellt worden waren«.103
Alles in allem, so lässt sich also resümieren, hat ungeachtet der vom neuen Monarchen vorgenommenen und bewusst öffentlichkeitswirksam inszenierten Veränderungen, wie der Reduktion des Hofstaates oder der vorübergehenden Einstellung der Bauarbeiten am Berliner Stadtschloss, auch weiterhin ein Hofleben stattgefunden, das sich zudem im Verlauf der folgenden Regierungsjahre – gemessen an den Verhältnissen zur Zeit des ersten Königs – wieder »normalisierte«, so dass sich die Funktion des preußischen Hofes nach 1713 allenfalls »auf fallweisen Prunk« ausgerichtet hatte.104
Zu diesem einer königlichen Residenz entsprechenden »fallweisen Prunk« wird man auch die an die Angehörigen der politisch-höfischen Elite gerichteten Anforderungen Friedrich Wilhelms I. rechnen dürfen, die auf eine Hebung des baulichen Niveaus der Berliner Residenz zielten. Er verlangte von den Ministern, die ja im Gegensatz zu den sich in Potsdam aufhaltenden Kabinettsräten dauerhaft in Berlin blieben, dass sie – zumeist auf eigene Kosten – stattliche Häuser bauten, von denen einige durchaus als Palais bezeichnet werden können. Offenbar unter dem Druck des bevorstehenden Besuches des polnischen Königs August II. drängte er den Oberstleutnant v. Derschau im April 1728, endlich den Bau des sogenannten »Niebeckischen Hauses« zu vollenden, »oder ich werde mich an euch halten und es fertig bauen lassen und euch das Geldt abziehen«.105
In besonderer Weise ragten in der Friedrichstadt das Palais Friedrich Wilhelm von Grumbkows in der Königstraße sowie der Wohnsitz des Geheimen Rates v. Creutz in der Klosterstraße heraus106, vor allem aber galten die von dem damals berühmtesten Berliner Baumeister Philipp Gerlach erbauten Häuser des Kabinettsrates und Ministers Samuel von Marschall »mit einem der schönsten Gärten Berlins mit Pavillons und Hecken«, des Vizepräsidenten Hans Christoph von Görne oder des Ministers Wilhelm Heinrich von Thulemeier als besondere architektonische Leistungen. Ebenso hatten sich Angehörige des hohen Offizierskorps im Stadtzentrum niedergelassen, wie etwa der Generalmajor v. Montargues in der Burgstraße oder der Oberst v. Sydow in der Münzstraße.107 In den Palais fanden nicht nur aufwendige Assembleen statt, vielmehr kamen die Minister und Räte in ihren Privatwohnungen auch ihren dienstlichen Obliegenheiten nach und versammelten sich in der Regel nur zu den gemeinsamen Beratungen im Stadtschloss. Legendär erscheinen in diesem Zusammenhang Friedrich Wilhelms insbesondere in den späteren Regierungsjahren zu beobachtenden Bemühungen, die eigenen Kosten für die Bewirtung möglichst gering zu halten und sich selbst bei den Angehörigen der Hof- und Residenzgesellschaft zu den Assembleen in ihre Palais einzuladen.108 Das bot den Vorteil, jene asketische Lebensweise, mit der man selbst so öffentlich kokettierte, nicht infrage stellen zu müssen. Der König konnte sich also als Mahner vor allzu üppigen Tafelfreuden inszenieren, auch wenn er diese selbst bei anderen genoss.109