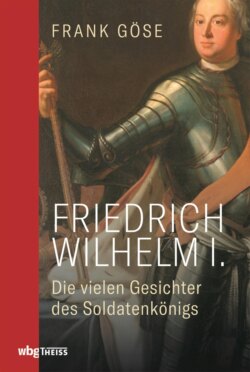Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 11
Behauptung auf dem höfischen Parkett
ОглавлениеBei all der Bedeutung, die Jagd und Militär für Friedrich Wilhelm zweifelsohne besaßen, wäre es allerdings ein Fehlschluss, seine Persönlichkeitsentwicklung nur darauf zu beschränken. Aus diesen ja auch von ihm selbst gegenüber Zeitgenossen betonten Neigungen machte er keinen Hehl und fühlte sich auf dem Sattel seines Pferdes während der Jagd oder auf dem Exerzierplatz am wohlsten. Dennoch gehörte es zu den Erziehungsgrundsätzen und Ausbildungsnormen für den fürstlichen Nachwuchs, ein wesentlich breiteres Spektrum an Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, das sich nicht zuletzt an den Erfordernissen des »honnête homme« orientierte. Und schenkt man einigen überlieferten Nachrichten Glauben, dann blieben solche, vor allem auf Betreiben seiner Mutter initiierten Bemühungen nicht ohne Wirkung. Auf seine Großmutter, die hannoveranische Kurfürstin Sophie, hatte der zwölfjährige Friedrich Wilhelm anlässlich seines Besuches im Schloss Herrenhausen jedenfalls einen denkbar günstigen Eindruck hinterlassen. Er »sieht aus wie man die Engeltien [Engelchen] malt, ist nun 12 jhar alt und spricht von alles, als wan er von 30 were, … gans ungzwungen ist seine fründlichkeit. Ich bekänne, ich bin gans verliebt, dan ich habe mein leben nichts artigeres gesehen«.28 Der hier von der hannoveranischen Kurfürstin vermittelte Eindruck ist nicht nur mit dem gewiss ausgeprägten Stolz einer Großmutter zu erklären, die geneigt ist, über die problematischen Charakterzüge ihres Enkels geflissentlich hinwegzusehen. Diese positive Wahrnehmung des brandenburgischen Kurprinzen deckte sich durchaus mit seinem Auftreten, mit dem er kurze Zeit zuvor in Brüssel und am oranischen Hof in Den Haag die Gäste für sich einzunehmen verstanden hatte. In Brüssel, dem Sitz des im Auftrag des Kaisers die Österreichischen Niederlande regierenden Statthalters, kam es sogar zu einer denkwürdigen Begegnung zwischen Friedrich Wilhelm und dem Erzbischof von Cambrai, hinter dem sich François Fénelon verbarg, der mit seinem »Télémaque« ein Standardwerk verfasst hatte, das wie kein zweites Werk in der damaligen Zeit insbesondere von heranwachsenden Hochadligen rezipiert wurde. Dieser Roman entwirft im historischen Gewande der griechischen Götterwelt in dichterischer Freiheit das Ideal eines tugendhaften Fürsten, der sich in seiner Regierung von Weisheit, Bescheidenheit und der Sorge um die Wohlfahrt seiner Untertanen leiten lässt. Vielleicht mochte auch jene auf außenpolitische Zurückhaltung und die Vermeidung von Kriegen orientierte Passage auf Friedrich Wilhelm eine gewisse Wirkung erzielt haben? Jedenfalls ließ der Kurprinz nach dem Bericht seines Erziehers Alexander von Dohna während des Brüsseler Zusammentreffens den Dichter wissen, dass er sein Werk sehr schätze. Fénelon seinerseits zeigte sich sichtlich beeindruckt, »einen Prinzen zu sehen, der in diesem Alter bereits von der Neigung zu Tugend erfüllt sei und der nach allem, was man sehe, alles zu erfüllen verspreche, was man sich Großes und Wünschenswertes denken könne«.29 Im Übrigen sollte dieses Buch einst auch auf seinen eigenen Sohn, den künftigen Kronprinzen Friedrich, prägend wirken.30 Kein Geringerer als Gottfried Wilhelm Leibniz zeigte sich anlässlich seines Besuches in der brandenburgischpreußischen Residenz sichtlich angetan vom Thronfolger: »Ich finde an ihm große Urteilsfähigkeit, zusammen mit Lebhaftigkeit und sogar eine Geradheit und Freundlichkeit, was ungewöhnlich ist.«31
Auch die ihm zugeschriebene Abneigung gegenüber dem Tanz sollte nicht verabsolutiert werden: Gewiss hatte er einst mit dem hingeworfenen »Euer Tanz lehrt mich nicht regieren!« seinen Lehrer abgefertigt.32 Dennoch brachte er es darin zu einer gewissen Meisterschaft, wovon er selbst nach 1713 einige Kostproben bei so mancher Gelegenheit bieten sollte.33 Die Aufzeichnungen des Johann von Besser, der seit 1690 am brandenburgisch-preußischen Hof als Zeremonienmeister amtierte, vermitteln nicht nur darüber so manche erhellende Informationen. Der Kur- bzw. Kronprinz war demnach mit zunehmendem Lebensalter in immer intensiverer Weise in das höfische Zeremoniell eingebunden. Mehr noch: Friedrich Wilhelm scheint zu Besser bis unmittelbar vor seinem Regierungsantritt ein recht auskömmliches Verhältnis unterhalten zu haben. Wenn man den Aufzeichnungen des Zeremonienmeisters Glauben schenken darf, dann hatte er sich im Zuge der Nachwehen, die der Sturz Wartenbergs innerhalb der höfischen Gesellschaft ausgelöst hatte, vertrauensvoll an den Kronprinzen gewandt, um Unterstützung gegen üble Nachrede zu erhalten.34 Freilich zeigten sich im Verhalten Friedrich Wilhelms im Umfeld von Diplomatenaudienzen und bei Besuchen anderer Monarchen schon jene Nuancen, die nach seiner Regierungsübernahme einen anderen, etwas lockereren Umgang mit gewissen zeremoniellen Normen ankündigten. Anlässlich des am 25. Juli 1707 stattfindenden Empfanges des savoyischen Envoyés stand der Kronprinz beim Eintreten desselben auf »und entblöste das Haupt, weilen Er den Envoyé ehmals gekant, und dannenher mit ihm keine grosse Ceremonien [zu] machen«. Umso mehr achtete aber bei dieser Gelegenheit seine Gemahlin, Sophie Dorothea, auf die peinliche Einhaltung des Zeremoniells, »welche auch alles gantz genau observirte«.35 Das Eingebundensein in die Gepflogenheiten der höfischen Gesellschaft schloss die Teilnahme an solchen Divertissements wie Tanz, Theater- und Opernvorstellungen ein, denen sich Friedrich Wilhelm nicht entziehen konnte.36 Mehr noch: Seine Gemahlin »überraschte« ihn anlässlich seines 24. Geburtstages mit einem »Fest in Gesellschaft vieler Dames, und nach der Tafel eine Comedie samt einem kleinen Ballett«.37
Einschneidende Erlebnisse bildeten für den sich an der Schwelle zum Erwachsenwerden befindenden Friedrich Wilhelm der überraschende Tod der Mutter im Februar 1705 und die ein Jahr später vollzogene Heirat mit der Tochter des hannoveranischen Kurfürstenpaares, Prinzessin Sophie Dorothea. Das Verhältnis zur Mutter hatte sich ambivalent gestaltet, denn Sophie Charlotte hegte den Ehrgeiz, aus dem äußerlich attraktiven Kurprinzen38 einen weltgewandten, in den von ihr favorisierten Künsten brillierenden, sich mit Leichtigkeit auf dem höfischen Parkett bewegenden jungen Mann zu entwickeln, der ihren Idealvorstellungen eines »honnête homme« voll entsprach – der also vieles von dem kompensieren sollte, das ihrem Gatten abging. Es handelte sich dabei allerdings um Erwartungen, die Friedrich Wilhelm nicht erfüllen konnte und wohl auch nicht wollte. Dies wird sich nicht zuletzt auf seine Persönlichkeitsentwicklung ausgewirkt haben. Ohnehin gibt es eine Reihe von Hinweisen darauf, dass sich Sophie Charlotte zum Ende ihres Lebens in der preußischen Residenz zeitweise nicht sonderlich wohlfühlte und Stimmungsschwankungen unterlag, die auch auf das Verhältnis zu ihrem Sohn nicht ohne Spuren geblieben sind. Kurz nach ihrem Tode deutete ihre Mutter, die hannoveranische Kurfürstin Sophie, dem trauernden preußischen König an, dass man bemerkt habe, dass »Ihrer Majestät alles schier gleichgültig war, als wenn nichts mehr auf der Welt ihrer würdig sei«.39
Bei den schon bald nach der Königskrönung von 1701 zunehmend intensiver diskutierten Erwägungen zur Brautwahl des preußischen Thronfolgers galten die innerhalb der europäischen Hochadelsgesellschaft üblichen Spielregeln.40 Angesichts der Tatsache, dass aus den ersten beiden Ehen Friedrichs III./I. nur ein Sohn hervorgegangen war, lag es im Interesse der Absicherung künftiger Erbfolgen im Hause Brandenburg, ihn möglichst rasch zu verheiraten. Zwar entwickelte der Kronprinz zeitweise eine starke Zuneigung zu der Prinzessin Wilhelmine Karoline von Brandenburg-Ansbach, die dann aber 1705 Georg August von Hannover, den späteren König Georg II., ehelichte.41 Auch diese Vorgänge mochten die gegenseitige Ablehnung weiter befördert haben. Jedoch hatten letztlich Überlegungen die Oberhand gewonnen, die die Wahl der Braut von übergeordneten politischen Ambitionen abhängig machten.
Ein kurzzeitig ins Auge gefasster Plan, eine Verbindung mit der schwedischen Prinzessin Ulrike Eleonore, der Schwester Karls XII., einzugehen, wurde aufgrund der politischen Gegebenheiten im Umfeld des Großen Nordischen Krieges, aber auch der fehlenden äußerlichen Attraktivität der Prinzessin fallen gelassen.42 Bald darauf begann sich die Ansicht durchzusetzen, mit der Ehe des Thronfolgers die dynastischpolitische Verbindung zwischen Kurhannover und Preußen befestigen zu können. Das Auge fiel dabei auf Sophie Dorothea, die einzige Tochter des hannoveranischen Kurfürstenpaares. Da sie hauptsächlich von ihrer Großmutter, der Kurfürstin Sophie, erzogen worden war, kannte sie ihren künftigen Gemahl seit frühen Kindheitstagen. Dieses Eheprojekt wurde auch vor allem von Sophie vorangetrieben. Sie wird sich dabei die einige Jahre zuvor von Leibniz in einem Memorandum für die Kurfürstin Sophie Charlotte geäußerten Gedanken zu eigen gemacht haben, wonach die Lage beider Länder sie dazu einlade, »sich gegenseitig zu helfen. … Diese beiden Häuser haben auch die gleichen naturgegebenen politischen Ziele, welche sind das Gleichgewicht Europas, das Wohl des Reiches und vor allen Dingen die Bewahrung und Verbreitung der protestantischen Religion.«43 König Friedrich I. ist aus diesem Anlass persönlich in Hannover vorstellig geworden, und während des Treffens ist am 18. Juni 1706 die Verlobung zwischen dem preußischen Kronprinzen und Sophie Dorothea gefeiert worden.44 Das Verhältnis Friedrich Wilhelms zu seiner Braut war wohl zwar nicht von tiefer Emotionalität geprägt, zumindest aber von »Höflichkeit und Verständigkeit«, was angesichts gewisser Eskapaden in anderen Fürstenhäusern beachtlich war.45 Im Spiegel der erhaltenen Korrespondenz zwischen den beiden Eheleuten scheint sich im Verlauf der nächsten Jahre zunehmend ein Verhältnis gegenseitiger Zuneigung entwickelt zu haben.46 Die Hochzeit fand dann wenige Monate später in Berlin statt. Carl Hinrichs hat eingängig geschildert, wie unangenehm dem Kronprinzen diese ausufernden, sich über mehrere Wochen hinziehenden Feierlichkeiten aufstießen.47 Die von ihm verlangten Verpflichtungen widersprachen seinem Naturell und kosteten ihn große Überwindung. Lediglich das von seinem Onkel, dem Generalfeldzeugmeister Markgraf Philipp Wilhelm, arrangierte Feuerwerk wird seinen Vorstellungen entsprochen haben und seinem Wesen entgegengekommen sein. So wurde an einem Tag der Hochzeitsfeierlichkeiten das Zeughaus mit »1.000 Pfund Lichtern illuminiert. Dazu nahm die Artillerie malerisch Aufstellung und eine Vielzahl beleuchteter militärischer Sinnbilder wurde errichtet.«48
Höhepunkte in dem ansonsten von ihm oft als Belastung empfundenen höfischen Alltag – das »höfische Leben ist totales Fest«49 – dürften für ihn die Besuche der von ihm hochverehrten Feldherren, des Herzogs von Marlborough und des Prinzen Eugen von Savoyen, dargestellt haben. So war es im Rahmen des im Dezember 1705 vom Herzog von Marlborough absolvierten Besuches in der preußischen Residenz neben den großen Festmählern und Empfängen, die zu seinen Ehren vom König ausgerichtet wurden, auch zu separaten Treffen mit dem Kronprinzen gekommen.50 Das eigentliche politische Motiv, das den englischen Feldherrn nach Berlin geführt hatte, nämlich den preußischen König unbedingt in der antifranzösischen Allianz halten zu wollen, mochte dabei für Friedrich Wilhelm im Hintergrund gestanden haben. Für den damals 17-Jährigen war es ein Vorgeschmack auf Kommendes, denn seine »Feuertaufe« stand ja erst noch bevor. Im Umfeld des fünf Jahre später stattfindenden Besuches, den der Prinz Eugen dem preußischen König abstattete, agierte der Kronprinz schon sicherer und selbstständiger. So nahm er zum Beispiel auf das Prozedere anlässlich der Zusammenkunft Einfluss, »welches eben Se. König. Hoheit, der KronPrintz, durch diese Rangirungs-Art intendirt hatte«.51
Die Ausbildung des Prinzen schloss natürlich solche Verhaltensnormen ein, die ihn einst befähigen sollten, sich seinem Rang gemäß innerhalb der Hochadelsgesellschaft des Reiches und Europas zu bewegen. Die probateste und in vielen Königs- und Fürstendynastien zur Anwendung kommende Methode bestand darin, während ausgedehnter Reisen Wissen und Fähigkeiten zu erwerben. Solche Kavalierstouren, auch als »Grand Tour« bezeichnet, gehörten seit Längerem zu einer beliebten Bildungsform innerhalb des Adels – und zwar nicht nur in Fürsten- und Königsfamilien –, um Weltläufigkeit zu erlernen und Beziehungen zu knüpfen, die sich für den weiteren Lebensweg einmal als nützlich erweisen konnten.52 Diese mussten aber nicht so systematisch und über eine längere Dauer angelegt sein wie etwa bei dem wettinischen Prinzen Friedrich August (später als »August der Starke« bekannt), der insgesamt zwei Jahre in mehreren europäischen Ländern und deutschen Reichsterritorien unterwegs war.53 Es ging auch eine Nummer kleiner: Für den preußischen Thronfolger erwiesen sich zwei Reisen in die niederländischen Generalstaaten als sehr nachhaltig. Nachhaltig in dem Sinne, als er hier wichtige Impulse erhielt, die sowohl auf spätere Schwerpunktsetzungen in seiner Wirtschafts- und Finanzpolitik wirkten als auch sein ästhetisches Empfinden, insbesondere mit Blick auf die bildende Kunst und die Architektur, prägen sollten. Im Spätsommer und Herbst des Jahres 1700 führte ihn seine erste Reise nach Holland, die sich vor allem in die preußischen Bemühungen einordnete, die mit dem beginnenden Großen Nordischen Krieg und dem bevorstehenden Konflikt um das spanische Erbe verbundenen Herausforderungen mit dem englischen König (und niederländischen Generalstatthalter) Wilhelm III. von Oranien abzustimmen und auf die anstehende oranische Erbfolgefrage in den Niederlanden Einfluss zu nehmen.54 Ungeachtet der persönlichen Begegnung mit Wilhelm III., bei der Friedrich Wilhelm sich als gelehriger Schüler erwiesen und auf den englischen König einen guten Eindruck gemacht haben soll, geriet diese Reise für ihn zu einem eindrucksvollen Anschauungsunterricht einer ihn faszinierenden staatlichen Verwaltung, Kultur und Gesellschaft. Ende des Jahres 1704 folgte eine zweite Reise in die Niederlande, die aber durch den plötzlichen Tod seiner Mutter im Februar 1705 ein jähes und trauriges Ende fand.
Einige der schon längere Zeit als bedenklich angesehenen Charaktereigenschaften hatten sich in der Zwischenzeit verfestigt. Die bevorstehende Mündigkeitserklärung des Kronprinzen bot seinem Erzieher, dem Grafen Dohna, Anlass, Friedrich Wilhelm noch einmal gründlich ins Gewissen zu reden. Unter anderem wurde Kritik am Auftreten des knapp 16-jährigen Kronprinzen geübt: »Alle Welt spricht von seinen schrecklichen Stiefeln, die bei Hofe so lächerlich wirken, wie seidene Strümpfe beim Kavalleristen im Felde.« Obendrein liebe er nur die Gesellschaft unbedeutender Leute und würde dabei gewisse Konventionen des höfischen Lebens missachten. So nehme er des Öfteren die Perücke ab und spreche »allzu frei« – dies alles würde er bei hochgestellten Herren nicht wagen. Angesichts seiner Affinität für alles Militärische trage man Bedenken, dass er einst außenpolitische Verwicklungen herbeiführen werde.55