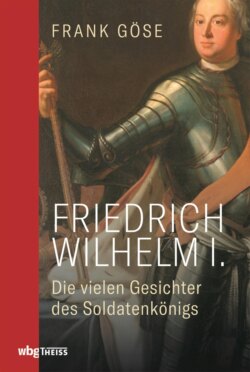Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 20
Das Tabakskollegium
ОглавлениеEine gewiss besondere, aber zum Teil verklärte Form der kommunikativen Beziehungen der Hof- und Residenzgesellschaft stellte das berühmt gewordene Tabakskollegium dar. Eine ganze Reihe von Legenden verbindet sich mit dieser abendlichen Gesellschaft, die zumeist im Berliner und Potsdamer Stadtschloss, mitunter in den Jagdschlössern des Königs, dann aber in etwas kleinerer Runde, stattfand.110 Sie galt nach lange vorherrschender Auffassung als passendes Refugium für die scheinbar antihöfische Ausrichtung des neuen Monarchen, wo sich dessen absonderliche Neigungen hätten vollumfänglich ausbilden können. Der geschwätzige Pöllnitz, dessen Berichte von vielen späteren unkritisch vorgehenden Schreibern einfach übernommen worden sind, war hieran nicht ganz unschuldig. Demnach hätten sich die fast allabendlich stattfindenden Zusammenkünfte der – modern formuliert – bildungsfernen Teilnehmer, die derbe Späße auf Kosten ahnungsloser Gäste trieben, auf ausschweifende Sauforgien beschränkt.111 Es soll nicht bestritten werden, dass es auch solche Exzesse gab.112 Selbstkritisch äußerte der König einst gegenüber dem Alten Dessauer: Wenn »der wein in kop gekommen ist alsden[n] man nit alles nachdencket was man sprechet«.113 Allerdings wäre es verfehlt, die Funktion des Tabakskollegiums darauf zu beschränken oder solcherlei Episoden gar in den Vordergrund zu stellen. Die dort betriebene Kommunikation ist vielmehr einzuordnen in einen übergreifenden Prozess der Aufweichung und Diversifizierung des höfischen Zeremoniells.114 Die in Berlin und Potsdam zu beobachtende Praxis existierte auch an anderen Residenzen, und selbst der Hof Friedrichs I. hatte ein Tabakskollegium gekannt.115 Diese »Tabagien« spiegelten die sich verändernden Formen von Geselligkeit wider, wie sie allenthalben an den Höfen praktiziert wurden, so etwa bei Prinz Eugen von Savoyen oder Zar Peter I.116 und nicht zuletzt in der durch August den Starken initiierten »société des antisobres«, der Friedrich Wilhelm I. selbst beiwohnte.117 Sie bildeten bei Lichte betrachtet nur eine weitere Facette der in der Berlin-Potsdamer Residenzlandschaft üblichen Geselligkeitsformen, zu denen ebenso die bereits erwähnten Assembleen gehörten. Auch bei diesen hatte sich ein auf Rustikalität (kein übertriebener Luxus) und eine gewisse Nivellierung der Standes- und Rangunterschiede (kein Erheben der Anwesenden beim Erscheinen des Königs) Wert legender Ablauf durchgesetzt.118
Denn abseits der in der älteren Literatur häufig betonten und überhöhten Skurrilitäten dieses männerbündischen alkohol- und pfeifenrauchgeschwängerten Gremiums darf nicht übersehen werden, dass das bis zu 20 Teilnehmer umfassende Tabakskollegium eine bedeutende Stellung im Netzwerk der Hof- und Residenzgesellschaft einnahm. Vor allem den Offizieren war jene Art der Zusammenkünfte willkommen. Es ist sicherlich zutreffend, dass die Gestaltung dieser abendlichen Gesellschaften in einem auf »holländische Art« eingerichteten Raum, der im Berliner Schloss »mit Eichenholz ausgetaffelt« war, der bekannten Abneigung Friedrich Wilhelms I. gegenüber einem allzu steif ausgelegten Zeremoniell sehr entgegenkam.119 Doch darf eben nicht außer Acht bleiben, dass das Tabakskollegium wie im Übrigen die Assembleen eine eher informelle Funktion hatte, vergleichbar vielleicht mit den Hintergrundgesprächen im heutigen politischen Berlin. »Es ist und bleibet auch der Discurs … Sr. Majestät gröstes Vergnügen«, wusste schon der recht gut informierte David Fassmann zu berichten.120 Wenngleich hier kaum offizielle und verbindliche Entscheidungen getroffen wurden, konnte die Stimmungslage im vermeintlich zwanglosen Gespräch getestet werden.121 Üblich war auch das Zeitungs(vor)lesen, inklusive eines sich daran anschließenden Diskurses mit dem König. Sowohl die häufiger an dieser illustren Runde teilnehmenden Mitglieder – gewissermaßen das »Stammpersonal« – wie der Fürst Leopold, Friedrich Wilhelm von Grumbkow, Ulrich von Suhm, Graf Seckendorff oder Reinhold von Derschau als auch die sich gerade in der Residenz aufhaltenden hochgeborenen Gäste konnten diese Möglichkeit wahrnehmen, Chancen auszuloten und nützliche Informationen zu erhalten. Die »Tabagie« wurde als »Nachrichtenbörse« aktueller Ereignisse wahrgenommen, deren Spannweite laut kursächsischen Quellen von militärischen Themen über die »Große Politik« bis hin zu Familiärem reichte, zu dem der König die Meinung seiner Gäste hören wollte.122 Hier saßen mehrheitlich diejenigen Herren scheinbar zwanglos beieinander, die ansonsten von ihren jeweiligen Chargen aus gegeneinander arbeiteten und den König in ihrem Sinne zu beeinflussen suchten. Deshalb galt ein längeres, nicht durch äußere Umstände bedingtes Fernbleiben von dieser Runde als untrügliches Zeichen dafür, dass der König demjenigen seine Gnade entzogen hatte. In umgekehrter Weise konnte dem »Verbannten« aber auch die Gunst der Teilnahme an der »Tabagie« wieder zugewendet werden. Nachdem sich Friedrich Wilhelm von Grumbkow am Ende des Jahres 1736 wegen einer ihm zugeschriebenen Intrige eine ungnädige Reaktion des Königs zugezogen hatte, ließ der ihn wenige Wochen später wieder in die »abendliche Tabagie kommen«.123 Die sprichwörtliche »Nähe« zum Herrscher, eine allenthalben in den Monarchien kaum zu unterschätzende informelle Kategorie bei der Analyse der Netzwerke innerhalb der politisch-höfischen Elite, spiegelte sich im Tabakskollegium in einem dafür besonders geeigneten Refugium wider, und in den Gesandtenberichten wurde dies auch immer wieder thematisiert. Doch gerade weil man hier scheinbar so freimütig reden konnte, waren damit einige Unwägbarkeiten und Risiken verbunden. Zwar galt der Grundsatz absoluter Verschwiegenheit über die dort berührten Gesprächsinhalte, gänzlich verhindern ließen sich Durchstechereien indes nicht. So war es laut einem Bericht des kursächsischen Gesandten v. Manteuffel im Jahre 1736 zu einer solchen Indiskretion gekommen, als der von einer Reise nach Kopenhagen zurückkehrende Graf v. Stolberg im Tabakskollegium darüber berichtet hatte, dass der kaiserliche Diplomat und Feldmarschall Graf Friedrich Heinrich von Seckendorff im Rahmen des Vertragsabschlusses zwischen dem Kaiser und dem dänischen König ein Geschenk in Höhe von 25.000 Talern erhalten haben solle. Seckendorff erfuhr davon und beschwerte sich anschließend beim König über die Indiskretion. Dieser soll darüber sehr aufgebracht gewesen sein und versuchte über Drohungen, den für die Intrige Verantwortlichen zu überführen.124 In der folgenden Zeit sei daraufhin die Häufigkeit der Zusammenkünfte des Tabakskollegiums zurückgegangen.
»Das Tabakskollegium«. Gemälde von Georg Lisiewski um 1737.
Die Rolle des bedauernswerten und in akademischen125, populärwissenschaftlichen wie auch belletristischen Darstellungen126 oft beschriebenen Schicksals des »Lustigen Rates« Jacob Paul von Gundling wird man in diesem übergeordneten Zusammenhang zu beurteilen haben. Die derben Scherze, die man mit Gundling trieb, sind abgesehen von dessen skurriler Persönlichkeit damit zu erklären, dass sich diese zwischen Hofleben und Wissenschaft changierenden Kommunikationsformen in einer Übergangszeit artikulierten, in der jemand wie Gundling in einer »in die Modernisierung geratenen Hofkultur« Gelehrter und Hofnarr zugleich sein musste.127 Noch gehörten ja »Hofnarren« zur Unterhaltung, allerdings nicht mehr in ihrem traditionellen Erscheinungsbild. Dass es auch Alternativen gab, sich solchen Gemeinheiten wie den Gundling zugemuteten zu entziehen, belegen die Schicksale anderer Personen, denen eine ähnliche Rolle zugedacht war. Nach Gundlings tragischem Tod sollte David Fassmann dessen Nachfolge als Akademiepräsident antreten. Fassmann, der dem Pietismus nahestand, hatte sechs Jahre (1725–1731) in Berlin als Schriftsteller, Zeitungsreferent und Hofhistoriograph gewirkt.128 Nicht zu Unrecht befürchtete er aber, dass ihn Gleiches in diesem Amt ereilen würde wie seinen Vorgänger. Deshalb zog er es vor, die preußische Residenz fluchtartig zu verlassen, »weiln er kein Bouffon de la Cour seyn« wollte, wie es der braunschweigische Gesandte Stratemann treffend formuliert hat.129
Auch die Sitzungen der erwähnten »société des antisobres«, die während des Besuches Friedrich Wilhelms I. in Dresden 1728 gegründet wurde, ähnelten den Gepflogenheiten des Tabakskollegiums. Hier wie dort waren es vor allem Militärs, die zu den Mitgliedern der Gesellschaft zählten; ebenso bediente man sich bei der Namensgebung der Mitglieder aus dem militärischen Milieu.130 Die zwischen beiden Königen ständig ausgetauschte »amitié« erreichte in der gegenseitigen Anteilnahme am Gesundheitszustand eine freundschaftlich-vertrauliche Qualität, die über reine Courtoisie hinausging.131