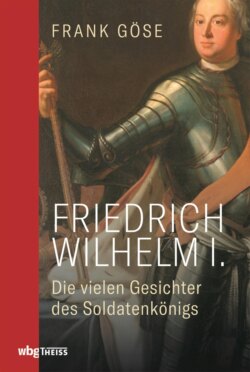Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 12
Erste Regierungserfahrungen
ОглавлениеEinen wesentlichen und deshalb kaum zu unterschätzenden Fakt stellt in der Biographie des Kronprinzen Friedrich Wilhelm der Umstand dar, dass im Unterschied zur Mehrheit der anderen Thronfolger im Hause Brandenburg des 17. und 18. Jahrhunderts in seinem Fall das Verhältnis zum Vater und Vorgänger als harmonisch galt und dass demzufolge auch seine Einbindung in die Regierungsarbeit kontinuierlich erfolgte. Da er der einzige (überlebende) Sohn Friedrichs III./I. und Sophie Charlottes war, entfielen jene fast schon unvermeidlichen Spannungen, die aus der Geburt von Kindern aus nachfolgenden Ehen entspringen konnten. Er verehrte seinen Vater ebenso, wie dieser ihn zu fördern versuchte. Das schloss die immer wieder zutage tretende Sorge des Königs ein, seinen einzigen Sohn und Thronerben den Unwägbarkeiten der unsicheren Zeitläufte auszusetzen. Über eine robuste Gesundheit verfügte der Kronprinz zwar, aber sein Vater artikulierte des Öfteren die Befürchtung, dass sich sein Sohn im Zuge der von ihm gewünschten aktiven Beteiligung an den Feldzügen des Spanischen Erbfolgekrieges zu großen Gefahren aussetzen könnte. Ein berechtigter Anlass zu solchen Ängsten bestand angesichts der besonderen Affinität Friedrich Wilhelms zum Soldatenhandwerk ja durchaus, und immer wieder drängte er seinen Vater, ihm die Erlaubnis zur Kriegsteilnahme zu geben.
Gleichwohl nahm Friedrich Wilhelm, je stärker er in Regierungsaufgaben eingebunden wurde, zunehmend jene Verdächtigungen, Durchstechereien, Verleumdungen und Intrigen wahr, die den Alltag der politisch-höfischen Elite prägten – nicht nur in der preußischen Residenz.56 Und bald war er auch, sehr zu seinem Missfallen, unmittelbar in diese Auseinandersetzungen involviert. Einen besonderen persönlichen Anteil nahm er an denjenigen Vorgängen, die mit dem Sturz des allmächtigen Oberkämmerers Kolbe von Wartenberg verbunden waren.57 Ja, man konnte in gewisser Weise eine »Partei« des Kronprinzen ausmachen, in der sich in jenen brisanten Monaten der Jahre 1710 und 1711 diejenigen Persönlichkeiten hinter dem Thronfolger scharten, die aus unterschiedlichen Erwägungen in Opposition zum Oberkämmerer und seinem Anhang am Hofe standen – zwecks Begleichung alter Rechnungen, aufgrund wirklicher Sorge um den Fortbestand des finanziell angeschlagenen Staates oder motiviert durch puren Opportunismus. Jedenfalls erfuhr die informelle Stellung des Kronprinzen nach diesem personellen Revirement eine beträchtliche Aufwertung, was sich zum Beispiel darin widerspiegelte, dass er in den verbleibenden beiden Jahren bis zum Thronwechsel in stärkerer Weise als vordem in das operative politische Geschäft einbezogen wurde. Nunmehr beschränkte sich sein Wirken nicht nur auf die bloße Präsenz in den obersten Behörden oder auf die Stellvertretung des Königs (zum Beispiel als Statthalter), sondern er konnte jetzt auch eigenverantwortliche Entscheidungen in wichtigen Angelegenheiten fällen, vornehmlich natürlich auf jenem Terrain, auf dem er sich selbst am besten auskannte. Friedrich Wilhelm erhielt auf dem Gebiet der Heeresverwaltung freie Hand und kümmerte sich nachdrücklich um die Reorganisation des Generalkriegskommissariats, an dessen vorläufigem Ende dann das entsprechende Reglement vom 7. März 1712 stand.58 Und in seinem geliebten Wusterhausen übte der Kronprinz jenen später für ihn typisch werdenden Herrschaftsstil ein, der unter dem Namen der »Regierung aus dem Kabinett« mit knapp gehaltenen Dekreten im Stil von Resolutionen bekannt werden sollte.59
Ungetrübt war die Freude über diesen gewonnenen politischen Spielraum indes nicht, denn ihm war nicht verborgen geblieben, dass auch mit der Entfernung Wartenbergs und der weitgehenden Kaltstellung seiner Anhänger innerhalb der politisch-höfischen Führungsgruppe keine Zeit der ungestörten Eintracht angebrochen war. In düsteren Farben malte er in einem Schreiben vom 30. Juni 1712 an den Fürsten Leopold ein tristes Bild über den »zustant unsers hofes«: »sie müßen wiesen das ich wehnig und baldt nichts mehr werde zu sahgen haben seider die affere von Gen[eral] Commis[saire] der granmetre und oberjegermester [und der] kleine Kamequen halten feste zusammen der König glaubet ich bin ein verrehter.«60 Den einfachen Hintergrund für diese Sorgen bildeten Unregelmäßigkeiten der Kassenführung im Generalkriegskommissariat, für die Johann Andreas Kraut verantwortlich gemacht wurde. Dahinter standen nach wie vor Fraktionen, deren eine durch den im Dezember 1711 zum Generalfeldmarschall ernannten Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, Friedrich Wilhelm von Grumbkow und – dieser aber etwas elegant im Hintergrund bleibend – den vornehmlich für die Außenpolitik zuständigen Geheimen Rat Rüdiger von Ilgen gebildet wurde, während auf der anderen Seite Johann Moritz von Blaspiel, Paul Anton von Kameke und der bisherige Generalfeldmarschall Alexander von Wartensleben standen. Carl Hinrichs hat nun überzeugend dahingehend argumentiert, dass sich Friedrich Wilhelm in jenen seinem Regierungsantritt unmittelbar vorangehenden Monaten bemühte, zu der ersten Hofpartei, der man ihn selbst ja zurechnete, auf vorsichtigen Abstand zu gehen.61
Jene Erfahrungen dürften zugleich die aus der zeitlichen Distanz, mehr aber noch für die beteiligten Zeitgenossen überraschenden Handlungen des Kronprinzen im Umfeld des Thronwechsels erklären. Denn bereits zu diesem Zeitpunkt deutete sich an, dass Friedrich Wilhelm I. nicht bereit war, trotz der vermeintlich großen Vertrauensstellung, die v. Grumbkow, mehr noch der Fürst Leopold inzwischen bei ihm erworben hatten, sich in den Dienst einer Hof-»Partei« oder gar eines Favoriten zu stellen.