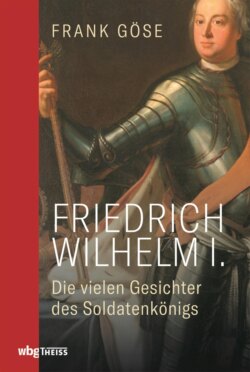Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 15
Ein unhöfischer Monarch?
ОглавлениеNun würden aber die durch die Geschichtsschreibung immer wieder herausgestellten »bürgerlichen« Facetten des Herrschaftsstils Friedrich Wilhelms I. – selbst vom »Puritaner- und Bürgerkönig« (Carl Hinrichs) war zuweilen die Rede – die Analyse des Hoflebens und der Hofgesellschaft während seiner Regierungszeit eigentlich als überflüssig erscheinen lassen. Damit korrespondieren zuvörderst jene auch durch die in- und ausländischen Beobachter wahrgenommenen Entscheidungen Friedrich Wilhelms I., die auf eine beträchtliche Verringerung des Hofstaates zielten. Das Ausmaß dieser Reduktion ist quellenmäßig durch die Hofstaatsakten, in denen die eigenhändig vorgenommenen Streichungen enthalten sind, gut überliefert.1 Andere Nachrichten im Umfeld der spektakulären Maßnahmen tragen hingegen gewisse anekdotenhafte Züge. Immer wieder gern wird der Bericht des Vielschreibers Pöllnitz kolportiert, wonach sich Friedrich Wilhelm I. gleich nach dem Erhalt der Nachricht vom Tod seines Vaters die Etatliste des Hofstaates habe reichen lassen und vor den erschrockenen Augen des Oberhofmarschalls v. Printzen den ganzen Etat mit einem dicken Federstrich durchkreuzt hätte. Der Generalleutnant v. Tettau habe dann vor den entsetzten Mitgliedern des Hofstaates den Vorgang lakonisch mit den Worten kommentiert: »Meine Herren! Unser guter Herr ist tot, und der neue König schickt euch alle zum Teufel.«2
Nun stellten diese auf eine Reduktion des Hoflebens und -personals abgestellten Maßnahmen sicherlich keine völlig neue Nuance dar. Schon der Großvater des neuen Königs, Kurfürst Friedrich Wilhelm, hatte in seinem Politischen Testament von 1667 seine Vorbehalte gegen einen »gar zu weitleuftige[n] hofstadt« vorgebracht, die vor allem aus der schmalen Ressourcenlage in den Jahrzehnten nach dem Dreißigjährigen Krieg resultierten.3 Freilich ging sein Enkel nun einen Schritt weiter und ließ es nicht nur bei solchen Bedenken, zumal sich die Hofausgaben unter dem ersten preußischen König mehr als verdoppelt hatten – nicht zuletzt als Preis für die zeremonielle Aufwertung im Umfeld der Königskrönung.4 Obendrein hatte sich der neue Kurs schon während der letzten kronprinzlichen Jahre angedeutet, als die Kritik unter den hellsichtigen Amtsträgern an der Finanzpolitik immer lauter geworden war. So hatte der Geheime Rat Rüdiger von Ilgen im Jahre 1710 im Namen des Königs sein Unbehagen über die »eingerißenen Unordnungen« artikuliert und eine Reihe von Vorschlägen gemacht, so zum Beispiel, dass »die unnötigen Bediente abgeschaffet« werden sollten.5 Zudem scheint v. Ilgen neben v. Printzen zu den wenigen hohen Amtsträgern an dem von Fraktionskämpfen geprägten Hof seines Vaters gehört zu haben, zu denen Friedrich Wilhelm noch ein halbwegs vertrauensvolles Verhältnis unterhielt.6
Unter Verzicht auf die Nutzung einer ganzen Reihe von Schlössern in der Berlin-Potsdamer Residenzlandschaft wohnte Friedrich Wilhelm I. künftig überwiegend im Potsdamer und Berliner Stadtschloss, unterbrochen von gelegentlichen Aufenthalten in Charlottenburg, sowie in seinen Jagdschlössern bzw. -häusern in Königs Wusterhausen, Machnow und (ab 1736) in Kossenblatt. Gelegentlich wurden noch die Schlösser Köpenick und Oranienburg vom König genutzt; das letztere bekam aber die Streichung der Zuwendungen in Gestalt des Rückbaus von Lusthäusern und Wasserspielen zu spüren.7 Alle anderen Jagd- und Lustschlösser wurden hingegen an Amtleute vermietet.8 Wichtige Baumeister wie Andreas Schlüter oder Eosander von Göthe verließen die preußische Residenz. Mit dieser sowohl auf Einschränkung als auch auf Funktionalität gerichteten Residenzenpraxis korrespondiert die Tatsache, dass während Friedrich Wilhelms Regierungszeit lediglich ein Neubau fertiggestellt wurde: das im niederländischen Stil gehaltene Jagdschloss Stern vor den Toren Potsdams, das aufgrund seiner Schlichtheit eher als »Jagdhaus« bezeichnet werden könnte.9 Reduziert wurde gleichermaßen die Anzahl der höfischen Festlichkeiten, wie etwa die bis dahin aufwendige Zelebrierung des Krönungstages (18. Januar) oder die vielen sich am Hof des alten Königs abwechselnden Bälle, Maskeraden und Opernaufführungen. Letztere Vergnügungen standen zudem in der Kritik der pietistischen Bewegung, der sich der König – wie noch ausführlicher zu zeigen sein wird – sehr verbunden fühlte.10 Die Bauten am Berliner Stadtschloss, dessen Westflügel auf der dem Schlossplatz zugewandten Seite immer noch der Vollendung harrte, wurden zwar nach dem Tode Friedrichs I. erst einmal eingestellt, damit »die sonst dazu destinirten Gelder zur Tilgung der Land-Schulden employret werden«.11 Doch bereits nach einem Jahr wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. Seit 1724 wohnte Friedrich Wilhelm dann während seiner Berlin-Aufenthalte in der Erdgeschosssuite in einer kleinen Wohnung an der Ecke zum Lustgarten.12 Ohnehin wird man die zweifelsohne vorhandenen Einspareffekte bei der Nutzung der Schlösser nicht überbewerten dürfen. Vielmehr konnte er zum Beispiel »auf die kostenaufwändige Ausstattung des Berliner Schlosses, die sein Vorgänger angelegt hatte, zurückgreifen, wenn er sie benötigte«.13
Der Rhythmus der Schlössernutzung folgte einem bestimmten Jahresablauf, wie man das von anderen Herrscherhäusern kannte, so zum Beispiel vom englischen Königshaus, wo zu Zeiten von Georg II. zwischen St. James Palace, Hampton Court, Windsor und Kensington Palace gewechselt wurde.14 In den Herbstmonaten, in der Regel bis zum Hubertusfest, hielt sich Friedrich Wilhelm I. in Wusterhausen auf, um dort der von ihm bis zur Obsession betriebenen Jagdleidenschaft nachzugehen.
Neben diesen Veränderungen bei der Nutzungsgeschichte der Schlösser und des Festkalenders waren es vor allem die teilweise restriktiven Kürzungen, die kurz nach dem Regierungsantritt am Hofstaat seines Vaters vorgenommen wurden, die die bekannten Urteile eines antihöfischen Kurses des neuen Königs haben plausibel wirken lassen. Außerdem mutete diese Praxis die Zeitgenossen auch deshalb so überraschend an, weil sie »von dem (politisch) gezielten Aufwand der letzten Jahre so markant abstach«.15 Doch selbst hier belehrt uns ein Blick in die Quellen, dass ein »Hof« nach 1713 weiterhin existierte und demzufolge ein Hofleben mit all den dafür bekannten Komponenten in der preußischen Residenz beobachtet werden kann. Natürlich wies es mitunter sehr spezifische Merkmale auf, aber eine in den letzten Jahrzehnten sehr differenzierte Hofforschung hat die Sensibilität für die große Vielfalt des Erscheinungsbildes der Hofgesellschaften im Reich und in Europa geschärft.16 Vor diesem Hintergrund, aber auch unter Beachtung der Hofentwicklung in den brandenburgisch-preußischen Residenzen der Vergangenheit, erwiesen sich die Veränderungen in der Berliner und Potsdamer Residenz als nicht so spektakulär und einzigartig wie mitunter dargestellt.17
Die im ersten Regierungsjahr vorgenommenen Reduktionen im Hofpersonal fielen zudem ungleichgewichtig aus, richteten sich aber nach pragmatischen Erwägungen, die die Grundfunktionen des Hofes nach wie vor ermöglichten.18 Während die größten Einsparungen bei den Kämmerern, Kammerjunkern und Kammermusikanten vorgenommen wurden, hielten sich die Reduktionen in solchen Chargen wie den Leib- und Hof-Medici, den Pagen und den Silberkammerbedienten in Grenzen. Am radikalsten fiel der Einschnitt bei den Hofmusikern aus – hier sank der Etat von 8.627 auf 834 Taler. Bei der Gruppe der Lakaien stiegen hingegen die Ausgaben von 1712/13 zu 1713/14 von 1.528 auf 2.527 Taler.19 Ohnehin hat Friedrich Wilhelm I. im Verlauf der nächsten Regierungsjahre die Ausgaben für den Hofstaat allmählich wieder anwachsen lassen, so dass die in der Literatur immer wieder anzutreffende Behauptung einer radikalen und dauerhaften Reduktion der Hofausgaben dem Quellenbefund nicht standhält.20 Zwar waren die Einsparungen zunächst erheblich, indem die Ausgaben für die Hofhaltung von 335.676 Talern im letzten Regierungsjahr des alten Königs auf 134.086 Taler im Haushaltsjahr 1713/14 absanken, jedoch stiegen sie im Verlauf der nächsten Jahre immerhin wieder bis auf jährlich 200.000 Taler an.21 Auch die Kürzungen von Gnadenpensionen wurden bald zurückgenommen.
Wenngleich keine direkten persönlichen Verlautbarungen Friedrich Wilhelms I. zur partiellen Rücknahme dieser damit nicht ganz so radikal ausfallenden Veränderungen vorliegen, lassen sich die Motive zumindest indirekt erschließen: Zum einen hatte sich Preußen als Mitglied des europäischen »Mächtetheaters« an die Konventionen des zwischenstaatlichen Verkehrs zu halten. Hier konnte man sich nur bis zu einem gewissen Maße Reduktionen des zeremoniellen Aufwandes leisten, wollte man nicht eine abwertende Wahrnehmung und sukzessive abschätzige Behandlung riskieren.22 Und auch als Angehöriger der reichischen Fürstengesellschaft konnte und wollte Friedrich Wilhelm I. nicht auf diese Form des dynastischen Wettbewerbs verzichten.23 Letztlich war ihm sehr wohl bewusst, dass »Pracht und Aufwand als ausdrucksstarke Medien einer überwiegend bildhaften Verständigung zwischen den Höfen« galten.24 Obgleich Friedrich Wilhelm I. übermäßiges Zeremoniell ablehnte, reagierte er doch andererseits sensibel auf fehlenden Respekt und verminderte Ehrerweisungen, worauf in unseren Betrachtungen zur Außen- und Dynastiepolitik des Königs zurückzukommen sein wird. Nicht nur die Beibehaltung traditioneller Hofämter wie des Grand-Maître de la Garde-Robe, des Obermarschalls oder des Oberschenken sind auf solche Erwägungen zurückzuführen. Auch die – nach einer kurzen Phase von Einsparungen wieder – auskömmliche Finanzierung des Hofstaates der Königin enthielt eine außen- bzw. dynastiepolitische Komponente. Schließlich erwartete man für Sophie Dorothea als geborene welfische Prinzessin und damit als Angehörige einer der ältesten und vornehmsten Hochadelsfamilien im Reich eine ihrer Herkunft gerecht werdende Ausstattung.25 Schon bei der Einflussnahme auf die Beisetzungsfeierlichkeiten für König Friedrich I. war erkennbar, dass sich der neue Monarch sehr wohl über die Ausstrahlung eines solchen Ereignisses auf die anderen Höfe bewusst war. An dem vom Zeremonienmeister Johann von Besser vorgelegten »Project zu dem bevorstehenden Königlichen Leichenbegängniß« hat er persönlich Veränderungen vorgenommen, die nicht nur eine gewisse Sensibilität für solche repräsentative Ereignisse andeuteten, sondern zugleich seine Prioritäten hervortreten ließen. So forderte er, dass zusätzlich zu dem von Besser geplanten Programm bei dem Leichenzug »12 Bataillons« hinzugezogen werden sollten, »die gewiß keine geringe Parade machen werden«. Ebenso ist auf seine Veranlassung hin der Weg des Leichenzuges verändert worden. Dieser sollte durch die Breite Straße gehen, denn da »kann ich recht meinem Herrn Vater Ehre anthun durch die Regimenter«.26
Zum anderen aber ist die Rückführung des Hofetats auf ein gewisses Normalmaß mit innen- bzw. ständepolitischen Erwägungen und Zwängen zu erklären. Die bekannten und am brandenburgisch-preußischen Hof schon lange gepflegten Mechanismen einer Klientelpolitik, die unter anderem das Ziel verfolgte, einen Teil der adligen Führungsgruppen enger an den Monarchen zu binden, behielten auch nach 1713 ihre Gültigkeit. Dass Friedrich Wilhelm I. nach der Thronbesteigung die höhere Amtsträgerschaft und die Generalität längere Zeit im Ungewissen über ein eventuelles personelles Revirement gehalten hatte, wirkte disziplinierend, und die jeweilige Höhe der von ihm vorgenommenen Gehaltsreduzierungen dürfte von den Betroffenen als Gradmesser ihres derzeitigen Ansehens beim neuen Monarchen wahrgenommen worden sein.27 Selbst am von seinem Umfang her reduzierten Hof des neuen Königs kam es zu Rangstreitigkeiten – ungeachtet des den höfischen Etiketten distanziert gegenüberstehenden Königs oder der oft geschilderten Atmosphäre des solche Statusunterschiede nivellierenden »Tabakskollegiums«.28 Mit Intrigen und Rangstreitigkeiten hatte auch der »roi sergeant« zu rechnen – eine offensichtlich für ihn so bedeutsame Erfahrung, dass er es für wert befand, seinen Nachfolger vor »flatteurs«, »schmeichelers« und »intrigen« zu warnen.29 Der König entschied zum Beispiel am 10. September 1727 einen Streit unter den bei Hofe präsenten höheren Amtsträgern dahingehend, dass der Oberjägermeister v. Hertefeld und der Kammerpräsident v. Schlieben, »die nicht den Charakter eines Ministers haben«, dennoch diesen »vorgehen« und das Prädikat »Excellenz« erhalten sollten.30 Ebenso beflügelten die mit den Reformen der obersten Verwaltungsbehörden einhergehenden Veränderungen die stets latent bestehenden Konflikte um Rang und Prestige unter den hohen Amtsträgern nach 1713.31