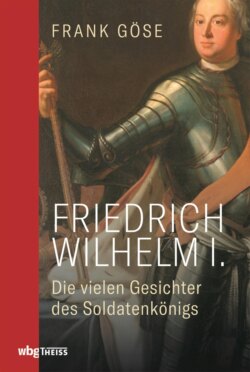Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
zur Rolle der Militärs in der Hofgesellschaft
ОглавлениеDie von Friedrich Wilhelm I. forcierte Prioritätensetzung auf das Militär zeitigte Rückwirkungen auf die Zusammensetzung der Hofgesellschaft. Die gewollte und offen zur Schau gestellte Förderung der adligen Offiziere sollte sich auch und gerade auf einer solchen exquisiten »Bühne« wie dem Hof widerspiegeln. Dazu gehörte neben der sichtlichen Hervorhebung militärischer Chargen in der modifizierten Hofrangordnung – der Generalfeldmarschall rückte jetzt an die erste Position32 – ebenso die Aufwertung der Uniform als bewusst angewandtes Stilmittel zur Selbstdarstellung des Herrschers, was kein Alleinstellungsmerkmal des preußischen Hofes bedeutete, aber dennoch bislang selten anzutreffen gewesen war.33 Der König nutzte also eine gewissermaßen althergebrachte Institution für den intendierten Traditionsbruch. Mit den obersten Hofämtern wurden häufig hohe Offiziere betraut – auch dieser Trend hatte bereits unter Friedrich I. eingesetzt, wenn man etwa an den Obristen Paul Anton von Kameke denkt, der 1705 zum Grand-Maître de la Garde-Robe ernannt worden war. Die bislang ein Hofamt innehabenden Offiziere, wie zum Beispiel die beiden als Generalmajore und Oberhofmeister (des Kronprinzen) dienenden Albrecht Konrad von Finckenstein und Graf Alexander von Dohna, bekleideten zwar nach 1713 kein offizielles höfisches Amt mehr, konnten ihre Militärkarriere aber bis zu höchsten Ehren als Generalfeldmarschälle fortsetzen.34 In wachsender Zahl wurden Offiziere mit Kammerherrnchargen betraut35, obgleich diese nur »bei außerordentlichen Gelegenheiten« wahrgenommen werden mussten.36 Friedrich Wilhelm I. konnte auch hier an bewährte Muster anknüpfen, denn schon seit den Zeiten des Großen Kurfürsten war ein Vordringen der Offiziere in zivile Ämter zu beobachten gewesen.37 In gewisser Weise hatte er also mit der viel zitierten Veränderung der Hofrangordnung weitgehend nur jenen auf die Dominanz der hohen Militärs innerhalb der Hofgesellschaft ausgerichteten Zustand wiederhergestellt, der schon zur Zeit des Großen Kurfürsten bestanden hatte. Und im Übrigen handelte es sich dabei nicht um eine Besonderheit des preußischen Hofes. Die Bevorzugung von Militärs als Diplomaten erschien mit Blick auf die anderen europäischen Staaten als nicht ungewöhnlich.38
Zudem sollte man die stärker ins Auge fallende Berücksichtigung von Offizieren bei der Vergabe von Chargen innerhalb der politisch-höfischen Führungsgruppe nicht mit einem abrupten Wechsel in der Personalpolitik des neuen Monarchen gleichsetzen. Vielmehr bekleidete schon unter Friedrich III./I. etwa ein Drittel der Inhaber von führenden Ämtern am Hof und in der Zentralverwaltung einen höheren Offiziers- oder Generalsrang.39 Und schon damals wurde ihnen ein herausgehobener Platz innerhalb der Hofrangordnung zuerkannt.40 Wohl aber wurden Offiziere jetzt regelmäßiger in das Hofleben integriert bzw. erhielten auch gezielt Aufgaben bei »solennen« Gelegenheiten wie Monarchenbegegnungen oder herausgehobenen Familienfesten. »Wann fremde hohe Herrschafften am Königl. Preußischen Hofe einsprechen, werden nicht nur Cammer-Herren, sondern auch vornehme Officiers, Obristen, Obrist-Lieutenants, Majors und Capitains ernannt, bey ihnen die Aufwartung zu haben«, bemerkte ein zeitgenössischer Beobachter treffend.41 Nicht nur bei solchen hochrangigen Besuchen wie des polnischen Königs und sächsischen Kurfürsten 1728 gehörten militärische Schauveranstaltungen zum Begleitprogramm in der preußischen Residenz, sogar bei weniger solennen Anlässen bediente man sich dieses Elements. Anlässlich des Besuches des ansbachischen Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich 1729 wohnte der Gast einer Musterung von drei Bataillonen unweit Potsdams bei, bei der es sich der König nicht nehmen ließ, als Obrist bei diesem Exerzieren an vorderster Stelle aktiv mitzuwirken.42
Dies korrespondiert mit einer generellen Einbindung des Militärischen in die Selbstdarstellung des preußischen Hofes und der Dynastie. Die Ursachen für jene seit den Zeiten des Großen Kurfürsten zu beobachtende Entwicklung sind vielschichtig und lassen sich nicht auf ein Hauptmotiv reduzieren. »Geopolitische Sachzwänge« und »zeitgeschichtliche Erfahrungen« des damaligen Kurprinzen und Kurfürsten Friedrich Wilhelm während des Dreißigjährigen Krieges sind hier anzuführen. Aber auch die einer ostentativen höfischen Repräsentationskultur im Wege stehende knappe Ressourcenlage, die sich durch kostensparende Betonung des Militärischen kompensieren ließ. Mit der Orientierung an der oranischen Dynastie, deren Stellung ebenfalls »weitgehend auf ihrer militärischen Leistung« beruhte, hatte man ein Vorbild für die künftige Ausgestaltung der eigenen Hofkultur.43
Somit stellte diese an der brandenburgisch-preußischen Residenz fest-zustellende Ausrichtung auf militärische Elemente eine Eigentümlichkeit dar und wurde von auswärtigen Beobachtern als solche wahrgenommen – ein Alleinstellungsmerkmal bildete sie aber nicht. Auch in anderen europäischen Monarchien und deutschen Fürstentümern konnte man eine Militäraffinität bei der Ausgestaltung des Hoflebens bzw. der Stilisierung der herrschenden Dynastie ausmachen, natürlich mit unterschiedlich nuancierter Intensität. Der schwedische »roi connetable« Karl XII. gilt hier fraglos als Vorbild innerhalb der europäischen Hochadelsgesellschaft, wozu nicht zuletzt die Lebensbeschreibung Voltaires beigetragen hat.44