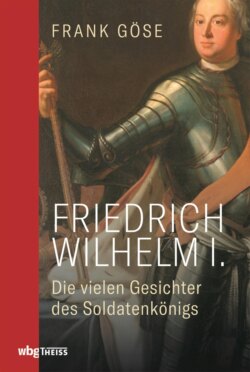Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеDer im Jahre 2013 zum 300. Male wiedergekehrte Tag der Thronbesteigung König Friedrich Wilhelms I. hat so gut wie keine Spuren in der Erinnerungskultur hinterlassen. Während das ein Jahr zuvor aufwendig begangene 300-jährige Jubiläum des Geburtstages Friedrichs II., »des Großen«, ein weit über die Grenzen der zum ehemaligen preußischen Staat gehörenden Gebiete hinausreichendes publizistisches Echo gefunden hat, ist der Jahrestag des Regierungsantritts seines Vaters fast unbemerkt geblieben. Nun stößt eine vorrangig an Jubiläen orientierte historische Forschung zwar bekanntermaßen auf Vorbehalte, gleichwohl dürfte gerade die Resonanz biographischer Publikationen vor dem Hintergrund einer auch medial und museal aufwendig begangenen Eventkultur entschieden größer sein, was uns jüngst am Beispiel Martin Luthers im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums deutlich vor Augen geführt worden ist. Schließlich ist kaum zu bestreiten, dass der Bekanntheitsgrad einer historischen Persönlichkeit in einer breiteren Öffentlichkeit – gewissermaßen als »Nebenprodukt« solcher Kampagnen – in der Regel zunimmt.
Friedrich Wilhelm I. hatte es auf diesem Terrain allerdings stets etwas schwerer. Wenn es im 18. Jahrhundert in der preußischen Residenz schon so etwas wie eine Abteilung für »Public Relations« gegeben hätte, wäre sie mit der »Vermarktung« des zweiten preußischen Königs gewiss so manches Mal überfordert gewesen – ganz im Gegensatz zu seinem Sohn, der, wie man weiß, bereits zu seinen Lebzeiten ein begnadeter Fachmann in Sachen seiner Selbstinszenierung war.1 Die Gründe für jene sowohl im zeitgenössischen Kontext als auch im Bild der Nachwelt so unterschiedliche Wahrnehmung der beiden preußischen Monarchen sind vielschichtig und verschließen sich einfachen Erklärungen. Es handelt sich dabei im Übrigen um keine erst in der jüngeren Geschichtsschreibung zu beobachtende Erscheinung. Überblickt man die reiche Brandenburg-Preußen-Historiographie wie auch die vielfältigen Erscheinungsformen der Geschichtskultur, dann blieb der zweite preußische König stets im Schatten seines Sohnes, Friedrichs des Großen, aber auch seines Großvaters, des Großen Kurfürsten. Der recht selektive Zugang zu Friedrich Wilhelm I., seine höchst ambivalenten Bewertungen und die Intensität der Beschäftigung mit diesem Monarchen lassen vielmehr Rückschlüsse auf die Interessenlagen und Sichtweisen der jeweiligen Zeit zu, denn letztlich stellt bekanntlich jede Generation, jede Gesellschaft ihre eigenen Fragen an die Geschichte. Tatkraft und Energie waren ihm in gewiss ähnlicher Weise eigen wie seinem gleichnamigen und mit viel mehr Anerkennung bedachten Großvater, dem »Großen Kurfürsten«. Diese Vorzüge stachen bei seinem Vorvorgänger aber wohl deshalb besonders hervor und sind durch die Nachwelt ausgiebig gerühmt worden, weil er mit seinem Krisenbewältigungsprogramm am Beginn des Aufstiegsprozesses des brandenburgisch-preußischen Staates gestanden hatte und mit seinen Reformen vor dem Hintergrund des zu Ende gehenden Dreißigjährigen Krieges als einer der dunkelsten Zeiten der brandenburgischen Geschichte zu einer Lichtgestalt geriet. Jüngst hat Christopher Clark den besonderen historischen Ort, in dem Kurfürst Friedrich Wilhelm agierte, noch einmal pointiert vor Augen geführt.2
Demgegenüber ließen in nicht unwesentlichem Maße bestimmte Negativzuschreibungen König Friedrich Wilhelm I. in der historischen Gesamtbilanz zurücktreten. Wie man weiß, waren die Memoiren seiner ältesten Tochter Wilhelmine hieran nicht ganz unschuldig, deren Wertungen auch Voltaire aufgriff und in der aufgeklärten Öffentlichkeit eine Generation später verbreitete. Als ein despotisch auftretender Vater, der innerhalb der eigenen Familie die schlimmsten Zerwürfnisse heraufbeschwor, als ein in der residenzstädtischen Öffentlichkeit mit dem oft locker sitzenden Stock daherkommender, den »schönen Dingen des Lebens« scheinbar ablehnend gegenüberstehender Kulturbanause und Asket, als ein seinen »lieben blauen Kindern«, wie er die Soldaten seines Königsregiments zu bezeichnen pflegte, alles unterordnender Herrscher, der zudem mit cholerischen Charakterzügen, Geiz und Misstrauen ausgestattet war, eignete er sich kaum als Sympathieträger. Somit verwundert es nicht, dass er mit Titulierungen wie »Haustyrann«, »halbbarbarisch« (G. Ritter), »ein Ekel, ein Psychopath« (G. Oestreich), »erzfrommer Menschenquäler« (R. Augstein) oder mit dem wohl bekanntesten – obschon nicht zeitgenössischen – Beinamen des »Soldatenkönigs« bedacht worden ist. Zudem hat man es hier nicht nur mit späteren Zuschreibungen zu tun – schon unter den Zeitgenossen wurde so manches abschätzige Bild über den König vermittelt, mitunter mit kaum verhohlener Absicht.3 Auch Carl Hinrichs, einem der wohl besten Kenner Friedrich Wilhelms I., offenbarten sich nach eigenem Bekunden, je länger und intensiver er sich mit dessen Leben beschäftigte, in immer stärkerer Weise die problematischen Seiten dieser Persönlichkeit, so dass seine biographische Darstellung letztlich ein Torso blieb.4
Wenn hiermit nun ein erneuter Versuch der Annäherung an diesen preußischen König gewagt wird, dann nicht im Sinne einer revisionistischen Generalüberholung mit dem Ziel, die düsteren Seiten der Persönlichkeit Friedrich Wilhelms zu übertünchen. Sonst läge man nicht allzu weit entfernt von einem Ansatz, dessen problematische Absicht Friedrich Nietzsche einst in ein pointiertes Bonmot gefasst hat: Demnach handele »Geschichte fast nur von … schlechten Menschen, welche später gutgesprochen worden sind«.5 Um ein »Gutsprechen«, also um das Malen eines schöngefärbten Bildes Friedrich Wilhelms I., soll es hier aber gewiss nicht gehen. Vielmehr hat ein Geschichtsschreiber laut Theodor Fontane »sich in erster Reihe zweier Dinge zu befleißigen: er muß Personen und Taten aus ihrer Zeit heraus begreifen und sich vor Sentimentalitäten zu hüten wissen«.6 In der Tat – ein leicht deklarierter, dafür umso schwerer einzulösender Vorsatz!
Überdies wird damit eine weitere und durchaus grundsätzliche Frage angesprochen, die man gleich zu Beginn einer solchen Darstellung zu beantworten versuchen sollte: Bedarf es – mal abgesehen von vielleicht eher dem Zeitgeist verpflichteten »Aufhübschungen« seines Bildes – überhaupt einer neuen Biographie des Monarchen? Zieht man den historiographischen Befund zu Rate, zeigt sich bald, dass diesem preußischen König relativ wenige biographische Studien gewidmet worden sind.7 Nach der noch zu Lebzeiten des Königs erschienenen Lebensbeschreibung von David Fassmann8 war es erst die mehrbändige Gesamtdarstellung von Friedrich Förster aus dem Jahre 1835, die erstmals auf einer breiteren Quellengrundlage das Leben des zweiten preußischen Königs einem größeren Publikum bekannt zu machen versuchte.9 Zwar sind durch Leopold von Ranke und Johann Gustav Droysen keine genuinen Biographien dieses Monarchen vorgelegt worden, wohl aber haben ihre Interpretationen im Rahmen ihrer Standardwerke zur altpreußischen Geschichte das Urteil über ihn für die folgenden Jahrzehnte nachhaltig geprägt.10 Und es verwundert nicht, dass der zuweilen zum »Bürgerkönig« stilisierte Herrscher vor allem durch Kreise des nationalliberal gesinnten Bürgertums eine positivere Bewertung erfuhr. Seine im Vergleich zu seinen Vorgängern, aber auch zu seinem Nachfolger adelskritischen Einlassungen dürften solche Sympathien jedenfalls beflügelt haben. Bekanntlich war es Theodor Fontane, der diese Stimmungen in der ihm eigenen Art zum Klingen gebracht hat. Besonders eingängig vermochte er dies in seinem Roman »Der Stechlin«, in dem er den Pfarrer Lorentzen sagen ließ: »Wir haben, wenn wir rückblicken, drei große Epochen gehabt. … Die vielleicht größte, zugleich die erste, war die unter dem Soldatenkönig. Das war ein nicht genug zu preisender Mann, seiner Zeit wunderbar angepaßt und ihr zugleich voraus. Er hat nicht bloß das Königtum stabiliert, er hat auch, was viel wichtiger, die Fundamente für eine neue Zeit geschaffen und an die Stelle von Zerfahrenheit, selbstischer Vielherrschaft und Willkür Ordnung und Gerechtigkeit gesetzt. Gerechtigkeit, das war sein bester ›Rocher von Bronze‹.«11
Im Gegensatz zu mehreren großen wissenschaftlichen Biographien, die Friedrich dem Großen gewidmet wurden, sollte es bis in die 1930er Jahre dauern, ehe sich ein Bearbeiter für ein vergleichbares Unternehmen hinsichtlich seines Vaters gefunden hatte. Nicht zufällig entstammte er der Gruppe jener Wissenschaftler, die an der verdienstvollen Editionsreihe der Acta Borussica beteiligt waren. Von dem groß angelegten, jedoch unvollendet gebliebenen biographischen Versuch Carl Hinrichs’ ist bereits die Rede gewesen. Auf über 700 Seiten entfaltete Hinrichs seine mit Blick auf die Quellenauswertung, aber auch in der schriftstellerischen Meisterschaft bislang unübertroffene Darstellung der 25 Jahre umfassenden kronprinzlichen Lebensphase seines Helden – ein Werk, das im Übrigen ein Gesamtpanorama der Geschichte des brandenburgischpreußischen Staates zwischen 1688 und 1713 bietet. Den erhofften zweiten Band hat der 1962 verstorbene Hinrichs nicht vorzulegen vermocht. Ob ihm wirklich sein Forschungsgegenstand suspekter wurde, je tiefer er in die Materie eindrang, oder ob es nicht doch zuvörderst die der Beschäftigung mit der altpreußischen Geschichte kaum förderlichen Rahmenbedingungen der 1950er und 60er Jahre im Zeichen von »Abrechnungsliteratur und Gesinnungshistorie« waren, die ihn davon abhielten, wird wohl nicht abschließend beurteilt werden können.12 Lange Zeit war Preußen dann in Wissenschaft und Öffentlichkeit sowohl in Ost als auch in West nicht en vogue. Es sollte bis in die 1970er Jahre dauern, bis in den beiden deutschen Staaten fast zeitgleich zwei vom Umfang her recht knapp gehaltene Biographien über Friedrich Wilhelm I. erschienen, die damit auf je unterschiedliche Weise den spezifischen Zugang der bundesrepublikanischen und der DDR-Geschichtswissenschaft zur Preußenthematik widerspiegelten. Der in Marburg lehrende renommierte Frühneuzeithistoriker Gerhard Oestreich legte 1977 eine Lebensbeschreibung des Königs vor, die er in die allgemeine Strukturgeschichte Preußens einzubinden versuchte.13 Zugleich ordnete sich dieses Buch in die sich damals abzeichnende vorsichtige Zuwendung zur Preußenthematik ein – das »Preußenjahr« 1981 warf bereits seine Schatten voraus. Heinz Kathes erstmals 1976 im Akademieverlag der DDR erschienene Biographie stand hingegen noch weitgehend in einer Tradition, in der Preußen und das Preußentum und damit auch seine führenden Repräsentanten aus marxistischer Sicht auf ihre negative Rolle innerhalb der deutschen Geschichte fokussiert wurden.14
In den jüngst erschienenen Gesamtdarstellungen zur preußischen Geschichte nahm die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. den ihr gebührenden Rang ein – gleich ob man eher die dynastiegeschichtliche Perspektive bemüht15, den Akzent mehr auf die Einbindung des Königs in die gesellschaftlichen Prozesse und Strömungen gelegt16 oder in klassischer Weise die Leistungen Friedrich Wilhelms I. in der Verwaltung, im Heerwesen und bei der Förderung der pietistischen Bewegung herausgestellt hat.17
Doch die Wahrnehmung Friedrich Wilhelms I. in der Öffentlichkeit war und ist nicht nur auf geschichtswissenschaftliche Darstellungen beschränkt geblieben. Immer wieder wurde versucht, der Ambivalenz seiner Persönlichkeit nahezukommen, sei es in apologetisch überhöhenden, klischeehaft verzerrenden, aber auch mit dichterischer Meisterschaft tief in die Psyche des Königs eindringenden Publikationen populärwissenschaftlichen Zuschnitts.18
Zwar wurden in den letzten Jahrzehnten wiederholt populäre Lebensbeschreibungen vorgelegt, die aufgrund ihrer oftmals unterhaltsamen Diktion und des flüssigen Stils stets ihr Publikum fanden. Allerdings können die zumeist nur auf einer schmalen Basis an Quellen und Sekundärliteratur beruhenden Darstellungen nicht jene wissenschaftlich fundierten Arbeiten ersetzen, die vor allem zwei Anforderungen genügen sollten: Zum einen schließt ein solches Unternehmen – gewissermaßen als das »Kerngeschäft« der historischen Zunft – die Einbeziehung und gründliche Auswertung von archivalischen Quellen ein. Und zum anderen bedarf es der Berücksichtigung der neuesten Forschung mit den einschlägigen Diskursen in den verschiedenen Teildisziplinen des Faches. Zwar muss man nicht jedem modischen »turn« in der Scientific Community hinterherlaufen und »seinen« Helden in diesem Sinne uminterpretieren. Zur Kenntnis nehmen sollte man diese Entwicklungen gleichwohl.19 Denn gerade das Genre der Herrscherbiographie zeichnet sich dadurch aus, dass hier eine Vielzahl von Teilbereichen, angefangen von der Politik- und Verfassungsgeschichte über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis hin zur Kunstgeschichte, Mentalitätsgeschichte und natürlich auch der Medizingeschichte, einbezogen werden müssen. In gewisser Beziehung sollte sich deshalb ein Biograph als eine Art »Allrounder« verstehen, wenngleich er diesem Anspruch in vollem Umfang kaum gerecht werden kann.
Freilich wird man bei der Nachzeichnung des Lebens eines frühneuzeitlichen Monarchen nicht umhinkommen, die Geschichte jenes Staates und jener Gesellschaft zu behandeln, an deren Spitze er stand. Daran sollte auch in diesem Fall trotz mitunter geäußerter Bedenken, dass eine Biographie über Herrscherpersönlichkeiten zu sehr in eine allgemeine Darstellung der Zeit abdriften könnte, statt eine wirkliche Lebensbeschreibung zu bieten, festgehalten werden. Mehrere Gründe sprechen für eine Berücksichtigung solcher, dem »life and time«-Konzept verpflichteten Aspekte: Zum einen bildete das Staatswesen den Resonanzboden, die Projektionsfläche für die politischen Konzeptionen und das Agieren eines Regenten. Zum anderen war die Epoche des Ancien Régime, in der wir uns im Folgenden bewegen, noch sehr stark auf die Herrscherpersönlichkeit orientiert und durch privatrechtliche Vorstellungen von Herrschaft charakterisiert. Mit anderen Worten: Die Trennung einer »staatlichen« von einer »privaten« Sphäre begann sich erst allmählich herauszubilden.
So würde es wenig Sinn machen, eine nur die Persönlichkeit des Monarchen einschließende Darstellung zu bieten, abgesehen davon, dass einer solchen Diktion für die hier zu behandelnde Zeit und die gesellschaftliche Gruppe kaum realitätskonforme Vorstellungen zugrunde lägen. Und auch gegenüber einer zu stark »psychologisierenden« Deutung, obschon dies hin und wieder versucht wird20, sollte man Zurückhaltung walten lassen. Die Bedenken der gegenwärtigen Psychologie gegenüber »Ferndiagnosen« sind bekannt21, und erst recht sind solcherlei Vorbehalte wohl berechtigt, wenn der Proband vor 300 Jahren gelebt hat.
Um aber auf die Ausgangsfrage nach der Berechtigung eines erneuten Versuchs der Beschäftigung mit dem Leben Friedrich Wilhelms I. zurückzukommen: Trotz des bereits großen Wissens, das insbesondere die ältere Forschung zur Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. nicht zuletzt in einer Vielzahl an Quelleneditionen aufbereitet hat, wie etwa in den Reihen der verdienstvollen Acta Borussica, bleiben noch genügend offene Fragen. So erscheint es zum Beispiel reizvoll, den persönlichen Anteil des Königs an den grundlegenden Entwicklungen und Entscheidungen in den einzelnen Politikbereichen genauer auszuloten. Eigentlich, so könnte man dagegenhalten, müsste dies bei einem so von seinem Herrscheramt überzeugten und das ihm zur Verfügung stehende Regierungssystem vergleichsweise so effizient nutzenden Monarchen fraglos vorausgesetzt werden können. Doch bei näherem Hinsehen bleiben durchaus Ungereimtheiten, und man wird zugleich auf jene übergreifenden Fragestellungen geführt, die mit dem »Funktionieren« von frühneuzeitlicher Herrschaft schlechthin in Verbindung stehen. Schließlich ist die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. eingebettet in eine Epoche, die lange Zeit mit dem Etikett des »Absolutismus« bzw. der »absoluten Monarchie« versehen war. Solche Zuschreibungen sind allerdings in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten sehr in die Kritik geraten, so dass diese Begriffe in der Geschichtswissenschaft entweder gar nicht mehr oder allenfalls nur in Anführungszeichen verwendet werden, auch wenn signifikante Veränderungen in der Herrschaftspraxis und -stilisierung in den damaligen Staatswesen kaum in Abrede zu stellen sind. Einem mit dem Begriff »absolutistisch« etikettierten Herrscher hat man a priori eine besondere »Allgegenwart« bzw. »Allzuständigkeit« unterstellt – Eigenschaften, die fast an die Effektivität moderner Staaten zu erinnern scheinen. Dass dies mit der historischen Realität der Staaten und Gesellschaften des Ancien Régime aber wenig gemein hatte, ist durch die Forschung der letzten Jahrzehnte an vielen Fallbeispielen belegt worden. Doch entsprach nicht gerade Friedrich Wilhelm I. in fast idealer Weise diesem Bild, zumal der mit seinem Regierungsantritt einhergehende Kontinuitätsbruch allzu deutlich zutage trat? Zwar sind die zeitgeistigen Bezüge einer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegebenen Wertung der Zäsur von 1713 offensichtlich, wonach »die Anwandlungen französischen Monarchismus durch nüchterne, hausbackene Prosa eines bürgerlich-soldatischen Königthums nach deutschem Zuschnitt ersetzt worden« seien.22 Als »Strukturbegründer« (W. Neugebauer) scheint er aber wie kein Herrscher vor ihm in seinem Staatswesen in relativ kurzer Zeit Veränderungen anberaumt und durchgesetzt zu haben, und auch der ihm schon im frühen 19. Jahrhundert verliehene Beiname als »Preußens größter innerer König« (Theodor von Schön) mag eine entsprechende Deutung stützen.
Deshalb ist es im Folgenden naheliegend, genauer auszuloten, über welchen Spielraum der König in den verschiedenen Politikbereichen verfügte und inwiefern er überhaupt in der Lage war, seine Ideen und seinen Willen wirklich umzusetzen. Mitunter scheint ein Problem auch für die »absolutistische« Epoche immer noch nicht hinlänglich gelöst zu sein, das Heinrich Lutz einst am Beispiel eines anderen frühneuzeitlichen Monarchen, des Kaisers Karl V., wie folgt umrissen hat: »Wie kommen die Entscheidungen jener Instanz, von der wir zu oft unreflektiert sagen: ›der Kaiser beschloß‹, im konkreten Zusammenspiel der verschiedenen Personen, Gruppen, Konzeptionen und Taktiken zustande?«23 Auch im Falle Friedrich Wilhelms I. wird man also gründlicher zu prüfen haben, auf welchen Handlungsfeldern die Entscheidungen auf unmittelbares Agieren des Monarchen zurückzuführen sind, inwiefern diese auf externe Einflüsse zurückgingen und in welchen Fällen diese nur in seinem Namen getroffen wurden.
Des Weiteren wird versucht, diejenigen Facetten des Regierungsalltags Friedrich Wilhelms I. einer näheren Betrachtung zu unterziehen, die bislang entweder nur nachrangig behandelt oder überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. »Mehr als nur Soldatenkönig« lautete der Titel einer von Jürgen Kloosterhuis und mir konzipierten Tagung über Friedrich Wilhelm I., die im Frühjahr 2017 in Berlin durchgeführt wurde. Und in der Tat fanden in den damals gehaltenen Vorträgen die klassischen Themen, die man bislang mit diesem Herrscher verbunden hatte, wie die Verwaltungsreformen, die Peuplierungspolitik oder der Ausbau des preußischen Heeres zur viertgrößten Streitmacht in Europa, keine oder nur eine marginale Berücksichtigung. Vielmehr gerieten mit dem – wie seine Standesgenossen – in familiären und dynastischen Kategorien denkenden Monarchen, dem durchaus den Konventionen der Zeremonialpraxis seiner Zeit folgenden, keineswegs sich naiv auf dem Parkett der Außenpolitik bewegenden König und dem sich sehr wohl als kunstsinnig erweisenden Genussmenschen und Sammler solche Seiten seiner Persönlichkeit in den Blick, die die früheren Zuschreibungen und Bewertungen zwar nicht revidieren, wohl aber komplettieren und damit ein wesentlich zeitkonformeres Bild über Friedrich Wilhelm I. zu zeichnen vermögen. Jene Überlegungen ließen letztlich den Entschluss für die konzeptionelle Anlage des vorliegenden Buches reifen, keine chronikalische Lebenserzählung unseres »Helden«, gewissermaßen »von der Wiege bis zur Bahre«, zu präsentieren, sondern in den einzelnen Kapiteln ausgewählte Handlungsbereiche vorzuführen. Dadurch kann das Agieren Friedrich Wilhelms I. konziser vorgestellt, erklärt und im Kontext seiner Herrschaftspraxis gewichtet werden, ohne der Gefahr vieler Redundanzen zu erliegen.
Mit durchaus erwägenswerten Argumenten ist überdies häufig der Zäsurcharakter betont worden, der für die altpreußische Geschichte mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms im Jahre 1713 verbunden war. Aber fiel dieser Herrscherwechsel wirklich so scharf aus, wie vor dem Hintergrund der in der Tat zunächst recht überraschten Zeitgenossen und seiner immer wieder gern zitierten »Regierungserklärung« postuliert wurde, die er einen Tag nach dem Tod seines Vaters in markiger Pose vor den angstvoll der Veränderungen harrenden Ministern gehalten haben soll? Auch hier wird man genauer hinzuschauen haben, um zum einen die ins Auge springenden grundstürzenden und keineswegs wegzudiskutierenden Veränderungen der Herrschaftspraxis und zum anderen die ebenso zu beobachtenden Kontinuitäten und länger wirkenden Traditionen angemessen gewichten zu können. Ebenso gilt es, im zeitlichen Längsschnitt zu prüfen, in welcher Weise sich das Preußen des Jahres 1740 im Vergleich zu demjenigen zur Zeit des Regierungsantritts Friedrich Wilhelms I. verändert hatte. Nicht zuletzt der König selbst entwickelte sich im Verlauf seiner 27 Jahre währenden Regierung weiter. So ist davon auszugehen, dass sich bei ihm bestimmte Interessen und politische Leitvorstellungen ebenso modifiziert haben, wie auch seine Persönlichkeit, sein Charakter Veränderungen unterworfen war, was sich natürlich wiederum auf seinen Herrschaftsstil auswirken konnte.24
Und schließlich zwingt eine auf den ersten Blick so außergewöhnlich erscheinende und von den zeittypischen Normen so gravierend abstechende Herrscherpersönlichkeit wie Friedrich Wilhelm I. noch zu einer weiteren Überlegung: Wenn man eine Personifizierung des oft deklarierten »preußischen Sonderweges« vornehmen würde, dann stünde der »Soldatenkönig« gewiss an vorderer Stelle. Mit fast revolutionärer Attitüde schien er innerhalb kurzer Zeit langlebige Traditionen in einer Art »Bildersturm« (C. Hinrichs) hinwegfegen zu wollen. Doch auch bezogen auf diese Zuweisungen sollen die scheinbar so klar auf der Hand liegenden Gewissheiten auf den Prüfstand gestellt werden. Ob und in welchen Bereichen von Staat und Gesellschaft es sich im preußischen Fall um einen »Sonderweg« handelte und ob Persönlichkeit und Herrschaftsstil Friedrich Wilhelms I. wirklich so einzigartig waren, bleibt diskussionswürdig. Schon ein mit dem Thema gut vertrauter älterer Forscher hat hellsichtig davor gewarnt, durch die Zeichnung des zweiten preußischen Königs als »eine groteske Gestalt« den »Unterschied Friedrich Wilhelms von den übrigen Fürsten möglichst grell auszumalen«.25 Um eine solche These bestätigen oder widerlegen zu können, erscheint es unumgänglich, den Monarchen in Beziehung zu setzen mit anderen gekrönten Häuptern seiner Zeit und sich fallweise mit den zeitgenössischen Verhältnissen in anderen deutschen Territorien bzw. europäischen Staaten zu beschäftigen. Demzufolge wird in vorliegender Darstellung ein punktuell vergleichender Ansatz verfolgt und ein gelegentlicher Blick über die Grenzen gewagt, um die am preußischen Fall vorgenommenen Beobachtungen einordnen und gewichten zu können. Damit soll nicht einer Relativierung Friedrich Wilhelms I. das Wort geredet werden, vielmehr dürfte ein solcher Ansatz mit dazu beitragen, die Konturen seines Lebens und seiner Regierungszeit zu schärfen und damit eine möglichst vorurteilsfreie Beurteilung dieses preußischen Königs zu erreichen. Um nicht mehr und nicht weniger soll es in der folgenden Darstellung gehen.
Abschließend ist es mir ein großes Bedürfnis, Dank zu sagen für die vielfältige Unterstützung, die ich während der Beschäftigung mit diesem, fast schon zu »meinem« gewordenen König erhalten habe. Stellvertretend für viele möchte ich besonders zwei Kollegen namentlich erwähnen: Herrn Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis, den ehemaligen Direktor des Geheimen Staatsarchives Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, mit dem ich gerade zu Themen der preußischen Militär- und Verwaltungsgeschichte so manches erhellende Gespräch führen konnte, sowie meinen ehemaligen Doktoranden und jetzigen Archivleiter in Nabburg und Pfreimd, Herrn Dr. Felix Engel, der mir bei der Erstellung des wissenschaftlichen Apparates und vor allem der Korrektur des Manuskriptes eine unschätzbare Hilfe war.