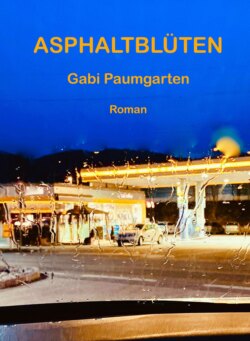Читать книгу Asphaltblüten - Gabi Paumgarten - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеWenn der Wecker mit seinem penetranten Surren um sechs Uhr dreißig bei Dagmar Weinerl läutet, kommt es ihr jedes Mal so vor, als sei es noch mitten in der Nacht. Selbst das grell zum Fenster herein blitzende Tageslicht hinter den geöffneten Vorhängen hilft nur wenig. Sie wirft sich von der einen Seite auf die andere und zieht das Kissen über den Kopf, um sofort wieder in einen lebhaften Traum einzutauchen, bei dem sich die Geräusche, die die morgendlichen Rituale ihrer Kinder erzeugen, mit den Bildern der Fantasie zu einer bunten Szenerie verweben.
Bei Peter ist es genau umgekehrt. Mit dem ersten Takt der Weckmelodie sitzt er aufrecht im Bett. Den Weckalarm stellt er immer fünf Minuten vor der Aufstehzeit. Mit Schwung zieht er die Bettdecke weg, schlüpft in seine Hausschuhe und geht ins Badezimmer. Nachdem er seine Morgentoilette – lange Dusche und kurzes Zähneputzen – erledigt hat, macht er sich in der Küche ans Werk. Davor weckt er Paul und Marie, indem er beim Vorbeigehen an ihre Schlafzimmertüren hämmert.
Peter ist fünfzehn, Paul zwölf und Marie acht Jahre alt. Warum Mama morgens schwer aus dem Bett kommt, weiß Peter. Es sind die langen Nachtdienste im Krankenhaus, die der Mutter mehr und mehr zusetzen. Wie nach einer Vollnarkose schleppt sich Dagmar an den Frühstückstisch, auf dem für jeden eine Schüssel mit Cerealien und ein heißes Getränk steht. Sie setzt sich schlapp wie ein nasser Lappen zu den Kindern, unfähig ein Wort zu sprechen.
„Es ist Post gekommen, Mama!“ Peter deutet mit dem Löffel in der Hand auf die Kommode. „Schaut so aus, als wäre ein Brief von irgendeinem Gericht dabei.“
Selbst wenn Dagmar ihr Todesurteil darin erfahren würde, wäre sie jetzt zu keiner Regung fähig. Ihre Arme und Beine sind schwer wie Blei, so als hätte man ihr jegliches Blut aus den Adern gezapft, weshalb sie nur leicht nickt, wissend, dass ihr Großer nicht zufällig auf die jüngste Post hinweist.
„Ich brauch noch Geld für die Schule“, fällt Paul gleich darauf Peter ins Wort.
„Einen Scheiß brauchst du“, kommt die Antwort des älteren Bruders wie eine gestreckte Faust auf ihn zu.
„Ich brauche auch Geld für die Schule.“ Das kam von Marie, die sich verteidigend auf Pauls Seite stellt. Ihre familiäre Courage hat sich dann und wann schon einmal zu ihren Ungunsten ausgewirkt, wenn Pete, wie sie ihren großen Bruder nennt, ihr das Fernsehen verboten hat. Marie weiß, dass Peter immer dann das Sagen hat, wenn Mama nicht zu Hause ist und dass das zwischen den Brüdern immer wieder zu Machtkämpfen führt. Wenn aber die Mama daheim ist, hat Pete nichts mehr zu melden. Diesmal aber liegt in Peters Stimme etwas, das Marie eine Brisanz signalisiert, sodass sie nicht länger auf das Geforderte pocht.
Dagmar erhebt sich vom Stuhl und geht wie ein ferngesteuertes Spielzeug zu ihrer Handtasche. Nachdem sie kurz darin kramt, hält sie ein paar Scheine in der Hand und reicht jedem der Kinder fünfzig Euro hin.
„Um den Brief kümmere ich mich später. Macht jetzt, dass ihr in die Schule kommt. Es ist spät.“
„Und was ist heute Abend? Bist du zu Hause oder … hast du wieder Nachtdienst?“, fragt Peter und Dagmar entnimmt seiner Stimme so etwas wie den Hauch eines Misstrauens.
„Mal sehen. Vielleicht übernimmt heute meine Kollegin den Dienst, dann bin ich bei euch zu Hause und wir kochen Spaghetti. Und wenn ihr Lust habt, machen wir einen Spieleabend.“
Marie und Paul drücken der Mutter jeweils einen Kuss auf die Wange, während Peter, den Blickkontakt meidend, nur ein kurzes, kaum zu vernehmendes „Tschüss“ über die Lippen bekommt.
Das ist der Moment, an dem Dagmars Schuldgefühl wie eine Stichflamme auflodert, so als hätte man Benzin in eine Kerze gegossen. Ihr Ältester ist schneller erwachsen geworden, als ihr lieb ist. Sie spürt, dass sich in seinem Kopf zermürbende Fragen wie Gewitterwolken aufbauschen und doch kann sie ihm keine brauchbaren Antworten darauf geben. Dagmar fragt sich, wie lange Peter ihr das mit dem Nachtdienst im Krankenhaus noch abnehmen wird und wie er reagieren würde, wenn er wüsste, wo sie sich während der Nachtstunden aufhält. Bis dahin aber stellt er eine große Hilfe im Haushalt dar, indem er sich um die Aufgaben der beiden Jüngeren, um das Abendessen oder um die Wäsche kümmert.
Nachdem sich die Tür hinter den Kindern geschlossen hat, muss Dagmar den Brief, auf dem ein fett gedruckter Stempel des örtlichen Gerichts prangt, nicht öffnen, um zu wissen, worum es sich bei dem amtlichen Schreiben handelt. Nach ein paar Minuten nimmt sie eine Schere und schlitzt das Papier am Falz mit Gewalt auf. Energisch zieht sie ein gefaltetes Blatt heraus. Ohne es zu öffnen, werfen ihre Augen einen Blick auf die Summe: 430.000 Euro. In ihrer Magengrube rumort es. Diese stolze Summe und Gerds Tod sind der Preis für einen Augenblick Unachtsamkeit. Die Unachtsamkeit für die Dauer einer kurzen SMS mit den Worten „Bin gleich da!“, die sie sich nie verzeihen wird können.
Es war der neunzehnte Dezember 2013, als Dagmar Weinerl ihren Mann Gerd von seiner Skat-Runde bei einem nahegelegenen Gasthaus abholte. Er hatte getrunken und wollte nicht mehr selbst nach Hause fahren. Es goss wie aus Kübeln und die Sicht war wie von Tüllgardinen umhüllt. Unsicher lenkte Dagmar den Wagen auf der regennassen Fahrbahn dahin. Nur wenige Fahrzeuge waren noch unterwegs. Gerd war, kaum war er in den Wagen eingestiegen, am Beifahrersitz eingeschlafen. Nur noch eine letzte Kurve trennte sie von ihrem Zuhause, als sich Peter mit der SMS meldete. Mama, wo bleibst du so lange? Die Kleinen weinen nach dir. Um ihren damals siebenjährigen Sohn zu beruhigen, antwortete die Mutter knapp. Bin gleich da.
Sie hatte gerade den Befehl zum Versenden gedrückt, als ein lauter Knall inklusive Quietschen und Klirren ertönte. Abrupt wurde Dagmar gegen das Lenkrad geschleudert. Das Handy war ihr aus der Hand gefallen, noch ehe sich der Airbag zu einem riesigen Ballon aufblähte, um einen dichten, weißen, ätzenden Nebel auszuscheiden, der sich rasch im gesamten Wageninneren ausbreitete. Da sie weder durch die Scheiben nach draußen noch Gerd neben sich sehen konnte, riss sie die Fahrertür auf und stolperte förmlich ins Freie. Dagmar schrie. Sie schrie aus Leibeskräften nach Gerd, nach den Kindern, nach Hilfe. Doch wie in einer Gruft erfüllten Dunkelheit und Totenstille die Umgebung. Nichts rührte sich. Der Regen hatte aufgehört. Im Kegel des Scheinwerferlichts glitzerte die Nässe der Straße wie Silberpapier.
„Gerd! Gerd!“, schrie sie aufs Neue. „Steig aus! Komm raus aus dem Wagen!“
Abwechselnd zog sie an der Wagentür oder trat dagegen. Als sich diese unter einem hohlen Quietschen auftat, entdeckte sie ihren Mann nach vorne gebeugt an das Armaturenbrett gelehnt. Er lag auf den Fetzen des Airbags wie auf einem weißen Laken und schien zu schlafen. Zuerst rüttelte, dann zog sie an ihm, bis er auf den harten Straßenbelag herausfiel. Sie klatschte ihm die Hände in das Gesicht, während sie auf ihn einbrüllte: „Wach auf! Wach auf! Wach doch auf! Gerd, bitte, wach auf!“
Doch ihr Mann rührte sich nicht. Wie ein kleines Kind kauerte sie vor ihm und wollte aus dem Albtraum nicht erwachen. Erst als sie das Läuten eines Telefons vernahm, wusste sie, dass alles grausame Wirklichkeit war. In dem Moment kam ihr das andere Fahrzeug in den Sinn. Sie stürzte zu dem Kleinwagen hin und nahm es wie eine Erlösung wahr, als sie das schmerzhafte Wimmern einer Männerstimme darin vernahm. Rasch öffnete sie die Tür und holte den jungen Mann aus dem beschädigten Wagen heraus. Sie legte ihn ebenfalls auf den Boden, dann sprach sie ihn an: „Hören Sie mich? Können Sie mich verstehen?“
Dagmar konnte das volle Ausmaß des verheerenden Unfalls zunächst nicht erfassen. Als einer der beiden Polizisten sie nach ihren Papieren fragte, erwiderte sie deshalb in einem gleichmütigen Tonfall, aber ehrlich: „Ich habe keinen Führerschein.“
Erst im Krankenhaus wurde sie von der Oberärztin über die unabänderbaren Folgen ihrer kurzen Unachtsamkeit informiert. Gerd war noch am Unfallort verstorben, wodurch ihre drei kleinen Kinder, Peter, Paul und Marie, zu Halbwaisen wurden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitt schwerste Verletzungen an Armen und Beinen. Er verlor ein Auge und hatte eine rechtsseitige Frontallappenquetschung, die nachhaltige Störungen in der Bewegung, im Sprechen und im Greifen verursachen würde.
Nach zehn Monaten kam es zu einer Gerichtsverhandlung, bei der sie zu einer bedingten Haft- sowie zu einer erheblichen Geldstrafe verurteilt wurde. Dieses offenbar milde Urteil, wie die Richterin mehrmals betonte, ließ in ihrem Leben keinen Stein auf dem anderen, da zu guter Letzt die Versicherung die Deckung des gravierenden Schadens bei Dagmar einforderte. Die Summe von 430.000 Euro, die dem Schmerzensgeld, den Heilungs- und Therapiekosten sowie der Entschädigung für das beschädigte Fahrzeug geschuldet waren und die sie nicht im Entferntesten bezahlen konnte, wurden ihr seither in regelmäßigen Abständen schwarz auf weiß in einem amtlichen Schreiben präsentiert.
Sie legt das in einem nüchternen Amtsdeutsch aufgesetzte Schreiben weg. Kein Vorwurf, kein Tadel, lediglich die Aufforderung, binnen einer vorgegebenen Frist einen Teilbetrag der angeführten Summe zu begleichen, die offensichtlich mittlerweile schon auf 436.000 angewachsen ist.
Dagmar geht nur in Unterwäsche bekleidet zur Maschine und lässt sich eine Tasse starken Kaffee herunter. Sie zündet sich eine Zigarette an und zieht ein paarmal intensiv daran. Dann holt sie ihre Handtasche und lässt sich auf das Bett fallen. Als sie sie auf den Kopf stellt, fallen mehrere zerknüllte Hunderteuroscheine sowie ein Fünfhunderteuroschein heraus. Während sie jeden Schein zwischen ihren Fingern glatt streift, zählt sie die Summe zusammen. Anschließend holt sie den Brief von dem Amtsgericht, Abteilung für Exekutionen, und liest ihn laut vor. Von dem jedes Mal gleichlautenden Text interessiert sie neben der Höhe der Summe nur die Zeile mit dem Datum für die Fälligkeit der nächsten Rate. „Zehnter November“, hört sie sich sagen. In sechs Wochen wäre also die nächste Rate von siebentausend Euro fällig.
Gedankenvoll legt sie das Schreiben zur Seite. Sie schlendert ins Badezimmer, dreht den Hahn der Dusche auf und lässt ihn warmlaufen. Dann geht sie an Peters Schreibtisch, wo sie ein Blatt aus seinem Schulblock reißt und schreibt: „Konnte den Dienst heute Abend leider doch nicht verschieben. Meine Kollegin ist krank. Mach Paul und Marie eine Pizza, nimm die Wäsche aus dem Trockner und schau, dass die beiden früher zu Bett gehen! Mama.“