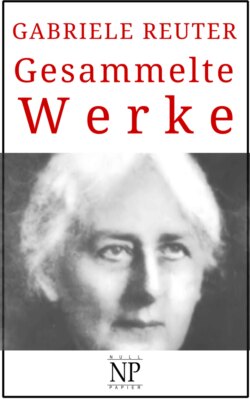Читать книгу Gabriele Reuter – Gesammelte Werke - Gabriele Reuter - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V.
ОглавлениеEs schien doch, als ob Agathe mit der Zeit vernünftiger geworden war. Sie bekam keinen Blutsturz. Sie meinte nicht einmal, dass nun jede Hoffnung für ihre Zukunft am Ende wäre, sondern biss die Zähne aufeinander und dachte: »Dann also Dürnheim!«
Mehr denn je verwandte sie Zeit und Interesse auf die Pflege ihres Körpers und auf ihren Anzug.
Wie hatte Onkel Gustavs geschiedene Frau es möglich gemacht, dass der Majoratsherr sie geheiratet? Jung war sie doch nicht mehr gewesen – gewiss älter als Agathe und von schlechtem Ruf noch dazu. Die Tochter eines Gesindevermieters. Was zog die Männer zu ihr? Nicht etwa Abenteurer, sondern gute, anständige Männer wie Onkel Gustav, und vornehme Konservative wie den Majoratsherrn, ihren zweiten Gatten? Agathe begann zu entdecken, dass in diesen Dingen andere Kräfte im Spiel waren, als ihre Erzieher ihr gelehrt hatten. Sie wäre sich gern darüber klar geworden, um ihren Entschluss zu treffen, ob sie sie anwenden wollte und konnte oder nicht.
Immer war sie stolz daraus gewesen, zu sein, was sie schien: ein unschuldiges, unwissendes junges Mädchen. In den letzten Jahren hatte das Christentum noch eine festere, strengere Mauer um sie gezogen, als um ihre Freundinnen. Sie hatte nichts hören wollen von den Dingen dieser Welt, sondern den Himmel gewinnen, eindringen in die dornenumzäunte Pforte zu der unaussprechlichen Ruhe der Kinder Gottes.
Seit Raikendorf sie beinahe geküsst hatte, träumte sie nur noch von diesem Kuss – nicht mehr von ihm, von seiner Persönlichkeit, sondern einzig von dem Kuss, den sie schon zu fühlen meinte und der ihr dann in Luft verhauchte. Er war ihr letzter Gedanke beim Einschlafen, ihr erster beim Erwachen.
Dabei verschwand ihr der Glaube an Gott fast vollständig. Der Heiland, den sie so innig zu lieben sich bestrebt hatte, war ihr fremd und gleichgültig geworden. Sie zweifelte nicht – die religiösen Empfindungen und Vorstellungen verloren nur mehr und mehr die Macht, sie zu beeinflussen. Sie wandte sich mit einem stillen Widerwillen von ihnen ab.
Ein Durst nach Verstehen dessen, was um sie her vorging, war an ihre Stelle getreten.
Agathe wurde immer lebhafter in ihrem Wesen, sie sprach und lachte so viel wie niemals zuvor. Ihre Augen verloren den tiefen, schwärmerischen Ausdruck und richteten sich bestimmt auf Dinge und Menschen.
Mit Eifer und Vergnügen begann sie Romane zu lesen – solche, die man jungen Mädchen nicht erlaubt, und die sie verbarg, sobald jemand kam. Zu ihrem Erstaunen bemerkte sie, dass ihre Mutter die Bücher auch gern las, obgleich sie darüber schalt und nicht begriff, wie Menschen so unsinniges Zeug zusammenschreiben konnten.
War in Gesellschaft von einem der Bücher die Rede, und wurde Agathe gefragt, ob sie es gelesen, so antwortete sie, ohne zu erröten: »Nein, ich denke, das kann man nicht.«
Die Herren ihrer Bekanntschaft setzten ihr dann auseinander, dass mancher der Dichtungen ein gewisser Wert nicht abzusprechen sei. Aber sollten sie sich vorstellen, dass sie mit einer jungen Dame verkehren müssten, die dergleichen gelesen hätte – nein, das würde ihnen außerordentlich peinlich sein.
Zuweilen dachte Agathe: wenn sie noch heiratete, so könne es nun nimmermehr eine ideale Ehe für sie werden. So vieles, was ihr schon durch den Kopf gegangen, durfte sie keinem Manne je gestehen. Und eine wahre Ehe war nicht möglich ohne völliges, gegenseitiges Vertrauen. Also bemühte sie sich kaum noch um des Zieles willen, sondern nur, weil eine innere Unruhe sie antrieb, immerfort nach Liebe und Bewunderung zu suchen.
Nur einmal geküsst werden, das war eine fixe Idee.
Musste es denn eine regelrechte Verlobung sein? Es waren doch auch andere Küsse denkbar? Ja – denkbar schon … denkbar! Aber die Gewohnheit eines ganzen Lebens deckte Agathe mit einem festen Schilde. Sie träumte die leidenschaftlichsten Abenteuer … und blieb doch nach außen das vornehme, zurückhaltende Mädchen. Nicht aus Heuchelei. Sie konnte nicht anders – wenn sie auch wollte. Sie spielte mit der Gefahr, nach der sie sich sehnte, bis sie vor der leisesten physischen Annäherung eines Mannes instinktiv zurückschauerte.
Nicht in keuscher Unschuld – denn sie war kein Kind mehr – sie war erwacht, ein reifes, temperamentvolles Weib. Ihr Fantasie- und Gefühlsleben war nicht mehr unschuldig. Es war nur ein fortwährender Streit zwischen ihrer individuellen Natur und dem Wesen, zu dem sie sich in liebendem Eifer nach einem ehrwürdigen, jahrtausende alten Ideal gemodelt hatte. Und es war wilder, scheuer Hochmut in ihr: Sich selbst – diese gehütete Kostbarkeit, einem Manne geben, der nur Talmi verlangte? Und der sie, Agathe Heidling, dann sein Leben lang für Talmi halten durfte?
Die Eltern freuten sich, dass Agathe sich die Enttäuschung so wenig zu Herzen nahm. Sie tanzte im nächsten Winter, so viel es ging, lockte mehrere junge Leute auch an, bei Heidlings Besuch zu machen. Man sagte ihr Schmeicheleien, wie sie sich konserviere – bei Abend könne man sie gut noch für ein ganz junges Mädchen halten. Nur liebenswürdiger sei sie als früher.
Dürnheim besann sich zwei Winter hindurch, ob er nicht vielleicht anhalten sollte – sein Vetter Raikendorf hatte ihn zwar gewarnt schließlich feierte er dann doch seine Hochzeit mit der kleinen Romme. Sie bekam dreißigtausend Taler bar mit in die Ehe, wusste Onkel Gustav.
Zwei Winter hatte Agathe mit erlahmenden Kräften gekämpft – nicht gerade um Dürnheim allein – um jede neue Männererscheinung – um einen Blick – um ein Lächeln. Und die heimlichen Niederlagen, von denen nur sie selbst wusste! Die Reue – die Scham – die Langeweile – zuletzt mehr und mehr ein Gefühl, als habe sie sich selbst verloren und schwanke – eine welkende Form ohne Inhalt, ohne Seele – durch der Erscheinungen Flucht.