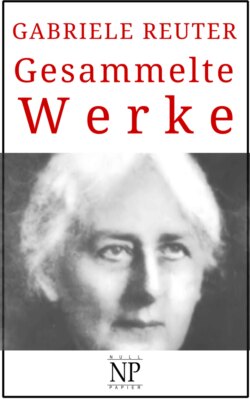Читать книгу Gabriele Reuter – Gesammelte Werke - Gabriele Reuter - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIV.
Оглавление»Die Mädchen mit Talent sind doch zu beneiden«, klagte Agathe ihrem Vetter. »Jedermann findet begreiflich, dass sie es ausbilden. Sogar die arme steife Frau von Henning hat ihre Tochter nach Paris gehen lassen. Fragt mich mein Vater, was in aller Welt ich in Zürich tun will – ich habe eigentlich keine Antwort. Und wer weiß, ob ich mich dort nicht noch überflüssiger fühle als zu Haus. Zwar – es ist schon wunderschön, einmal sein eigener Herr zu sein!«
»Das wollt’ ich meinen«, rief Greffinger und lachte herzlich.
Agathe war ungefähr in der Stimmung, in der sie als Kind auf den Ketten am Kasernenplatz gesessen und mit den Beinen gebaumelt hatte – ein wenig ängstlich, ein wenig beklommen, aber doch so heimlich frech und froh.
Sie saß neben Martin auf dem Deck des Dampfers. Durch das blau aufschäumende Gewässer rauschte ihr Fahrzeug dem jenseitigen Seeufer entgegen.
Agathe wollte mit ihrem Vetter das Hörnli besteigen. Man sollte von dem Felsplateau schon auf mäßiger Höhe einen herrlichen Rundblick genießen. Längst war die Partie geplant. Aber mit Papa und Martin und Gerichtsrats – nein. von der Zusammensetzung versprach Agathe sich nicht viel Vergnügen.
Nun hatte Papa einen zweitägigen Ausflug mit dem Professor und ein paar anderen Herren unternommen. Martin lockte Agathe auf ihrem Morgenspaziergang weiter und weiter, bis zum Ufer. Dort lag der Dampfer bereit. Und Agathe hatte ihm selbst den Vorschlag gemacht, mit ihr hinüber zu fahren.
»Du fängst ja schon an. Dich zu emanzipieren«, rief er fröhlich.
Agathe bedauerte, dass das Dampfschiff nicht gleich bis nach Zürich fuhr. Heut wäre es ihr leicht geworden, ihrer ganzen Vergangenheit, Vater und Freunden und solidem Ruf und allem Lebewohl zu sagen.
Sie waren beide sehr vergnügt und schwatzten lustige Torheiten. Martin richtete die verfängliche Frage an Agathe, warum sie nicht geheiratet – sie hätte doch gewiss viel Körbe ausgeteilt. Agathe schüttelte den Kopf. – Sie wäre gewiss immer zu abweisend gegen die Männer gewesen? Er erzählte ihr von einem Gymnasiasten, der sich die Buchstaben A. H. mit einer Stecknadel und blauer Tinte auf die Brust tätowiert habe. Agathe plagte ihn um den Namen. Er verriet ihn nicht, fügte nur hinzu: »Ich war es aber nicht.«
Agathe glaubte doch, dass er es gewesen.
Martin versprach ihr, wenn sie auf dem Hörnli wären, sollte sie Asti zu trinken bekommen. Er betrug sich heut überhaupt recht wie ein junger Mann, dem der Kopf voll Tollheiten steckt. Obenauf dem Hörnli schrieb er ins Fremdenbuch des Gasthauses: Mark Anton Grausiger, Wäschefabrikant und Gattin. Darüber geriet Agathe ins Kichern wie ein Schulmädchen.
Vor ihnen lag in Totenstille und Mittagsduft die Kette der schneebedeckten Gebirge, der ungeheuren Felsenmassen, deren Farben im Lichtglanz aufgelöst waren. Tief im Tal reckten dunkle Wälder sich zum Wasser nieder, und in fahlem Blau schlummerte der glatte See. Nussbäume gaben Schatten über ihren Köpfen, und die Waldrebe kletterte an den Stämmen empor, rankte ihre zierlichen Klammerzweige mit den weißen Blüten von Ast zu Ast. Aus einem dunklen Gestrüpp von Lärchen und Tannen, durch das der Weg sich emporwand, hauchte es zuweilen wie ein kühler, duftender Atemzug über sie hin. Dort blühten Alpenveilchen im Moose.
Es war heiß, und sie wurden müde und schweigsam im Ruhen und Schauen. Martin hatte den Hut abgenommen, sein Gesicht glühte, und er trocknete sich die Stirn mit dem Tuch.
Eine kleine Kellnerin brachte ihnen das Essen und bediente sie. Das frische Ding, rund, weiß und rot wie ein Borsdorfer Äpfelchen, war appetitlich anzusehen in ihrem schwarzen Sammetmieder und der hellen Schürze. Agathe und Martin beobachteten, dass ein plumper, fettglänzender Mann mit einem großen Siegelring am Zeigefinger, der seine Mahlzeit schon beendet hatte, die niedliche Kleine zu sich winkte, einen Stuhl herbeizog und sie zudringlich nötigte, sich neben ihn zu setzen und ein Glas Wein mit ihm zu trinken.
Sie antwortete ungeduldig; man konnte sehen, es war nicht das erste Mal, dass sie sich gegen ihn zu wehren hatte. Er versuchte, sie am Rocke festzuhalten, sie befreite sich unwirsch, schalt derb auf ihn ein und lief davon.
Agathe wandte die Blicke ab. Die Natur und ihre eigene frohe Stimmung waren ihr entweiht.
»Dem Kerl möcht’ ich die Wahrheit sagen«, grollte Martin zornig. »Was solch armes Mädel zu ertragen hat!«
Der dicke alte Philister ging, nachdem sein Versuch, einmal über die Stränge zu schlagen, missglückt war, verdrießlich schnaufend fort.
Wie schön! Nun waren sie allein und konnten unbefangen schwatzen.
Agathe hörte es gern, wenn Martin in Eifer geriet und ihr auseinandersetzte: sie müsse vor allen Dingen das Leben kennen lernen, wie es wirklich sei, nicht wie es wohlerzogenen Regierungsratstöchtern vorgemalt werde. Dann würde das Interesse an dem vielgestaltigen, grausig mächtigen und herrlichen Ungeheuer so stark in ihr werden, dass sie es wieder lieben lerne in seinen Abgründen und Tiefen und schroffen, schrecklichen Höhen, und dass sie gesund und froh werden würde an der Luft der Erkenntnis.
»Bist Du nicht weitergekommen in diesen vierzehn Tagen?« fragte er. »Haben wir nicht schöne Stunden miteinander gehabt? War das nicht besser, als Deine Gesellschaften und Deine Referendare und Lieutenants?«
Agathe bejahte mit einem tiefen, leuchtenden Blick ihrer braunen Augen.
Herrlich sprach er! Welch ein Glück, dass sie ihn wiedergefunden! Es war ja schon fast am Ende gewesen mit ihr. Diese elende, in lauter kleine Leiden und Sorgen und unnötige Arbeiten zerfaserte Existenz der letzten Jahre.
Sie sprach ihm davon. Nie hätte sie geglaubt, so offen reden zu können, und mit einem Manne noch dazu – einem jungen Manne. Aber hier war nicht mehr Mann und Mädchen, hier waren zwei gute Kameraden, die einander helfen wollten in Treue und redlicher Gesinnung.
»Was Du mir sagst, ist sehr interessant, Agathe«, rief Martin. »Schreibe es auf mit denselben Worten, wie Du es mir eben erzählt hast.«
»Ach, Martin, ich bin ja keine Schriftstellerin.«
»Ich meine nicht, dass Du damit ein Kunstwerk schaffen wirst. Das ist nur die Sache von ein paar Begnadeten.«
Er sprach langsam weiter.
»Ich weiß überhaupt nicht, ob es heute darauf ankommt, Kunstwerke zu schaffen … Wir leben alle so sehr im Kampf! – – Kümmere Dich nicht um die Form! Sag’ Deinen lieben Mitschwestern nur ehrlich und deutlich, wie ihr Leben in Wahrheit beschaffen ist. Vielleicht bekommen sie dann Mut, es selbst in die Hand zu nehmen, statt sich von ihren Eltern und der Gesellschaft vorschreiben zu lassen, wie sie leben sollen, und dabei kranke, traurige, hysterische Frauenzimmer zu werden, die man mit dreißig Jahren am liebsten alle miteinander totschlüge! – Na – lockt Dich das nicht? mitzuarbeiten für das Recht der Persönlichkeit? – Komm, stoß an – es lebe die Freiheit!«
Er rief es mit starker Stimme. Sein sonnenverbranntes Gesicht strahlte in freudiger Bewegung. Agathe hob ihr Glas ihm entgegen. Ein feiner, schriller Klang zitterte durch die Mittagsstille. Dem Mädchen war es, als höre sie im Nachhall ihr eigen Herz und ihre Nerven klingen, so gespannt war alles in ihr zu begeisterter Hingabe an das Werk, das er ihr zeigte.
Langsam schlürfte Greffinger den hellen Wein. Agathe sah halb unbewusst, dass sein Blick über das Glas hinweg auf die kleine Kellnerin ging, die sich nicht weit von ihnen mit einer Häkelarbeit beschäftigte. Sie nahm es wahr, während ihre Gedanken ganz erfüllt waren von dem Neuen, das in ihr zu wirken begann. Sie stützte den Kopf in die Hand und schaute nach der großen Tiefe, die zum See hinunterging. Schweigend versenkte sie sich in dieses Neue, das ihrer Zukunft etwas Werdendes versprach.
Etwas Werdendes – –! Darin lag die Befreiung. – – Darum hatte das Zusammenleben mit den Eltern sie so unglücklich gemacht, trotz aller Liebe und aller Pflichttreue: es war ohne Hoffnung. Sie sah nichts als Absterben um sich her. Sie war mit frischen Kräften und jungen Säften angeschmiedet worden an Existenzen, die schon Blüte und Frucht getragen hatten und nur noch in Erinnerungen an die Zeit ihrer Wirkungshöhe lebten. Und mit den Erinnerungen, die sie eigentlich gar nichts angingen – mit den Errungenschaften der vorigen Generation hatte sie sich begnügen sollen.
Etwas Werdendes … Ein Kind – oder ein Werk – meinetwegen ein Wahn, jedenfalls etwas, das Erwartungen erregt und Freude verspricht, mit dem man der Zukunft etwas zu schenken hofft – das braucht der Mensch, und das braucht darum auch die Frau!
Agathe war ganz stolz und glücklich, als sie aus dunklen Empfindungen endlich diesen Kern entwirrt hatte. Sie musste ihn Martin mitteilen und wendete sich ihm wieder zu.
Er sah es nicht …
Was war denn vorgegangen?
Er blickte noch immer nach der Kellnerin. Waren das seine Augen, in die sie eben noch geschaut wie in zwei klare Sterne, von denen ihr die Verkündigung einer stolzen, hohen Botschaft kam?
War sie denn verrückt geworden, dass sie Martin plötzlich verwandelt sah? Dem widerlichen Kerl, nach dessen Verschwinden sie aufgeatmet hatte – dem sah er ähnlich … Die halbgeschlossenen, blinzelnden Lider, aus denen ein grünliches Licht nach dem Mädchen drüben züngelte … Das Lächeln um die Lippen – sie sprachen kein Wort – sie lockten und baten doch …
Und – er hatte mehr Glück als der Alte. Lautlos war, während sie abgewendet gegrübelt hatte, eine Verbindung hergestellt zwischen ihm und dem jungen Dinge.
Sie störte die hin- und widerflirrende Werbung.
Martin schenkte sich ein und schwenkte sein Glas mit offener Huldigung gegen die Kleine. »Fräulein!« rief er und trank es leer bis auf den letzten Tropfen.
Dann beugte er sich zu Agathe und flüsterte zutraulich:
»Reizendes Mädel – findest Du nicht?«
Ihr Mund verzog sich seltsam.
Er beachtete es nicht, sondern begann sich mit der kleinen Schweizerin zu unterhalten. Fröhliches, dummes, harmloses Zeug, aber es war ein Unterton in seiner Stimme, den Agathe kannte – aus einer lange entschwundenen Zeit.
Als sie aufstand, um zu gehen, wunderte sie sich, dass die Sonne noch schien.
*
Wollte Martin sie nur auf die Probe stellen? – Sich überwinden – ihn ihre ungeheure Enttäuschung und Kränkung nicht fühlen lassen! Aber alle Selbstbeherrschung war plötzlich von ihr gewichen.
Er war ihr widerwärtig geworden, aber noch, widerwärtiger war sie sich selbst. Was hatte sie an einem solchen Manne finden können? Wie war sie zu der Verirrung gekommen, ihn für groß und bedeutend zu halten?
Und warum riss ein so grausamer Schmerz an ihrem Herzen?
Sie quälte sich und ihn mit finsterer Kälte.
Am Abend nach dem Essen forderte Martin sie auf, noch ein Stück mit ihm spazieren zu gehen.
»Hier können wir doch kein Wort sprechen«, fügte er mit einem Blick auf die Gerichtsrätin und ihre Tochter hinzu.
Agathe verstand, dass es ihm um eine Aussprache zu tun sei. Und sie empfand auch deutlich, dass es für sie geratener sei, ihn heute zu meiden.
Aber trotzdem stand sie auf und nahm ihren Shawl von dem Haken an der Wand.
»Wo gehen Sie hin, Fräulein Agathe?« fragte die Rätin.
»Ich will mit meinem Vetter ein Stück spazieren gehen.«
»Jetzt?« fragte die Rätin erstaunt. »Aber Sie waren ja heute schon auf dem Hörnli! Und es ist schon ganz dunkel!«
»Was schadet das?«
»Es ist schon neun Uhr vorüber!«
»In einer halben Stunde bringe ich meine Cousine unversehrt zurück«, sagte Martin in einem gleichgültigen, höhnischen Ton.
Er ging voran, es Agathe überlassend, ihm zu folgen. Er wusste ja, dass sie ihm folgen würde. Sie tat es, obwohl es ihr schien, als handele sie vollständig wie eine, die ihrer gesunden Sinne nicht mehr mächtig ist.
Was die Rätin und ihre Tochter und die Wirtin und die Kellner von ihr denken mussten, wenn sie mit einem jungen Mann in die Nacht hinausging, das war ja klar.
Es war auch zu seltsam, dass die Gerichtsrätin kein Wort weiter äußerte. Wahrscheinlich war sie zu erstarrt über das unerhörte Vorhaben eines jungen Mädchens.
Warum ging sie nur und trottete mit gesenktem Kopf und einem unerträglichen Zittern in den Knien hinter Martin her, der sich nicht einmal nach ihr umwandte? Es war ihm jedenfalls gleichgültig, ob sie auf dem steinigen Wege Schaden nahm.
Ihnen zur Seite brauste in tiefem Bett der Gebirgsbach, von den Gewittergüssen der letzten Wochen angeschwollen, große Äste und losgerissene Sträucher in seinen tobenden Strudeln mit sich reißend. Wolkenmassen standen schon wieder am Himmel. Es war so finster, dass man unter den Bäumen, die ihre Zweige über den Weg bogen, nicht einen Schritt weit sehen konnte.
Betäubt von dem wilden Toben des Wassers, das aus der Dunkelheit kalte Dünste in die schwüle Nacht emporsandte, mit bohrenden Schmerzen im Kopf und über den Augen – mit Aufruhr und Elend in der Brust, setzte sie ihren Weg fort.
Warum war sie ihm gefolgt? Warum nur?
Sie hätte sich von rückwärts auf ihn werfen mögen, auf den dunklen Umriss seiner Gestalt, und ihn packen und hineinzerren in das wilde Wasser, von dem er vor ein paar Tagen sagte: »Wer da hineinspringt, den hole ich nicht wieder!«
Und sie lächelte mit einer grausamen Lust an der Vorstellung, dass er seine Arme so herausstrecken würde, wie die dürren Äste aus den Strudeln ragten … Dabei fühlte sie, dass es schon kein Lächeln mehr war, sondern eine Grimasse, die ihre Züge verzerrte. Wie entsetzt er sein würde, wenn er sich jetzt umblickte und das Wetterleuchten ihm ihr Gesicht zeigte …
Aber er blickte nicht zurück.
Einmal sagte er: »Halt’ Dich rechts, sonst fällst Du in den Bach.«
Pfui, wie herzlos, wie grausam er war. Wie sie ihn verabscheute!
Sie hatten nicht sehr weit zu gehen, bis sie an eine Brücke kamen, die ohne Geländer über den Bach führte. Martin überschritt sie und trat in den Hof einer ländlichen Wirtschaft, die von Fremden niemals besucht wurde, für die er allein eine Vorliebe besaß. An einem großen Baum hatte man eine Stalllaterne befestigt. Sie warf einen kargen Lichtkreis auf den Tisch und die zwei Bänke. Über ihr glänzten die Blätter in einem harten, metallischen Grün, ringsumher war Dunkelheit. Das laute Lärmen des Wassers trennte den Ort von der übrigen Welt und erregte den Eindruck, als befände man sich auf einer Insel mitten in einer wilden, brausenden Flut.
»Hier sind wir ungestört«, sagte Martin.
Der Wirt erschien in Pantoffeln, verschlafen, und stellte zwei Gläser Bier vor sie hin.
»Geh’n Sie nur. Wir rufen schon, wenn wir etwas brauchen.«
Agathe hatte sich niedergesetzt. Sie stützte den Kopf in die Hand und starrte vor sich auf das graue Holz des Tisches. Schweigend nahm sie Martins Vorwürfe hin.
Für so klein und sentimental und weibisch eitel, wie sie sich heut gezeigt, habe er sie nicht gehalten. Er wollte sie für die Freiheit gewinnen. Aber er werde sich nicht unter die Tyrannei eines prüden und törichten Frauenzimmers beugen.
Was habe sein Gefallen an dem hübschen, frischen Schweizermädchen mit ihrer Freundschaft zu tun? Wenn sie sich einbilde, dass er in Zukunft auf den Verkehr mit hübschen jungen Mädchen verzichten solle, dann habe sie das Gefühl, das ihn zu ihr gezogen, gründlich missverstanden, darüber müssten sie sich erst auseinandersetzen.
Er wurde endlich von Agathes Schluchzen unterbrochen.
»Höre auf zu weinen, Du beträgst Dich sehr kindisch«, sagte er hart.
Es war fast nicht mehr weinen zu nennen, langgezogene, röchelnde Schreie drangen aus ihrer Brust und verloren sich im Brausen des Wassers.
Sie sprang auf, warf den Kopf zurück und rang wild die Hände, wie in Erstickungsnot und Todeskampf.
Martin begann sich um sie zu ängstigen.
»Also gehen wir nach Haus! Vielleicht kann man morgen vernünftig mit Dir reden. Warum in aller Welt bist Du nur so außer Dir?«
»Weil ich Dich liebe!« schrie sie ihn gellend an. Sie wusste ihm in dem Augenblick keine größere Beleidigung entgegenzuschleudern. Und fort war sie – wie der Blitz hinausgeschossen in Nacht und Dunkelheit.
Über die Brücke jagte sie, dem Lauf des Baches folgend –
»Zum See – zum See …« Das war der einzige Gedanke, der in ihr tobte, in ihren Pulsen hämmerte, in ihrem Atem keuchte.
»Ich will frei sein – frei sein! Von ihm – von ihm –«
Ein lautes Auflachen …
Zitternd blieb sie stehen und lauschte … War sie es selbst gewesen?
Sie wagte sich keinen Schritt weiter in der fürchterlichen, einsamen Finsternis. War jemand hinter ihr? Die Zähne schlugen ihr klirrend aufeinander vor Entsetzen.
Sie hatte vergessen, dass sie den See erreichen wollte.
Dicht neben ihr war das rasende Wasser – so tief stürzten die Ufer ab – so tief …
Das Keuchen und Arbeiten in ihrer Brust, das Sausen und Läuten in ihrem Kopfe ließ nach. Sie war totmüde. Ihre Augen schlossen sich – fast verging ihr die Besinnung.
Nur eine Bewegung …
»Mama … meine liebe Mama …« lallte sie, streckte die Arme aus und beugte sich vornüber.
Ein Wetterstrahl fuhr blendend nieder. Sie riss die Augen auf, sah die durcheinandertobenden Strudel unter sich von fahlem Licht erhellt und fuhr zurück. Schreckendurchschüttelt stand sie atemlos, starrte in die Nacht und hörte das Sprachen des Donners.
Sie durfte ja nicht – sie durfte ja nicht … für Papa sorgen – sie hatte es doch versprochen … Sie durfte nicht entfliehen. Mama hatte sie gerufen …
Ihre Knie schwankten, sie fühlte, dass sie umfallen musste und ließ sich haltlos zu Boden sinken. So lag sie zusammengekauert und ließ sich vom Brausen des Wassers betäuben. Allerlei sinnloses Zeug ging ihr durch den Kopf – sie wusste nicht wie lange.
Endlich erhob sie sich und schlich durch die Nacht zurück. Jetzt hatte sie Angst, sich zu verirren, und besann sich mit Anstrengung auf die Richtung, die sie einzuschlagen hatte. Und dann lief sie, so schnell sie konnte.
Schaudernd vor innerer Kälte, das Gesicht von Schweiß und Tränen bedeckt, stand sie vor der Tür des Hotels still.
Leise öffnete sie und floh durch den Hausflur die Treppe hinauf.
Da auf dem ersten Treppenabsatz traf sie Martin.
»Agathe, wie konntest Du!« rief er ihr entgegen. »Seit einer Stunde laufe ich in der Dunkelheit herum und suche Dich! Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt!«
Sie schleppte sich abgewendet an ihm vorüber und riegelte sich in ihrem Zimmer ein.
So hatte Agathes Ausflug in die Freiheit ein Ende genommen.