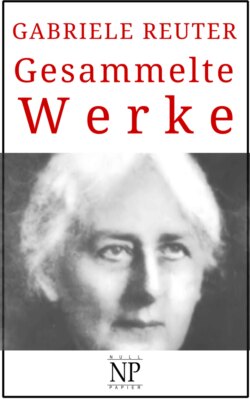Читать книгу Gabriele Reuter – Gesammelte Werke - Gabriele Reuter - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XV.
ОглавлениеFrau Lieutenant Heidling wurde durch ein Telegramm ihres Schwiegervaters nach der Schweiz berufen. Der Regierungsrat empfing sie unten am See bei der Dampferstation.
»Mein Gott, Papa – was ist denn geschehn?«
»Ja – die arme Agathe …« Der alte Herr blickte seine Schwiegertochter verstört und bekümmert an. »Kannst Du Dir das vorstellen – den ganzen Tag sitzt sie und weint – aber den ganzen Tag! Und will man sie beruhigen, dann gerät sie in eine Heftigkeit – ich habe gar nicht geglaubt, dass sie so zornig werden könnte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das Mädchen behandeln soll. Ich. bin ganz am Ende mit meiner Klugheit … Mit Martin, für den sie doch eine entschiedene Vorliebe zeigte, hat sie sich auch überworfen – jedenfalls – denn er ist plötzlich abgereist.«
Der Regierungsrat ergriff Eugenies Hände, die Tränen liefen ihm in den Bart.
»Sei mir nicht böse … die weite Reise … Ich dachte, wenn Du – Ihr seid doch immer so gute Freundinnen gewesen. Wenn Du mal mit ihr sprächest! Es muss etwas … Du hast ja keine Ahnung, wie das arme Kind aussieht.«
»Na ja, Papachen, das wollen wir schon machen. In der Familie bringt man ja gern Opfer. Das überlass mir nur alles. Ich will Agathe schon wieder zur Raison bringen.«
Als Agathe ihre Schwägerin erblickte, verfiel sie in einen Weinkrampf.
Der Regierungsrat lief nach einem Doktor. Und der Doktor erklärte: die Patientin wäre sehr nervös und auch sehr bleichsüchtig. Die Bleichsucht käme von der Nervenüberreizung, und die Nervenüberreizung habe ihren Grund in der Blutarmut. Es müsse etwas für die Nerven geschehen und etwas für die Bleichsucht – übrigens würde ein bisschen Stahl die Sache schon wieder in Ordnung bringen.
»Weißt Du, Papa«, sagte Eugenie, »ich soll auch ein bisschen Stahl trinken – da nehme ich Agathe mit nach Röhren – das wird jetzt so sehr gerühmt. Lisbeth Wendhagen ist auch dort – es soll von einem vorzüglichen Arzt geleitet werden. Dann lasse ich Wölfchen hinkommen, der Junge sieht nach dem Scharlach immer noch so mieserig aus. Und wir amüsieren uns himmlisch miteinander! – Gott – der Mensch hat immer mal so Zeiten, wo ihm alles nicht recht ist, und Agathe hat sich wirklich sehr angestrengt. Überlasse sie mir nur ganz unbesorgt.«
Der Regierungsrat küsste Eugenien in warmer Dankbarkeit die Hand. Wie klug und praktisch sie war. Er sah schon nicht mehr so schwarz … es würde ja alles wieder werden!
»Ich will nicht mit Eugenie! Ich will nicht! Lass mich hier allein, Papa – ganz mutterseelenallein«, flehte Agathe ihren Vater an. »Du sollst sehn, dann werde ich vernünftig! Ich habe nur eine solche Sehnsucht, einmal ganz allein zu sein – gar nicht sprechen zu brauchen – und gar keine Stimmen zu hören. Ich kann Eure Stimmen nicht mehr vertragen – das ist die ganze Geschichte. Ich will nicht zu einem Doktor.«
Eugenie und Papa blickten sich bedeutungsvoll an. Der Regierungsrat seufzte tief.
»Kranke haben keinen Willen«, sagte Eugenie energisch und packte die Koffer.
Agathe sah die junge Frau in ihren Sachen herumwühlen, ihre Schachteln öffnen, in ihrer Briefmappe blättern, als sei sie schon eine Gestorbene, auf die man keine Rücksicht mehr zu nehmen braucht.
Und dann doch wieder das beständige Geplauder, um sie aufzuheitern – zu zerstreuen. Oder Eugenie suchte durch geschickte Fragen zu ergründen, ob etwas zwischen ihr und Martin vorgefallen sei.
… Vielleicht hatte sie schon hinter Agathes Rücken an Martin geschrieben, und er würde alles verraten … Und Eugenie erfuhr ihre Schmach – den heimlichen Jammer, der sie zu Grunde richtete …
Sie wollte ja leben, sie wollte ja ihre Pflicht tun – aber man musste sie nicht so furchtbar peinigen. Schon in gesunden Zeiten hatte Eugenies leichte, sichere, selbstgefällige Art sie maßlos irritiert – und nun sollte sie, totmüde und aufgerieben, wie sie war, wochenlang Tag und Nacht mit ihr zusammen sein? Sich von ihr beaufsichtigen und ausforschen lassen? Das war gar nicht auszudenken!
Und Papa nahm keine Vernunft an.
Sie konnte ihm doch nicht sagen, dass sie Eugenie verabscheute? Wenn er fragen würde warum? Sie wusste ja keinen Grund dafür.
Aber sie hatte selbst Schuld – sie allein.
Sie wollte nun alles tragen, als eine Strafe von Gott, für das wahnsinnige Verlangen nach Glück.
Wie Er sich wohl freute, dass Er sie so marterte …
Anständigen Mädchen kamen gewiss keine blasphemischen Gedanken … Anständige Mädchen sind nicht mit dreißig Jahren noch eifersüchtig auf eine Kellnerin …
Anständige Mädchen – betragen sich die so, wie sie sich betragen hatte? Was war denn nur mit ihr?
Sie ist gar kein anständiges Mädchen. Sie hat nur geheuchelt, Zeit ihres Lebens. Aus Feigheit geheuchelt. Und wenn es schließlich doch vergessen wird … Ach, der arme Papa – so ein tadelloser Ehrenmann … wenn es sich zeigt, was seine Tochter für ein Geschöpf ist …
Nur alles über sich ergehen lassen … Sich mit aller Gewalt zusammennehmen – ruhig sein – keine Szenen mehr machen! Dann muss der Doktor sie doch für gesund erklären. Darauf kommt jetzt alles an.
Mit einer wahren Verzweiflung klammerte Agathes geängstigte Seele sich an die Konsultation des Badearztes in Röhren. Er musste sie heimschicken – ganz gewiss.
Aber als sie ankamen, verordnete er ihr gleich eine sechswöchige Kur.
Ob sie nicht allein hier bleiben dürfe?
Nein – dazu wäre sie viel zu schwach; ihre Schwägerin müsse sie pflegen und zerstreuen. Ein Glück, dass sie so eine heitere, liebenswürdige Schwägerin bei sich habe.
*
Auf einer grünen baumlosen Hochebene lag das Frauenbad. Sein Kurhaus und die Wohnung des Arztes bildeten den Mittelpunkt, von hier aus streckte sich eine einzige lange Straße von weinumrankten Logierhäusern in die Wiesen hinaus. An ihrem Ende drängten sich die verfallenen Hütten der einheimischen Bevölkerung. Dort saßen hagere Frauen und hustende Mädchen Tag aus, Tag ein über das Klöppelbrett gebeugt und warfen die kleinen Holzpflöcke mit fieberhafter Eile durch das zarte und kostbare Spitzengewebe, das unter ihren Fingern entstand. Von der scharfen reinen Luft drang nur wenig durch die mit Papier verklebten Fensterlöcher. Dass man etwas anderes trinken könne als Zichorienkaffee, dass man sich baden könne, sahen sie wohl, aber sie sahen es wie fremde, unverständliche Gebräuche. Die Milch der Ziegen gehörte den Fremden – die Stahlquellen – die Fichtennadel und Moorbäder waren für die Fremden. Von den Einheimischen bemerkte man wenig, man erblickte nur die fremden weiblichen Gäste. In den Lauben der dürftigen Gärten, wo ein paar Kohlköpfe und eine Reihe Immortellen wuchsen, saßen sie beieinander. Sie standen gruppenweise in der Dorfstraße und klagten sich ihre Leiden. Über die weiten Wiesenflächen konnte man ihre Gestalten verfolgen, wie sie einzeln oder zu zweien die Raine entlang wanderten, kleine Sträußlein von Gräsern und blassen Skabiosen sammelnd als sinnige Gabe für die Freundinnen oder den Doktor.
Frauen – Frauen – nichts als Frauen. Zu Hunderten strömten sie aus allen Teilen des Vaterlandes hier bei den Stahlquellen zusammen, als sei die Fülle von Blut und Eisen, mit der das Deutsche Reich zu machtvoller Größe geschmiedet, aus seiner Töchter Adern und Gebeinen gesogen, und sie könnten sich von dem Verlust nicht erholen.
Fast alle waren sie jung, auf der Sommerhöhe des Lebens. Und sie teilten sich in zwei ungefähr gleiche Teile: die von den Anforderungen des Gatten, von den Pflichten der Geselligkeit und den Geburten der Kinder erschöpften Ehefrauen und die bleichen, vom Nichtstun, von Sehnsucht und Enttäuschung verzehrten Mädchen.
Männer besuchten den Ort nur selten. Ein hysterischer Künstler war jetzt anwesend, ein Oberst a. D., der seine Frau nie allein reisen ließ, und der Arzt.
Um die beiden ersten bekümmerte man sich nicht sehr viel. Aber der Arzt! – Was Dr. Ellrich gesagt hatte, in welcher Stimmung er sich befand, was er für einen Charakter besaß, das bildete den Gesprächsstoff in der Frühe am Brunnen, bei der Mittagstafel und bei den Reunions des Abends. Manche hielten ihn für einen Dämon, andere für einen Engel. Zwanzig Damen fanden, es sei unerhört, wie frei zwanzig andere sich im Verkehr mit ihm benahmen, und ein Dutzend weitere erklärten jene ersten für heimtückisch kokett und berechnend dem Doktor gegenüber. Die junge Frau eines Bankiers wollte sich um seinetwillen scheiden lassen, aber es war ja nicht daran zu denken, dass er die heiraten würde, er wusste doch am besten, wie krank die war.
Ein höchst aufregender Augenblick entstand, sobald er abends in den Kursaal trat und man nicht wusste, zu welcher Gruppe er sich gesellen würde. Es mochte ja töricht sein – lächerlich – aber es blieb nun einmal ein Ehrenpunkt, den Doktor an seinem Tisch zu haben. In dieser engen Gemeinschaft, wo das Interesse sich auf so wenige Punkte konzentrierte, unter dem Einfluss der aufregenden Bäder, der scharfen Höhenluft bekam jede Stimmung, jedes Gefühl, jeder Einfall in den Seelen, deren Gleichgewicht schon krankhaft gestört war, eine unnatürlich gesteigerte Bedeutung und wirkte mit gefährlicher Ansteckungskraft. Sie erwarteten alle so viel von diesem Doktor, Gesundheit, Frohsinn, Mut und Lebenshoffnung sollte er jeder einzelnen zurückgeben. Da musste man ihm doch ein wenig den Hof machen.
»Dieser Doktor ist mir widerwärtig«, erklärte Agathe schon nach der ersten Sprechstunde. Wie eine Sensitive erzitterte sie unter seinen scharfen Augen.
Eugenie fand ihn amüsant. »Ein bisschen rücksichtslos und frech – aber – na – sonst kommt er wohl hier nicht durch.«
Wie sie beobachtet wurden, als er sich abends zu ihnen setzte. Lisbeth Wendhagen kam auch gleich vom anderen Ende des Saales hergelaufen. Natürlich kokettierte Eugenie mit ihm – es war ja hier Mode, und sie war zu jeder neuen Mode Bereit. Pfui – pfui – ekelhaft.
So einen cynischen Zug hatte dieser Doktor Ellrich am Mundwinkel. Der durchschaute die Frauen ganz und gar – er verachtete sie … Die frivolen Witze und Andeutungen, die er mit Eugenie über die anderen Patientinnen tauschte! Wahrscheinlich hinter dem Rücken auch über sie. Vor dem musste man sich in acht nehmen – der meinte es nicht gut – – Nur fort – fort von hier … Ein Ort, ein dunkler, stiller Winkel, dahin die Stimmen sie nicht verfolgten, – dahin keine Farbe, kein Licht und kein Klang dringen konnte. Dort sich verbergen und schlafen – schlafen – traumlos schlafen …
*
Seit Eugenie sie überwachte, durfte sie die Nächte nicht mehr auf einem Stuhl zusammengekauert sitzen und ins Dunkle starren. Aber sie schlief doch nicht. Immerfort musste sie grübeln, wie sie Eugenie und dem Doktor und all den vielen Frauen, die sie neugierig beobachteten, entfliehen konnte.
Dabei dies Tönen und Dröhnen – als würde eine große Kirchenglocke unablässig in ihrem Kopfe geschwungen.
Das störte sie ja im Denken – sie kam und kam nicht ins Klare. Und es musste doch etwas geschehen – sehr schnell …
Ehe Martin abreiste, hatte er zu ihr gesagt: sollte sie noch den Wunsch haben, in der Schweiz zu bleiben, so ändere das Geschehene nicht im mindesten seine Bereitwilligkeit, ihr zu helfen.
Seine Haltung war gezwungen gewesen und sein Ton kühl.
Sie hatte ihm keine Antwort gegeben.
Siedend heiß wurde es ihr, dachte sie daran. Nur nie – nie ihn wiedersehn …
Wenn sie doch zu ihm ginge? Heimlich, ganz heimlich?
Sie musste ihm beweisen, dass sie nicht so erbärmlich war, wie er glaubte.
Sich rechtfertigen … Das war nun nicht mehr möglich.
Ihm helfen in stiller, harter Arbeit … Jawohl! Er würde sie doch nur für zudringlich halten.
Und bei diesem rasenden Abscheu, Ekel und Hass … Es konnte wieder über sie kommen, so wie an dem Abend … Sie – sie – und noch etwas wollen? Etwas, wozu Selbstvertrauen und Kraft gehörte … Sich verkriechen, sich verstecken, wo kein Mensch sie sah und hörte – wo sie keinen in ihrer Nähe fühlte – –
*
Nein – sie wollte nichts mehr, als still bei Papa bleiben – sie wollte gewiss nicht wieder an das alte gewohnte Joch rühren.
Sie hatte es nun gesehen, dass sie in der reinen Luft der Höhen nicht atmen konnte. Sie war nicht für die Bergesgipfel geschaffen – sie erstickte einfach dort.
Freilich die Männer … die nahmen sich auch auf die Höhen mit hinauf, was sie mochten, was ihnen angenehm schien – nur sie – sie sollte da in Eis und Schnee erstarren. Im Grunde war es also gleichgültig, ob sie unten saß oder mit Gefahr ihres Lebens an den Felsenhängen der Wahrheit und der Freiheit hinaufzuklimmen versuchte – für die Mädchen blieb sich die Sache ziemlich gleich – Entsagung überall. Da – da – da traf sie ihn wieder – den großen Betrug, den sie alle an ihr verübt hatten – Papa und Mama und die Verwandten und Freundinnen und die Lehrer und Prediger … Liebe, Liebe, Liebe sollte ihr ganzes Leben sein – nichts als Liebe ihres Daseins Zweck und Ziel …
… Das Weib, die Mutter künftiger Geschlechter … Die Wurzel, die den Baum der Menschheit trägt …
Ja – aber erhebt ein Mädchen nur die Hand, will sie nur einmal trinken aus dem Becher, den man ihr von Kindheit an fortwährend lockend an die Lippen hält – zeigt sich auch nur, dass sie durstig ist … Schmach und Schande! Sünde – schamlose Sünde – erbärmliche Schwäche – hysterische Verrücktheit! schreit man ihr entgegen – bei den Strengen wie bei den Milden, den Alten und den Jungen, den Frommen und den Freien.
*
Sie hatte gezeigt, dass sie durstig war, und sich damit des einzigen Menschen beraubt, der sie hätte retten können.
Und sie sehnte sich so sehr nach ihm.
Sie wollte doch zu ihm flüchten. Bei ihm wird sie gesund … Sie wusste, wo Eugenie das Reisegeld aufbewahrt … Nicht einmal das vertraute Papa ihr noch an …
Sie begann wieder zu weinen.
Meinetwegen mochte er sie verachten … Ganz demütig will sie ihn bitten: Lieber, lieber Mani – behalte mich nur bei Dir, schütze mich nur … gegen die anderen …
Besonders gegen Eugenie! Wie sie sie hasste – die mit so einer kalten Gewalt alles an sich zog … Die ganze Welt beherrschte sie!
Der Doktor hatte sich auch schon in sie verliebt. Da machen sie natürlich gemeinsame Sache gegen sie – und verraten Papa alles, alles – die schlechten Menschen …
Ach – die Angst – die Angst!
Agathe läuft in ihrem Zimmer herum – immer hin und her – hin und her. Sie ist allein.
Eugenie hat für eine Stunde von ihr Abschied genommen, sie soll sich aufs Bett legen und ruhen unterdessen. Eugenie fährt mit dem Doktor spazieren in seinem offenen Wagen, den er selbst kutschiert. Wie sie da oben thronte – den schelmisch-lauernden Zug um den Mund, das schwarze Hütchen auf dem blonden Haar – aus allen Fenstern blickte man ihr nach. Mit ihm fahren war die höchste Ehre, die der Doktor zu vergeben hatte. Auf die Straße kamen die Damen gelaufen und machten neidische Glossen. Aber Frau Eugenie vergibt sich nichts. Zwischen ihr und dem Doktor sitzt Wölfchen in seiner strammen, militärischen Haltung mit der kleinen Soldatenmütze.
Und triumphierend hatte sie rings umher gegrüßt und gewinkt, während der Doktor an den Zügeln zog und die Pferde lustig ausgreifen ließ.
Die Heuchlerin … die Heuchlerin Agathe lachte in der Einsamkeit, ballte die Hände und schüttelte sie drohend.
Mich hat man nicht mitgenommen, vor mir fürchten sie sich wohl – aber der kleine Junge, was kümmern sie sich um den?
Wenn sie draußen sind, wo keiner sie mehr sieht, da küssen sie sich – der Doktor und – Eugenie ha ha ha – und Walter küsst sie auch und Wölfchen – alle küssen sich. Martin und die Kellnerin und der Commis – alle, alle … pfui! Warum kommen sie zu ihr ins Zimmer – das ist so boshaft.
Sie hält sich die Augen zu. Sie darf das nicht sehen. Sie ist doch ein anständiges Mädchen.
Nein – nein – nicht mit Fingern auf mich zeigen! Habt doch Erbarmen. Schont doch wenigstens meinen lieben Papa …
Als Eugenie heimkam, sah sie die Jalousien bei ihrer Schwägerin noch geschlossen. Aus der frischen, hellen Herbstluft trat sie fröhlich erregt in das halbdunkle Zimmer.
»– Mädchen – was ist Dir?«
In der Ecke zwischen der Wand und dem Ofen stand ein gestickter Lehnstuhl. Hier kauerte Agathe, die Knie hochgezogen, die spitzen Schultern vorgestreckt, die Ellbogen an sich gepresst – das gelbe, hohläugige Gesicht mit einem unbegreiflichen Ausdruck von Entsetzen vor sich ins Leere starrend.
»Mein Himmel – fehlt Dir etwas?«
Eugenie ergriff sie am Arm und schüttelte sie.
»Du siehst ja aus, dass man sich fürchten könnte.«
Agathe starrte ihr schweigend, drohend in die Augen.
»Höre, Du«, rief die junge Frau Heidling, »ich schicke zum Doktor …«
Ein gellender Schrei – ein wilder Lärm und der Ruf: Zu Hilfe! Hilfe …!
Die Zimmernachbarn, Kellner und Wirtin stürzten in wirrem Durcheinander herbei.
Agathe hatte ihre Schwägerin zu Boden geworfen, kniete auf ihr und suchte sie zu würgen. Sie lachte, sie schrie und stieß irre Worte aus.
Mit brutaler Gewalt musste die Tobende gehalten – der zarte Mädchenkörper gebändigt und gefesselt werden.
*
Bis tief in die Nacht hinein saßen und standen vor dem Kurhaus die Damen zusammen und besprachen das Geschehene.
Ein junges Mädchen hatte den Verstand verloren – es war nichts gar so Seltenes in dem Badeorte. Man zählte die Fälle der legten Jahre. Und man flüsterte schaudernd und zeigte sich diese und jene, die wohl auch nicht weit davon waren.
Teilnehmend drängte man sich um Eugenie. Sie trug einen Tüllshawl über einer roten Schramme am Halse und gab mit halblauter, mitleidig-ernster Stimme Auskunft.
Zwei Wärterinnen hüteten die Kranke. Es durfte niemand zu ihr. Morgen sollte sie transportiert werden.
Nein – man wusste keinen Grund – absolut keinen!
Eine unglückliche Liebe? Bewahre – in früheren Jahren – aber Agathe war immer ein so verständiges Mädchen gewesen … Gott – prüde, zurückhaltend konnte man sie eher nennen. Nicht wahr, Lisbeth? – Und sie beide hatten sich immer so gut gestanden – sie waren ja Freundinnen von Kindheit her …
Zu schauerlich – zu entsetzlich … flüsterte sie Lisbeth Wendhagen zu – die arme Agathe beschuldigte sich, Dinge getan zu haben – vor dem Doktor und den Krankenwärterinnen – es war ja ganz unsinnig – kein Wort davon wahr! Sie hatte ja nicht die kleinste Backfischliebschaft gehabt … Und sie nannte sich mit Namen – brauchte Ausdrücke, als ob ein böser Geist aus ihr redete. Eugenie begriff es nicht, wo sie die abscheulichen Worte nur gehört haben konnte.
Jener Frühlingsabend unter dem alten Taxusbaum, wo sie der kleinen Spielgefährtin die von den Zigarrenarbeitern und Dienstboten erlauschten, unreinen Geheimnisse ins Ohr geflüstert – den hatte Frau Lieutenant Heidling längst vergessen.
*
Mit Bädern und Schlafmitteln, mit Elektrizität und Massage, Hypnose und Suggestion brachte man Agathe im Laufe von zwei Jahren in einen Zustand, in dem sie aus der Abgeschiedenheit mehrerer Sanatorien wieder unter der menschlichen Gesellschaft erscheinen konnte, ohne unliebsames Aufsehen zu erregen.
Sie wohnt bei ihrem Vater und hat soviel damit zu tun, die Vorschriften, welche die Ärzte ihr mitgegeben haben, getreulich zu befolgen, dass ihre Tage und ihre Gedanken so ziemlich ausgefüllt sind. Regelmäßig um drei Uhr sieht man sie neben ihrem Vater spazieren gehen, einfach und gut gekleidet – von weitem kann man sie immer noch für ein junges Mädchen halten. Weil die Ärzte dem Regierungsrat gesagt haben, seine Tochter brauche nur ein wenig geistige Anregung, erzählt er ihr, was er des Morgens in der Zeitung gelesen habe. Nach dem Kaffee begibt sich Papa ins Lesemuseum, abends spielt er Whist mit ein paar alten Herren, und Agathe legt Patience.
So leben sie still nebeneinander hin – voller Rücksichten und innerlich sich fremd.
Agathes Gedächtnis hat gelitten – in ihrer Vergangenheit sind Abschnitte, auf welche sie sich nicht mehr besinnen kann. Einem längeren Gespräch zu folgen, ist ihr nicht möglich. Sie hat sich eine Sammlung von Häkelmustern angelegt und freut sich, wenn sie ein neues hinzufügen kann. Die Zukunft macht ihr keine Sorge mehr. Sie begreift auch nicht, dass so vieles sie früher aufregen konnte – jetzt lässt alles, was nicht ihre Gesundheit betrifft, sie ganz gleichgültig. Sie seufzt oft und ist traurig – zumal wenn die Sonne hell scheint und die Blumen blühen, wenn sie Musik hört oder Kinder spielen sieht. Aber sie wüsste kaum noch zu sagen, warum …
Walter und Eugenie bemühen sich, eine Stelle für sie in dem neugegründeten Frauenheim zu erlangen. Denn, sollte Papa einmal abgerufen werden … ins Haus nehmen kann man sie doch nicht gut, zu den Kindern – ein Mädchen, das in einer Nervenheilanstalt war …
Und Agathe hat vielleicht ein langes Leben vor sich – sie ist noch nicht vierzig Jahre alt.
ENDE