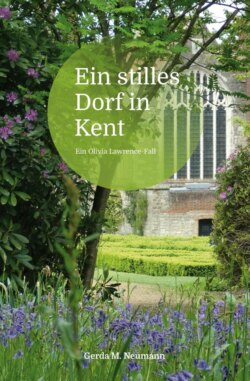Читать книгу Ein stilles Dorf in Kent - Gerda M. Neumann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
⋆
ОглавлениеFür den Abend hatten sie eine Einladung ins Pfarrhaus. Olivia trug wieder gänzlich eigene Kleider: einen schwarzen Schmetterlingspullover zu einem weiten knöchellangen Rock mit dünnen schwarzen und rotbraunen Streifen, dazu Ballerinas ohne jeden Zierrat. Die schweren braunen Haare konnten wieder frei fliegen, wenn sie den Kopf schüttelte, doch im Augenblick stand sie sehr ruhig neben ihrem Onkel und wartete ab, was auf das Klingelzeichen folgen würde.
Pfarrer Mottram öffnete die Tür, im schwarzen Jacket und weißen schmalen Kragen stand er sehr offiziell im Türrahmen und bat sie herein. Die wechselseitige Begrüßung fand hinter der verschlossenen Haustür statt. Roger Mottram wirkte sichtlich angespannt. Er führte seine Gäste ins Arbeitszimmer und schenkte einen Aperitif ein, es handelte sich um ein Quitten-Weingetränk, wie er überkorrekt erklärte, seine Frau habe es hergestellt. Raymund erinnerte ihn daran, dass er es schon häufiger und immer gern getrunken habe. Pfarrer Mottram hielt inne und sah ihn aufmerksam an: »Ja, du hast recht, alter Freund. Überhaupt sind wir unter Freunden. Alles, was wir heute reden, bleibt unter uns und wir können diese seltsame Unternehmung jederzeit abbrechen, ohne dass für irgendjemanden ein Schaden entsteht.« Deutlich erleichtert füllte er die kleinen Süßweingläser nach und trank erneut auf das gemeinsame Wohl.
Olivia sah sich in dem dunklen holzgetäfelten Raum um: Bücherregale, ein Kamin und davor zwei Ledersessel, ein großer Schreibtisch, dahinter weitere Bücherregale, viele Ablagekästen, über dem Türrahmen ein schlichtes Holzkreuz. Es wirkte, als sei Roger Mottram in den Raum seines Vorgängers eingezogen und habe alles beim Alten gelassen. Bevor sie darüber ins Grübeln kam, flog die Tür auf und Aphra Mottram begrüßte ihre Gäste, schlicht, herzlich und mit der Einladung, sich um den Esstisch zu versammeln.
Auch im Esszimmer standen die alten Eichenmöbel wie vermutlich schon vor hundert Jahren. Doch die Vorliebe der Pfarrersgattin für Quitten hatte sich hier in den Farben der Inneneinrichtung durchgesetzt. Die Holzvertäfelung, in diesem Raum nur bis zur halben Höhe, war in einem warmen, fast dunklen Gelb gestrichen, die Wände darüber sehr hell gelb und weiß die Zimmerdecke. Auf den Stühlen lagen gelbe und hellgrüne Polster und die zugezogenen Vorhänge waren gelbgrün gestreift. Eine Vase mit Frühlingszweigen machte den heiteren Eindruck perfekt. Olivia fühlte sich rätselhaft in der Gegenwart angekommen. Sie schaute Aphra Mottram zu, die freundlich und zielstrebig die Suppe verteilte, ihren Mann zu einem kurzen Segen veranlasste und das Essen eröffnete. Sie war schmal und dunkel, vermutlich fast so groß wie ihr Mann, der aber dreimal so viel Raumvolumen verdrängte. ›Eine Elbenkönigin in den Waliser Bergen könnte so aussehen‹, ging es Olivia durch den Kopf. »Wachsen Quitten auch wild?« wollte sie in einer Gesprächspause wissen. Mit leicht geneigtem Kopf sah sie ihre Gastgeberin an.
Aphra Mottram besann sich kurz: »Hier in der Nähe in einer Hecke gibt es zwei, sie tragen allerdings keine Früchte. Und am Waldrand, wenn Sie dem Pfad vom Kirchhof den Südhang hinunter folgen, steht ein großer struppiger Busch. Dessen Früchte sind klein und hart und von wunderbarem Aroma. Sie lagen einmal einen ganzen Winter lang in der Sakristei und es duftete dort endlich nicht mehr nach staubigen Kleidern, sondern nach Leben. Seitdem bringe ich jeden Herbst einen großen Korb voll dorthin.«
Sie sprachen die Mahlzeit hindurch über allgemeine Themen. Zum Beispiel beunruhigte Roger Mottram, ausgelöst durch den sehr trockenen April, die Wasserknappheit, die an einigen Stellen in Kent im letzten Sommer für Probleme gesorgt hatte. Es war allgemein bekannt, dass vierzig Prozent des Trinkwassers auf dem Weg durch die alten Rohre verloren ging, und niemand entschloss sich, etwas dagegen zu unternehmen. Noch war Howlethurst nicht betroffen. Es lag an einer Wasserscheide, nach allen Seiten schien Wasser munter und für immer unterwegs zu sein. Aber es war nicht überall so.
Zum Abschluss des Essens gab es eine kleine Käseplatte mit Quittenstücken dazu. Sie hatten dem Aperitif ihr Aroma gegeben, waren danach gekocht und wieder abgekühlt worden und begleiteten nun den Käse. Endlich stellte Olivia die zwingende Frage: »Wie kamen Sie zu Ihrer Begeisterung für Quitten?«
Auf dem Gesicht der Pfarrersfrau zeigte sich ein fast mädchenhaftes Lächeln: »Howlethurst hat sie mir beschert. Bis wir hierherkamen, freute ich mich im Frühling über diese verzaubernden Blüten, wie sicherlich viele andere Menschen auch. Hier nun an der südlichen Mauer des Kirchenschiffes wuchsen zwei verkümmerte Sträucher, deren wenige Blüten mich um Hilfe baten. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was da zu tun war, also holte ich mir an den verschiedensten Stellen Ratschläge. In der Folge setzte ich einige neue Pflanzen neben die alten. Denen gefiel ihr Platz auf Anhieb und sie trugen schon bald gelbe aromatische Früchte. Ich begann, mich nach weiteren Plätzen umzusehen. Der Teil der Friedhofsmauer hier am Green entlang, der den ältesten Teil des Friedhofs schützt, war gärtnerisch ebenfalls vernachlässigt, und die Innenseite war wieder Südseite. Also setzte ich dort Quittenbäumchen, es gibt viele verschiedene Sorten, was den Reiz noch erhöhte. Nun, vielleicht war ich selbst am meisten überrascht, jedenfalls trugen alle miteinander im Laufe der Jahre Früchte und zunehmend mehr Früchte und ich verarbeitete sie auf die eine oder andere Weise… so eine Begeisterung kann sich verselbstständigen… ich nehme an, Sie kennen etwas vergleichbares.«
Später saßen sie im Wohnzimmer beisammen in schweren alten Sesseln auf verschlissenem Leder. Auch sie schienen vom Vorgänger übernommen. Zwei Menschen auf der Durchreise und doch schon ein Vierteljahrhundert am selben Ort, über die Pflanzen tief verwurzelt. »Dieses Stück Erde hier in Kent scheint ein besonderes Stück Erde zu sein«, überlegte Olivia laut. »Die Quittenbäumchen um die Kirche, Lindenspaliere um den Green, reden Sie auch auf irgendeine Weise mit diesem Ort, Mr Mottram?«
Roger sah leicht überrascht von seiner Zigarre auf, die er gerade sorgfältig zum Anzünden vorbereitete. »Tja, vielleicht. Vielleicht kann man es so aber auch gerade nicht sagen. Oben im Kirchturm habe ich Brutvorrichtungen für Schleiereulen organisiert. Letztlich war das eine Absprache mit unseren Nachbarn hier um den grünen Rasen, die über Wühlmäuse klagten. Die Schleiereulen verringerten ihre Zahl überraschend effektiv. Sie fressen natürlich auch andere kleine Tiere, doch ich denke, im Großen und Ganzen ist der Mensch mit ihrem Speiseplan einverstanden.«
»Verallgemeinerungen sind grundsätzlich problematisch«, wandte Raymund ein.
Roger grinste: »Stimmt, was heißt schon ›der Mensch‹. Ihr Onkel liebt seine Haselmäuse und hat deswegen nicht viel übrig für die Eulen. Ich nehme an, deine Katze respektiert deinen Wunsch?« Raymund nickte und Rogers Vergnügen wuchs: »Welch eine ideale Partnerschaft. Aber«, wandte er sich wieder an Olivia, »diese Schleiereulenaktion ist nicht speziell an Kent gebunden. Kein genius loci hat seine Hand dabei im Spiel. Ich meine, das Problem waren die Wühlmäuse und nicht eine sentimentale Hinwendung zur Landschaft von Kent.«
»Das klingt ein wenig rüde, Roger!« protestierte Aphra. »Und man könnte zumindest darüber diskutieren, ob die Eulen deine Beziehung zum Land nicht doch beeinflussen. Man achtet plötzlich auf völlig neue Dinge, die nun mal mit dem Land zusammenhängen. Erinnerst du dich an das seltsame Mäusesterben vor zwei Jahren. Die Ursache blieb ungeklärt. Niemand raffte sich auf, ein paar Mäuse einzupacken und zu einem medizinischen Labor zu tragen. Ich auch nicht, zugegeben. Heute verstehe ich mich nicht mehr.« Ihr Blick traf direkt auf den von Olivia. Sie folgte deren stummer Aufforderung und erinnerte sich: »Man findet hin und wieder eine tote Maus irgendwo, von einer Katze zur Strecke gebracht und doch nicht aufgefressen. In jenem Sommer vor zwei Jahren häuften sich diese Entdeckungen, das ist alles. Ich fand immer wieder welche um die Kirche herum und in unserem Garten, Nachbarn, mit denen ich sprach, ebenfalls. Hier auf unserer Seite des Ortes, aber auch auf der anderen Seite der Hauptstraße, drüben bei den Farmen, Mr Wood fielen sie auf. Erinnerst du dich, Raymund? Die Farmer schüttelten drüben wie hier den Kopf, sie hatten nichts gesehen. Das war nur anders bei Mrs Melling, die auch mitten in den Weiden lebt mit ihren Eseln. Sie achtete einfach mehr auf Kleinigkeiten, nehme ich an. Es war auffällig, aber nicht so gravierend, dass es jemanden wirklich alarmiert hätte. Roger und ich begriffen das Ausmaß, als die Eulen oben im Turm nur die Hälfte ihrer Jungen aufzogen. Sie fangen lebende Mäuse und davon gab es zu wenige, die toten bemerken sie, glaube ich, gar nicht. Es gab auch keine zweite Brut im September, obwohl die Geschichte mit den Mäusen da vorbei war.«
Der Pfarrer hatte inzwischen seine Zigarre angezündet und genehmigte sich einige ruhige Züge. »Das bedrückte mich damals tatsächlich«, gestand er endlich zu. »Aber ich fand heraus, dass die Zahl der Jungen ganz natürlich nicht nur vom Nahrungsangebot, sondern auch von der Entfernung zu den Hauptjagdgründen abhängt. Mit den Mäusen stimmte offenbar wirklich etwas nicht oder unsere Eulen entdeckten den Wohlgeschmack von Fröschen. Unten im Hexden-Tal gab es in jenem Sommer jedenfalls ein Überangebot davon, dem sie sich widmeten. Ich nahm ihr Gewölle auseinander, wissen Sie. Nun ist der Hexden fünf bis sechs Kilometer geschätzte Luftlinie entfernt, das bedeutet einen wesentlich größeren Energieverbrauch für die Tiere, also zogen sie weniger Junge groß und das auch nur einmal. Wenn das jüngste Eulenkind ein paar Tage alt ist, fliegt auch das Weibchen zur Jagd hinaus. So weit so gut. Bei einer zweiten Brautwerbung aber bliebe sie erneut daheim und das Schleiereulenmännchen würde nun wieder tote Mäuse oder eben Frösche zu ihr ins Nest bringen, um sie davon zu überzeugen, dass er stark genug ist, sie ein zweites Mal zu versorgen, und um ihr zu beweisen, dass das Angebot draußen in Ordnung ist. Der Jagderfolg ist damit nicht nur eine echte Herausforderung für das Aufziehen der Jungen, das ist klar, sondern im Fall der Schleiereulen auch für die Paarungsbereitschaft des Weibchens. Und so spielt die Entfernung zu den Hauptjagdgründen eine entscheidende Rolle – im nächsten Jahr war alles wieder in Ordnung, auch in diesem sieht es bisher gut aus.« Er klopfte sorgfältig die Asche seiner Zigarre in einen dicken gläsernen Aschenbecher. »Es gibt ja immer wieder Epidemien. Haben Sie von dem großen Geiersterben in Indien gehört? Nein? Es begann vor ungefähr zehn Jahren und vernichtete um die fünfundneunzig Prozent der drei dort lebenden Geierarten.«
»Um Himmels willen!« Raymund richtete sich auf. »Und was geschieht seither mit den toten Tieren, die sie normalerweise aufräumen?«
»Tja, schwierig. Einen Teil wenigstens übernehmen die Hunde, aber daraus erwächst eine neue Gefahr. Geier haben eine Magensäure, die alle Krankheitserreger vernichtet, Hunde nicht; sie leben aber im Gegensatz zu den Geiern bei den Menschen und ihre Ausscheidungen enthalten jetzt zusätzliche Krankheitserreger. Kurz und gut, es ist gefährlich; über die Maßnahmen der indischen Regierung in dieser Richtung habe ich leider nichts gelesen. Was ich weiß, ist, dass die Parsen, die traditionell in den sogenannten Türmen des Schweigens ihre Toten der Luft, recht eigentlich aber den Geiern überlassen, jetzt zur Feuerbestattung gezwungen sind. Das kommt einem kulturellen Erdbeben gleich.«
»Hat man die Ursache dieser Apokalypse herausgefunden?« Olivia war für den Augenblick schockiert.
»Gerade vor ein paar Monaten. Es handelt sich wohl um ein entzündungshemmendes Mittel aus der Humanmedizin, dass man seit den neunziger Jahren auch den Rindern zu verabreichen begann. Bei den Geiern, sie sind diejenigen, die die weißen Rinder fressen, ruft es eine Art Gicht hervor. Sie sitzen reglos auf ihren Ästen, die Köpfe zwischen den Krallen, als sei ihr Genick gebrochen und irgendwann fallen sie dann tot vom Baum. Letztendliche Todesursache ist Nierenversagen.«
»Und wie geht man mit dieser Katastrophe jetzt um?«
»Das Medikament wird nicht mehr für Rinder eingesetzt. Damit haben die letzten Geier eine Chance, zu überleben und sich wieder fortzupflanzen. Aber wie lange wird es dauern, bis sie wieder eine nennenswerte Zahl erreicht haben? Um die Vermehrung zu beschleunigen, richtet man Zuchtstationen für Geier ein. Das habe ich vor Kurzem gehört.«
Im Moment fühlte Olivia die Leere einer großen Fassungslosigkeit in sich. Ihr Blick traf ihren Onkel. Der saß zurückgelehnt in der Tiefe seines Sessels und grinste sie an. Während sie ihn mit schmalen Augen musterte, vertiefte sich sein Grinsen noch, dabei blieben die Augen ernst. Die ihren wanderten weiter. Roger Mottram zog an seiner Zigarre. Aphra griff zur Teekanne und schenkte Olivia nach. Die nahm sich nachdenklich Milch, rührte um und nahm den Pfarrer fest in den Blick: »Sie haben sicher über die Todesfälle, die Sie ins Grübeln brachten, immer wieder nachgedacht. Dabei wird Ihnen hier und da etwas aufgefallen sein, das Sie stutzen ließ. Was davon fällt Ihnen jetzt ein?« fragte sie freundlich. Sie trank einen kleinen Schluck von dem sehr heißen Tee, stellte entgegen ihrer Gewohnheit die Tasse ab und wartete. Raymunds Grinsen war verschwunden.
Unbeholfen legte der so direkt Angesprochene die halbgerauchte Zigarre beiseite und stemmte sich zu aufrechter Haltung hoch. »So auf Anhieb fällt mir gar nichts ein. Ich habe nur die Zahlen, diese beunruhigenden Zahlen, die auch Raymund beunruhigend fand. Aber sehen Sie, die Schwierigkeit beginnt schon damit, dass ein Teil, sagen wir die Hälfte dieser Todesfälle zumindest, sicher ganz normal zustande kam. Aber welche Hälfte? Ich weiß nicht mal das, wie sollte ich auch.« Er sah Olivia beklommen an: »Wenn wir einfach nur Ihre Zeit vergeuden, sagen Sie es ohne Scheu und wir begraben das Ganze.«
»Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten«, schaltete Raymund sich entschlossen ein. »Unser Verdacht ist doch zu gravierend und mit dem Tod von Mrs Large haben wir einen konkreten Fall, der euch ganz speziell beunruhigt und an dem wir ansetzen können. Wir sollten diese Chance nutzen.«
Der Pfarrer sah mit sichtlichem Unbehagen zu seiner Frau hinüber. »Raymund hat recht«, gab sie zu. »Delia starb zum falschen Zeitpunkt. Natürlich kann man auch aus übergroßer Freude sterben, aber ein solcher Gefühlsüberschwang lag ihr fern. Warum dann also in dieser entspannten Situation?« Sie sah zu Olivia hinüber: »Ich weiß darauf keine Antwort.«
»Erzählen Sie mir von Mrs Large. Von deren Freunden hier am Ort oder woanders, von Verwandten. Welcher Art war ihr Umgang, besuchten sie sich, wie lange kannten sie sich, was für ein Leben führte sie…«
Aphra rückte auf die Sesselkante vor, nahm ihre Teetasse auf und begann umzurühren. »Delia lebte über vierzig Jahre hier im Dorf, in jenem wunderschönen weißen kentischen Landhaus am Green. Sie führte eine gute Ehe, zu ihrem Leidwesen ohne Kinder, seit neun Jahren war sie Witwe. Sie hatte Jura studiert und für Amnesty International gearbeitet, das ging zu guten Teilen von zu Hause aus. Sie war die erste im Ort, die ein Faxgerät hatte, und die erste mit Internetanschluss. Bis zuletzt arbeitete sie für Amnesty, so weit ihre Kräfte es erlaubten.« Aphra beendete das Kreisen in ihrer Tasse und legte den Löffel ab.
»Delia hatte einen Bruder«, erinnerte sie sich weiter, »den ich nie kennengelernt habe. Er ist schwer gehbehindert und bleibt in seinem Haus in Snowdonia. Er muss ein rechter walisischer Querkopf sein. Susan ist seine Enkelin.«
»Er kam auch nicht zu Beerdigung?«
»Hier gab es lediglich einen Trauergottesdienst. Delia wurde eingeäschert und die Urne nach Wales zum Familiengrab verschickt. Dort werden sich wohl alle versammelt haben. Damit meine ich, dass neben der nicht sehr zahlreichen Verwandtschaft doch wohl ihre beiden Freundinnen aus London nach Wales gefahren sein werden. Aber ich weiß das nicht. In den letzten Jahren hat sie die beiden abwechselnd mehrmals im Jahr in London besucht und bei der Gelegenheit Einkäufe gemacht, Theater besucht und die Heide von Hampstead. Es muss schön gewesen sein, sie kam immer sehr heiter zurück.«
»In den Jahren davor war das anders?«
»In sofern, als sie und ihr Mann ein Apartment in London hatten, auch beruflich immer wieder dort waren. Wie häufig sie sich seinerzeit mit ihren Freundinnen traf, weiß ich nicht so genau.«
»Gab es Gegenbesuche?«
»Ja, beide waren immer mal wieder hier auf dem Lande, mit Ehemann, ohne Ehemann, sehr selten gemeinsam. Aber auch das kam vor. Ich lernte sie kennen, aber nur im Vorbeigehen, wenn wir uns halt zufällig begegneten.«
»Demnach hielt Mrs Large ihr Leben hier in Howlethurst und in London auseinander?«
Aphra besann sich. »Ach wissen Sie, so kann man das eigentlich nicht sagen. Sie wohnte hier. Und sie kam jeden Sonntag zum Hauptgottesdienst in die Kirche. Danach redete sie mit dem einen oder anderen, wie es sich halt ergab. Sie interessierte sich durchaus für das Leben der Menschen um sich herum, hörte aufmerksam zu, vergaß so gut wie nichts, leistete Hilfe, wenn man sie darum bat. Mancher ging zu ihr, wenn er sich aussprechen wollte. Für Probleme hatte sie immer Zeit, für einen einfachen Tee eigentlich nie. Aber das störte auch niemanden.«
»Was machte sie, wenn sie nicht arbeitete und doch hier war?«
»Sie hat hinter dem Haus einen großen, sehr, sehr schönen Garten…«
Olivia lachte leise: »Natürlich! Sie sind die einzige Freundin hier am Ort gewesen, ist das so?«
»Ja, wir waren befreundet, solange wir hier sind, kann ich fast sagen. Wie es sich damals ergeben hat, weiß ich nicht mal mehr. Es stimmte einfach…« Traurig senkte Aphra den Kopf. Olivia hielt inne und sah Roger Mottram zu, der seine kalte Zigarre sehr konzentriert zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hin und her rollte.
»Über Tote soll man nur Gutes reden, das Bild von Delia Large hält sich vorbildlich an diese Regel«, störte Raymund die Stille. »Ich werde mich hüten, etwas anderes zu tun. Tatsache ist andererseits, wenn wir von der These eines unnatürlichen Todes ausgehen, dass es zumindest einen Feind gegeben haben muss. Ich persönlich tippe, dass er weiblichen Geschlechts ist. Aber das ist nur eine Annahme.«
Roger beendete das Rollen und sah ihn an: »Willst du damit sagen, dass sie für ihren Tod selbst verantwortlich ist?«
Der alte Militärhistoriker verneinte mit einer leichten Kopfbewegung. »Wenn ich die steigende Zahl der Todesfälle auf eine vorsätzliche Ursache zurückführe«, begann er schonend, »könnte man formulieren, dass eine Person hier im Ort den anderen oder einer Gruppe von ihnen den Krieg erklärt hat. Aber selbst wenn es sich um eine Gruppe handeln sollte, hat sie für uns Außenstehende keine sichtbaren Gemeinsamkeiten außer den ungefähren Lebensjahren. Folglich können wir einstweilen nur von Zufall ausgehen. Der große Clausewitz findet nun den Zusammenhang zwischen Zufall und Krieg ganz natürlich. Des Weiteren gehört für ihn das Glück zum Krieg, oder in unserem Fall eher das Pech. Das heißt, Delia Large kann ihren Tod durchaus selbst herbeigeführt haben, aber sie wusste davon nichts.«
Ein Schnaufen war die Antwort. »Könntest du dich etwas anschaulicher ausdrücken?«
Raymund quittierte die Bitte mit einem angedeuteten Grinsen, war aber sofort wieder ernst: »Ich stelle mir vor, dass sie die fragliche Person in einem Gespräch nach dem Gottesdienst verärgert hat. Du könntest darüber überhaupt mal nachdenken, Aphra. Wer redet nach der Kirche mit wem, gibt es Spannungen und von wem gehen sie häufiger aus als üblich. Wir wissen, dass Delia bei allem Interesse und aller Anteilnahme zu einer gewissen Ungeduld mit Schwächen neigte. Auch mit ihren eigenen, aber das hilft dem möglicherweise nicht, der sich gerade kritisiert fühlt.«
Mit beiden Händen auf den Lehnen saß Aphra inzwischen da und nahm Raymund und Olivia abwechselnd fest in den Blick: »Ich fürchte, dass geht so alles nicht. Was du dir da vorstellst, Raymund, kommt doch dem Ausspionieren der eigenen Gemeinde gleich. Und wenn Olivia gleichzeitig hier herumgeht und die Leute ausfragt, kommen wir in eine furchtbare Situation. Wir haben uns das alles nicht zu Ende vorgestellt, als wir hofften, durch deine Nichte unbemerkt Licht in die Zahlen zu tragen.«
Es half nichts, Olivia musste schon wieder lachen, wurde aber umgehend wieder ernst: »Sie haben recht, so geht das nicht. Ich sehe gerade die Schlagzeile vor mir: ›Pfarrer lässt Privatdetektivin auf seine Gemeinde los‹, den Text dazu können wir uns alle vorstellen – trotzdem kann ich mich an die Arbeit machen. Schauen Sie, ich bin Übersetzerin und verdiene mir ein gutes Zubrot mit Zeitungsessays. Irgendwie gerate ich gelegentlich in die Aufklärung von Mordfällen, aber ich bin überhaupt kein Profi, also habe ich auch keinen Stallgeruch an mir. Es besteht, glaube ich, kein Grund zur Sorge.«
»Aber es gibt Leute hier, die wissen, dass Sie schon Mordfälle aufgeklärt haben«, wandte Aphra ein, »die werden sich jetzt wundern… und wenn die zu reden beginnen…«
Olivia ließ sich Zeit mit der Antwort. »Sagen wir, diese aufklärungsfreudige Nichte des alten Strategiehistorikers«, jetzt bedachte sie ihrerseits den Onkel mit einem Grinsen, »ist meine Cousine. Ich bin Designerin und entwerfe vor allem Strickmuster für eine afrikanische Boutique in London.«
»Aber wir können doch nicht einfach lügen«, seufzte Roger.
»Das brauchen Sie auch nicht, jedenfalls nicht richtig. Ich entwerfe manchmal wirklich Strickmuster und die Boutique gibt es auch. Sie liegt in St. John’s Wood.« Roger seufzte zwar erneut, gab sich aber sichtlich geschlagen.
Raymund bediente sich noch einmal eines Clausewitz’schen Gedankenganges: »Jeder Feldherr übersieht nur seine eigene Lage. Folglich kann er sich über seinen Gegner vollkommen im Irrtum befinden. Generäle verzögern bei allzu großer Unsicherheit über die Situation des Feindes jede kriegerische Handlung. Sinnvoll ist das Prinzip des Hinhaltens aber nur, wenn man auf weitere Nachrichten hoffen kann, ansonsten entstünde aus dem Verzögern lähmende Unsicherheit, die dem Feind in die Hände spielt. Das ist in jedem Fall schlecht.«
Rogers Antwort begann mit dem an diesem Abend gewohnheitsmäßigen Seufzen. »Und diese zu erhoffenden Nachrichten beschafft uns deine Nichte?«
»Sie wird es versuchen.« Raymund stand auf. »Denkt über unser Gespräch nach, ihr zwei, wir bleiben in Kontakt.«
Der nachfolgende Abschied verlief herzlich auf Raymunds Seite, besorgt, bedenklich auf der anderen, wenngleich begleitet von freundlichen Worten. Kurz darauf saßen die beiden Hauptakteure beim Wein im Wohnzimmer des alten weißen Hauses mit der zum Wintergarten geöffneten Rückwand. Marmalade hatte sich vor der elektrischen Kaminheizung zusammengerollt und ließ hin und wieder ein zufriedenes Schnurren hören. »Endlich würdigt jemand diese geschmackliche Verirrung«, stellte Raymund fest, »ich beginne zu ahnen, dass ihre Zufriedenheit meinen Widerstand untergraben könnte.«
»In der Gefahr bist du nicht allzu oft«, konterte Olivia freundlich, »Roger hat deinen Widerstand heute Abend geradezu herausgefordert, nicht wahr?«
»Richtig, er ist mit einem Mal ein schrecklicher Zauderer! Ich verstehe ihn ja. Aber nachdem wir uns zum Handeln entschlossen haben, sollten wir dabei bleiben. Du hast deine Zeit ja auch nicht gestohlen.«
»Die Erwähnung des Feldherrn und seiner Generäle war nicht frei von Hintergedanken…«
»Wieder richtig. Bei allem Antreiben darf niemals aus dem Blick kommen, dass Roger das Kommando zum Handeln gab und die Leitung respektive die Verantwortung trägt. Ich bin meinethalben sein politischer Berater, aber nicht mehr.«
»Und ich der ausführende Offizier – doch wenn ich so darüber nachdenke, hat unsere Unternehmung mit Krieg recht eigentlich nicht viel gemeinsam. Viel eher mit Spionage.«
Raymund sah sie munter an: »Der arme Roger ist ein zur Untätigkeit verdammter Feldherr, der seinen Gegner viel zu schlecht kennt, um zum offenen Angriff zu blasen. Also setzt er einen Spion ein; um die Verwirrung noch zu erhöhen, einen weiblichen. So viel zum gegenwärtigen Stand – lass uns den morgigen Tag ins Auge fassen.«
»Um elf treffe ich mich mit Susan Large zu einem Spaziergang.«
»Richtig. Ganz schön zügig, Puck. Um ein Uhr steht ein Lunch auf dem Tisch und um zwei finden wir uns gemeinsam in der Bücherei ein, morgen ist mein Tag und die natürliche Gelegenheit, dich dort vorzustellen.«
Olivia nickte zustimmend und streckte sich, bevor sie erneut zu ihrem Glas griff. Um ein Haar hätte sie es umgestoßen, denn Marmalade hatte ihre Akrobatik als Aufforderung empfunden und blitzschnell reagiert. Sie schoss aufs Sofa und schob ihren Nacken unter Olivias Arm. Dabei schnurrte sie leise. Raymund schüttelte den Kopf: »Nicht, dass du dich sonderlich um sie bemüht hättest, oder ist mir das entgangen?«
»Sie bemüht sich um mich, ich mich um die hiesige ungereimte Todesrate und du darum, die beteiligten Personen in Gang zu halten… jedem das seine.« Ihre braunen Augen blitzten unternehmungslustig zu ihm hinüber.