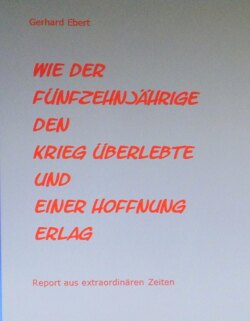Читать книгу Wie der Fünfzehnjährige den Krieg überlebte und einer Hoffnung erlag - Gerhard Ebert - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12. Die Schülervertretung
ОглавлениеSo nachdrücklich sich Uwe Zurückhaltung verordnet hatte, seine Stippvisite in Berlin blieb nicht ohne Folgen. Er hatte einen neuen Blick für die Probleme seines Lebens gefunden. Vor allem die Sache mit der Partei ließ ihn nicht los. Schließlich musste er keine gründen, es gab ja welche. Aus Neugier wurde alsbald Interesse, und zwar für die CDU.
Uwe empfand sich nicht unbedingt als Christ. Seine Beziehung zur Kirche hatte im Besuch der Messe am Heiligabend bestanden, was stets in Familie geschehen war, und in der obligatorischen Teilnahme an der Konfirmation. Das geistige Gut, das er mitgenommen hatte, war nicht Gottvertrauen, aber Nächstenliebe und durchaus auch, ja, Wahrheitsliebe. Obwohl man es damit nicht übertreiben durfte. Schummeln musste man gelegentlich. Zum Beispiel Abschreiben in der Schule. Also gemach mit hehren Gedanken. Berlin war ihm eine Lehre.
Eines Tages stand Uwe vor der Geschäftsstelle der CDU in der Leipziger Straße, zögerte nur kurz, dann ging er hinein. Zwischen Akten und Prospekten saß ein alter Herr, schaute neugierig auf und fragte gemütlich nach dem Begehr. Uwe signalisierte Interesse und fragte, ob er Informations-Material bekommen könne. Erfreut griff der Alte in ein Regal und überreichte Uwe einige dünne Broschüren. Selbstverständlich ganz unverbindlich! Uwe dankte und huschte auch schon wieder hinaus.
„Ex oriente lux“ war offenbar das Markenzeichen dieser Partei. Jedenfalls prangten die drei Worte auf jedem Papier. Uwe beschäftige sich gründlich und fand die Sache mit dem christlichen Sozialismus durchaus bedenkenswert. Kapitalismus war vorbei, das war klar. Kommunismus war ein vages Ideal. Aber Sozialismus, und zwar ein christlich-demokratischer, schien ihm nach der faschistischen Diktatur ein echt gutes Ziel.
Als der Professor Hickmann von der CDU aus Dresden zu einem Vortrag angekündigt wurde, ging Uwe zur Veranstaltung. Das Publikum schien ihm ziemlich alt und abgestumpft. Und die Zukunftsprognosen vom Professor eher vage. Wegen der herrschenden Besatzungsverhältnisse in Deutschland gäbe es leider viele offene Fragen. So blieb Uwe vieles unklar, zum Beispiel was unter Blockpolitik der antifaschistisch-demokratischen Parteien zu verstehen sei. Dennoch reifte noch während der Veranstaltung der Entschluss, in diese Partei einzutreten. Der Professor hatte mit seiner ruhigen Gewissheit Vertrauen geweckt. Schließlich musste man nicht alles auf eine Goldwaage legen. Und das war offenbar: In Sachen Demokratie liefen die Dinge unter den Russen etwas anders als unter den Amis.
Uwe hatte nicht vergessen, dass ihm unter den Amerikanern im Rathaus als Berater für die Jugend ein ehemaliger Nazi-Lehrer begegnet war, jedenfalls einer, den er als offenbar treuen Nazi in seiner Schule kennengelernt hatte. Als die Russen gekommen waren, und Uwe - neugierig wie er nun einmal war - erneut das Rathaus aufgesucht hatte, saß an der nämlichen Stelle ein Greis mit zerfurchtem Gesicht und riet: „Arbeiten müssen wir, Junge, arbeiten!“ Dazu hatte er bedeutsam genickt und Uwe angeblickt, als sei der hinfort ganz allein dafür verantwortlich.
Jedoch: Wahrscheinlich war der Nazi-Lehrer „entnazifiziert“ und als „Mitläufer“ eingestuft worden! Die sogenannten „Entnazifizierungs-Prozesse“ waren groteske Veranstaltungen gewesen, denen man beiwohnen konnte, und wovon Uwe Gebrauch gemacht hatte.
Irgendwie war das ein Zirkus gewesen. Jedenfalls schien ihm das so. Da musste der Nazi, um den es ging, vor einer Kommission erscheinen, und die zog in aller Öffentlichkeit über ihn her. Wenn er einen Nachbarn hatte, der etwas Gutes über ihn aussagte, hatte er schon halb gewonnen auf seinem Wege, als artiger Bürger anerkannt zu werden. Gab aber ein Nachbar schlimme Dinge kund, zum Beispiel, wie viele Nazifahnen der Geladene einst herauszuhängen und wie stramm er mit "Heil Hitler" zu grüßen pflegte, dann konnte das lange Debatten auslösen. Uwe konnte sich nicht erinnern, einmal erlebt zu haben, dass einer der vorgeladenen Nazis wirklich ein Nazi gewesen sein wollte. Alle hatten sie plausible Ausreden.
Ein ohne Zweifel gutes Beispiel für das neue demokratische Leben war die regelmäßige Versammlung der Stadtverordneten. Dort saßen Sozialdemokraten, Christdemokraten und Kommunisten beisammen, um über das Wohl und Wehe der Stadt und ihrer Bürger zu befinden. Das schier ewige Hin und Her der Diskussionen hatte Uwe zwar oft gelangweilt, aber immerhin auf die Idee gebracht, in seiner Oberschule ein bisschen für Demokratie zu sorgen.
Das heißt, eigentlich fand er die Idee in der Zeitung "Start", aber bei den Stadtverordneten sah er, wie man es machen könnte. Natürlich waren an seiner Schule keine politischen Parteien zu wählen. Aber gewählt werden, dachte er sich, müssten aus jeder Klasse zwei Schüler. Und alle zusammen bildeten dann das Schulparlament, das die Interessen der Schüler gegenüber den Lehrern wahrnehmen sollte.
Für Uwe war nicht vorstellbar, dass sich gegen sein demokratisches Begehren irgendein Widerstand regen könnte. Also ging er nicht brav zum Rektor, dessen Genehmigung einzuholen, sondern klebte einen Aufruf ans Schwarze Brett mit der Aufforderung an alle Schüler, die sich interessierten, sich zu bestimmter Zeit in seinem Klassenzimmer einzufinden. Das Echo war zwar viel bescheidener, als er gehofft hatte, aber ein paar Neugierige und Willige gab es schon. Noch bevor die Schulleitung aufgewacht war, hatte Uwe ein Gründungs-Komitee beisammen, das einen Aufruf zu Wahlen in den Klassen verfasste.
Wenig später wurde Uwe zum Rektor gerufen, der ihn – zu seiner Überraschung – zur Initiative beglückwünschte und Unterstützung zusagte. So bekam Uwe schneller als gedacht an prononcierter Stelle im Schulgebäude eine große schwarze Tafel, die er als Wandzeitung der Schülervertretung etablierte. Aufrufe und dergleichen hätten gewiss wenig interessiert, wenn sich ihm nicht glücklicherweise eine zeichnerisch begabte Schülerin angeboten hätte, die wirklich mit Witz und Schwung allen nüchternen Texten bunte Zeichnungen beizufügen verstand. Mit Hilfe dieser Wandzeitung gelang es dem Gründungs-Komitee, in allen Klassen Wahlen zu organisieren und dergestalt schön demokratisch eine Schülervertretung aus der Taufe zu heben.
Was diese Körperschaft schließlich zum Wohle der Schüler anstellte, war so gewaltig nicht, aber aufregend genug. Zum Beispiel gründete sie eine Laienspielgruppe, die bei Elternabenden auftrat. Vor allem aber setzte sie sich für Belange der Schule wie der Schüler ein, und diese Bemühungen wurden toleriert, solange sie die Schule nicht nach außen vertreten wollte und den Lehrern nicht in die Quere kam. Es war offenbar – was Uwe nicht begriff – schon eine ungeheure Einmischung, dass die Schülervertretung sich herausnahm, einen "Vertrauenslehrer" zu wählen, den sie zu ihren Sitzungen einlud und mit dem sie besprach, was sie bedrückte. Bei Zensuren ein Mitspracherecht des jeweiligen Klassenvertreters zu erreichen, scheiterte ebenso wie das Ansinnen, einen Vertreter des Schülerparlamentes zu den Lehrerkonferenzen zuzulassen.
Umso überraschter war Uwe, als sich eines Tages herausstellte, dass an solchen Konferenzen ein Vertreter der FDJ teilnehmen durfte, die damals an der Schule kaum zehn Mitglieder zählte. Bald wurde klar: Die zwar demokratisch gewählte, aber politisch indifferente Schülervertretung passte nicht in die neue politische Landschaft. Es kam zur Konfrontation. In sein Tagebuch notierte Uwe unter dem Datum vom 10. Februar 1949 vorsorglich: "Ich ringe mich immer mehr zur Überzeugung durch, doch in der FDJ mitzuarbeiten!" Und in Steno schrieb er dahinter: "Angst!" Einen Tag später notierte er: "Schülervertretungssitzung über eine Lehrerkonferenz, an der die FDJ teilgenommen hat. Ich forderte eine Wahl der gesamten Schülerschaft über 'Ja' oder 'Nein'. Doch die Wahl hat praktisch keinen Zweck; denn verboten wird die Schülervertretung ja doch. Es ist bitter! Alle Arbeit umsonst."
So war es denn auch. Mit einer gewissen Hartnäckigkeit hatte Uwe durchgesetzt, in einer Vollversammlung vor allen Schülern zur Lage der Schülervertretung zu sprechen, und sich dabei in Rage geredet. Er endete mit Goethe und dessen Versen: "Eines schickt sich nicht für alle. Sehe jeder, wo er bleibe, sehe jeder, wie er's treibe, und wer steht, dass er nicht falle." Uwe hatte wirklich nur sagen wollen, dass sich eines nicht für alle schickt. Aber natürlich wurde sein Zitat als Drohung gewertet. Lehrer Arlt, der Vertreter der SED, beschimpfte ihn denn auch prompt als "Frosch", der es wage zu drohen, und drohte seinerseits, ihn von der Schule zu weisen. Der Rektor lavierte irgendwie, stimmte Arlt aber bei. Rückhalt hatte Uwe nur bei Herrn Faber von der CDU, den er informiert hatte und der erfreulicherweise zum Termin aufgetaucht war. Der Herr sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen.
Wenige Tage später stand in der Dresdener "Union", einer Zeitung der CDU, ein Artikel über einen ähnlichen Vorfall in Döbeln und die Information, dass es eine Anordnung über die Auflösung von Schülervertretungen gar nicht gäbe. Prompt erschien am Schwarzen Brett, das jetzt als "Jugend-Echo" fungierte und von der FDJ der Schule benutzt wurde, ein Artikel von Manfred Peters, einem Klassenkameraden, der als Kommunist galt und sich in allen Diskussionen bisher tolerant gezeigt hatte. Jetzt bezeichnete er Uwe unter dem Titel "Auch ein Demokrat" als "Feind der Einheit Deutschlands". Wie Manfred so etwas Unsinniges behaupten konnte, war Uwe völlig schleierhaft. Er verstand gar nichts mehr. Und in die FDJ konnte er nun schon gar nicht eintreten.
Als sich Herr Bienert, der Russischlehrer, als Sozialist zu erkennen gab und eine Diskussion auszulösen versuchte, schwieg Uwe beharrlich. Abends schrieb er ins Tagebuch: "Nun, ich werde mich hüten, es nochmals zu wagen, an einer Diskussion teilzunehmen."
Uwe hatte eine Lektion über Demokratie erhalten, eine Demokratie, wie er sie sich so nicht vorgestellt hatte. Ihm behagte nicht der zunehmende Einfluss dieser neuen Partei, die offen zugab, eine proletarische Diktatur anzustreben. Die politische Offenheit war zwar sozusagen ausgesprochen nobel, aber die Absicht schien Uwe so kurze Zeit nach der Überwindung einer verheerenden Diktatur nicht erstrebenswert. Nach der Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten zur Einheitspartei, die Uwe übrigens durchaus als positiven historischen Schritt empfunden hatte, steuerte man das soziale Ziel nun offenbar noch forscher an. Uwe ahnte, dass ihn seine Mitgliedschaft in der CDU letztlich gerettet hatte. Denn immerhin wurde ja auch weiterhin Blockpolitik gemacht.