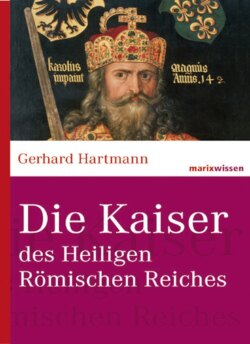Читать книгу Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches - Gerhard Hartmann - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KÖNIG LOTHAR II. (855–869)
ОглавлениеKg. Lothar II. wurde wahrscheinlich 835 geboren (Datum und Ort unbekannt). Seine Eltern waren Ks. Lothar I. und Ermengard (siehe oben). 855 ehelichte er TEUTBERGA († 875), eine Tochter des Gf. Boso von Arles, und 862, kirchlich nicht anerkannt, WALTRADA († 868). Er hatte vier Kinder.
Der vor dem Tod seines Vaters Ks. Lothar I. kaum hervorgetretene Kg. Lothar II. erhielt aus der Erbmasse des sog. Mittelreiches den nördlichen Teil, das regnum Lotharii, mit der Residenz Aachen. Aus dieser Formulierung rührt der spätere Territorialbegriff Lothringen.
Neben dieser Namensgebung ist Lothar II. vor allem durch seine Ehe-Auseinandersetzungen in der Geschichte bekannt geworden, auf die näher einzugehen sich lohnt. Lothar war ursprünglich in einer sog. Friedelehe mit Waltrada verbunden, heiratete dann in einer sog. Muntehe Teutberga. Eine Friedelehe (friudiea = ahd. Geliebte) war im Frühmittelalter, offenbar auf germanisch-rechtlichen Vorstellungen beruhend, eine Ehe minderen Rechts. Der Ehemann war nicht Vormund der Frau, sowohl Mann wie Frau konnten sich scheiden lassen. In der Regel wurden solche Friedelehen, die auf einer beiderseitigen Willensübereinkunft beruhten, zwischen Paaren aus unterschiedlichen Ständen geschlossen. Eine Friedelehe kam – ähnlich wie eine Ehe im römischen Recht – durch eine öffentliche Heimführung der Braut und die Hochzeitsnacht (matrimonium consumatum) zustande. Sie konnten in eine Muntehe umgewandelt werden, wenn der Ehemann nachträglich den Brautschatz leistete. Die Kinder aus solch einer Ehe unterstanden nur der Verfügungsgewalt der Mutter und waren anfänglich auch voll erbberechtigt. Die Kirche versuchte im Laufe des 9. Jh., die Friedelehe zurückzudrängen. Der Fall Lothars II. ist ein signifikantes Beispiel dafür.
Hingegen ist die Muntehe (munt = ahd. Vormund) die gebräuchliche Form der mittelalterlichen Eheschließung, die ein Rechtsakt bzw. ein Rechtgeschäft zwischen den beteiligten beiden Familien war. Die Vormundschaft über die Frau ging von deren Vater auf den Ehemann über. (Der Brauch, dass der Vater in der Kirche seine Tochter zum Altar führt und dem dort stehenden künftigen Ehemann übergibt, rührt daher.) Die Trauung stellte einen weltlichen, öffentlichen Rechtsakt dar, in welchem dieser Übergang bekundet wurde und dem die Ehefrau zustimmen musste. Im Gegensatz zur Friedelehe hatte in einer Muntehe nur der Mann das Scheidungsrecht, aber die Pflicht, seine Frau zu schützen und für sie zu sorgen.
Während Lothar in seiner ersten Friedelehe mit Waltrada Kinder hatte, blieben ihm diese in der Folge in der Muntehe mit Teutberga versagt. Die bisherige Geschichte der karolingischen Erbfolgen hat gezeigt, dass es für jeden Herrscher absolut wichtig war, einen legitimen Nachfolger zu besitzen. Aus diesem Grund trennte sich Lothar II. von Teutberga und heiratete in einer Muntehe offiziell Waltrada. Auf den Aachener Synoden von 860 und 862 wurde diese Vorgehensweise gebilligt. Da es aber in dieser Sache politisch auch und vor allem um die Anerkennung legitimer Erben ging, wurde dieser Streit auf eine andere Ebene gestellt, da »potentielle Erben« bzw. Interessenten (wie etwa Karl der Kahle) bereits in Wartestellung standen. Daher verlangte Papst Nikolaus I. (858–867), dass auf einer gesamtfränkischen Synode, zu der er einen Legaten entsandte, eine Entscheidung gefällt werden sollte. Diese tagte im Juni 863 in Metz, wobei Lothar mit Erfolg versuchte, seine zeitlich frühere Friedelehe als gültige Muntehe darzustellen. Dabei wurde er von den Erzbischöfen Gunthar von Köln († 873) und Dietgold (Tiutgaud) von Trier († 868) unterstützt, die ihrerseits vom Papst aufgefordert wurden, das Protokoll in Rom vorzulegen. Dies geschah im Oktober desselben Jahres, wobei dann der Papst das Ergebnis nicht anerkannte und die beiden Erzbischöfe absetzte. Lothar resignierte aber nicht und strebte eine Neuaufrollung des Prozesses an. Der neue Papst Hadrian II. erlaubte eine Wiederaufnahme, die aber wegen des Todes Lothars im Jahr 869 hinfällig wurde. Dieser beispielhafte Streit zeigt auch, wie der Papst versuchte, sich einen »Jurisdiktionsprimat« über die Bischöfe bis hin zur Absetzung anzueignen und im Eherecht Einfluss zu nehmen. (Nach dem Sachverhalt, soweit er jetzt noch zu ermitteln ist, hätte Lothar heute ohne jeglichen politischen Druck seine Ehe vor einem kirchlichen Gericht für nichtig erklären lassen können.)
Mit dem Tod Lothars trat das ein, was er in seinem »Ehestreit« zu verhindern suchte: Sein geographisch schmales nördliches Mittelreich wurde zwischen dem Ost- und Westfrankenreich geteilt und blieb bis Mitte des 20. Jh. ethnographischer und politischer Zankapfel (Elsass-Lothringen) zwischen Deutschland und Frankreich.