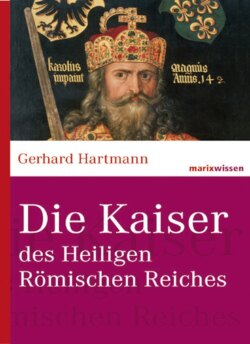Читать книгу Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches - Gerhard Hartmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT
ОглавлениеDie 71 Herrscherbiographien dieses Bandes – von Kaiser Karl dem Großen bis zum letzten österreichischen Kaiser Karl I. bzw. zum Deutschen Kaiser Wilhelm II. – umfassen einen Zeitraum von fast 1200 Jahren, und in ihnen spiegelt sich die Geschichte des »deutschen Mitteleuropas« wider. Dieser Begriff wurde 1982 vom Klagenfurter Historiker Helmut Rumpler eingeführt, um auf die über Jahrhunderte gewachsene historische Zusammengehörigkeit dieses Raums als eigenständige Geschichtslandschaft hinzuweisen und um einen Beitrag zur Lösung der schwierigen Nomenklatur zu leisten, die im Zusammenhang mit dieser »deutschen« Geschichte und den staatlichen Organisationen der einzelnen Reiche steht.
Die Geschichte dieses »deutschen Mitteleuropas« ist mehr als nur eine »deutsche« Geschichte. Denn durch seine an sich nicht unproblematische Zentrallage ergaben sich Wechselwirkungen, Einflussnahmen, Beziehungen usw. im Westen (Frankreich, Benelux-Raum, Burgund), im Süden (»Reichsitalien«), im Osten (Preußen, Polen) sowie durch die Habsburger-Monarchie im Balkanraum. In all diesen Ländern und Gegenden sind bis heute noch Spuren dieses »Kaisertums« bzw. »Reiches« zu finden, etwa die staufischen Bauten in Süditalien oder die allesamt ähnlich aussehenden Bahnhöfe, Theater- und Opernhäuser, Gymnasien und Finanzämter im Gebiet der ehemaligen k. u. k. Monarchie, um nur diese Beispiele zu erwähnen.
Betrachtet man die genealogischen Zusammenhänge dieser Herrscher näher, so verblüfft deren europäische Dimension. Innerhalb des christlichen Abendlandes gab es zwischen den Herrscherfamilien sehr oft wechselweise Verehelichungen, die praktisch dazu führten, dass fast alle hochadeligen Familien verwandt bzw. verschwägert waren. Dieser Umstand hat wesentlich dazu beigetragen, dass man zumindest in der führenden Oberschicht die Einheit des christlichen Europas als persönliche Realität erlebt hat. In den gegenwärtigen Zeiten der zunehmenden europäischen Integration und Globalisierung ist man davon eigentlich noch oder bereits weit davon entfernt.
Aber welchen Namen hatte dieses »Reich«? Der seit der karolingischen Zeit übliche Begriff regnum Francorum, Frankenreich, bzw. regnum Francorum orientalium, Ostfrankenreich, war bis weit ins 10. Jh., bis in die Zeit der Ottonen hinein, in Verwendung. Im 11. Jh. kam gelegentlich der Begriff regnum Teutonicum auf. Die wichtigsten Fürsten des Reiches wählten daher im Hochmittelalter primär einen rex (Francorum) auf fränkischem Boden (z. B. Frankfurt/Main), der erst später – aber zuerst nicht zwangsläufig – zum Kaiser gekrönt wurde. Die Wiederherstellung des (west-)römischen Kaisertums, die translatio imperii, zuerst mit Kaiser Karl dem Großen und dann dauerhaft mit Kaiser Otto dem Großen war ursprünglich eher auf die Person bzw. auf die Träger der Krone des regnum Francorum und nicht so sehr auf dessen geographisch definiertes Reich bezogen. Doch ließ sich in der Folge ein Rückgriff auf die Stadt Rom bzw. auf das alte Römische Reich nicht vermeiden, wie die Geschichte zeigt. So findet sich in einer Urkunde von Kaiser Otto II. aus dem Jahr 982 bereits die Bezeichnung Romanorum imperator, Kaiser der Römer. Gegen 1100 (siehe S. 68) entstand der Titel rex Romanorum, König der Römer bzw. römischer König, für den von den (Kur-)Fürsten gewählten König. d. h. den rex Francorum orientalium. Mit diesem Titel wurde auch der Anspruch des gewählten Königs auf die Kaiserkrönung dokumentiert. Spätestens ab Ks. Ferdinand I., wo automatisch im Augenblick des Regierungsantritts bzw. der Königswahl der Betreffende den Titel Kaiser annahm, wurde der Titel rex Romanorum für bereits zu Lebzeiten eines Kaisers und als dessen Nachfolger gewählte und gekrönte Könige verwendet, die dann beim Tod ihres Vorgängers, in der Regel der Vater oder ein anderer naher Verwandter, automatisch Kaiser wurden. Letztmalig gab es den Titel Roi de Rome für den Sohn Kaiser Napoleons I., den späteren Herzog von Reichstadt. Den Titel »deutscher König« gab es nicht, und der Titel »deutscher Kaiser« war erst gegen Ende des Heiligen Römischen Reiches umgangssprachlich in Gebrauch. Die Begriffe römisch-deutscher König bzw. Kaiser haben sich seit einiger Zeit in historischen Darstellungen der Einfachheit für den Leser halber durchgesetzt.
Die ursprüngliche sakrale, ja sogar sakramentale Ausstrahlung des Kaisertums verblasste zur Zeit der Salier im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Papst und Kaiser zunehmend, so dass unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa der Begriff sacrum imperium quasi als Ersatz eingeführt wurde. Aus dem Jahr 1254 ist erstmals der Begriff Sacrum Romanum Imperium, Heiliges Römisches Reich, abgekürzt S. R. I., belegt, der dann ab Kaiser Karl IV. regelmäßig verwendet wurde. Mitte des 15. Jh. tauchte dann der Zusatzbegriff nationis Germanicae, deutscher Nation, auch in offiziellen Dokumenten auf. Ab dem 17. Jh. ist gelegentlich vom Deutschen Reich die Rede. Der Begriff Deutschland wird erst richtig im 19. Jh. gebräuchlich (siehe z. B. das »Deutschlandlied«). Historisch-retrospektiv wird aber gemeinhin als Heiliges Römisches Reich jenes staatliche Gebilde bezeichnet, das mit der Kaiserkrönung Karls des Großen seinen Anfang nahm und was sich mit der geographischen Herausbildung des Ostfrankenreichs ab ca. 900 fortsetzte. Als durchaus machtvolles Reich hat es eigentlich erst mit Kaiser Otto I. richtig Bestand. Ab dem 13. Jh. beginnt der Prozess der Zurückdrängung der Königs- bzw. Kaisergewalt im Reich, das spätestens ab 1648 zu einem eigenen, souveränen Handeln kaum mehr fähig war und im Zuge des Umbruchs in der Napoleonischen Zeit im Jahr 1806 aufgelöst wurde.
In diesem Band werden alle jene Herrscher behandelt, die ab der Wiederbegründung des (west-)römischen Kaisertums im Jahre 800 diese Krone getragen haben; darüber hinaus auch alle ostfränkischen und dann in der Folge römisch-deutschen Könige (rex Romanorum), die keine Kaiser waren. Sinnvollerweise wird diese Reihe mit den jeweils drei österreichischen sowie Deutschen Kaisern ergänzt.
Der Ansatz, aus dem Blickwinkel des jeweiligen Herrschers die Geschichte eines bestimmten Raums bzw. einer Epoche zu beschreiben, ist durchaus legitim, denn der Monarch bestimmte früher zumindest die »Richtlinien der Politik«, und nicht selten mischte er sich auch in Detailfragen ein. Mit der zunehmenden Partizipation weiterer Kreise an der politischen Willensbildung traten seine Gestaltungsmöglichkeiten zurück. Aber für den Zeitraum bis 1918 besaßen die Monarchen trotz des im 19. Jh. beginnenden Konstitutionalismus und Parlamentarismus immer noch einen entsprechenden Einfluss, vor allem mit ihrer Prärogative in der Außen- und Sicherheitspolitik. Politische Prozesse wurden und werden immer von politisch handelnden Personen angestoßen, beeinflusst und gestaltet. Diese dann aus deren Perspektive zu beschreiben, ist insofern nicht nur angemessen, sondern auch faszinierend.
So möge dieser Band auch dazu beitragen, beim Leser bzw. der Leserin Verständnis für die historische Entwicklung der europäischen Mitte zu wecken, um damit vielleicht die gegenwärtigen politischen Gegebenheiten und Prozesse in Europa allgemein, sowie besonders im deutschen Sprachraum, aus der historischen Genese heraus verstehen zu können.
Kevelaer, im Jahr 2007, am Fest des hl. Markgrafen Leopold III. von Österreich, mit dem in zweiter Ehe Agnes, Tochter Kaiser Heinrichs IV., Mutter König Konrads III. und Großmutter Kaiser Friedrichs I. Barbarossa, verheiratet war.