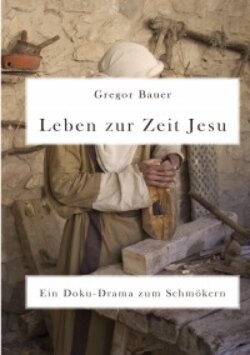Читать книгу Leben zur Zeit Jesu. Ein Doku-Drama zum Schmökern - Gregor Bauer - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrestige und Reichtum, Beruf, Bildung, Verwandtschaft
Obwohl sich die meisten Familien am Rand des Existenzminimums bewegen: Reichtum darf man als Erfolgskriterien auf dem damaligen Beziehungsmarkt getrost tiefer hängen als auf dem heutigen. Da kann einer noch so viel verdienen: Wenn er einen Beruf hat, bei dem es darauf ankommt, sich rücksichtslos auf anderer Leute Kosten zu bereichern, hat er bei den meisten Eltern keine Chance.
Welche Berufe haben ein hohes Sozialprestige, welche nicht (j62)? Besonders die Handwerker halten sich für unentbehrlich. Stolz klemmen sie das Symbol ihres Handwerks hinters Ohr, der Weber seine Spule, der Färber seine Farbprobe, der Schreiber sein Schreibrohr (j62 155). Aber was zählt ein Beruf bei denen, die ihn nicht ausüben? Wenn wir die Eltern junger Mädchen fragen, wird die Sache rasch klarer: Workaholics haben schlechte Karten. Wenig angesehen ist auch, wer klassische Frauenarbeiten zu seinem Gewerbe macht. Hoch im Kurs stehen dagegen fromme junge Männer, die sich neben Beruf und Familie die Zeit nehmen, eifrig die heiligen Schriften zu studieren. Vielleicht, dass sich so ein Schwiegersohn sogar eines Tages einen Ruf als Schriftgelehrter erwirbt. Das zählt mehr als ein neues Ochsengespann (T II 493).
Und noch etwas: Verwandte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
„Mann Alex, jetzt haben wir uns schon wieder verquasselt. Wir wollten doch endlich losfahren.“ –
„In Ordnung, Liz. Nur eine Sache noch.“ –
„Was denn jetzt noch für eine Sache noch?“ –
„Falls meine Zeitmaschine in der Vergangenheit nicht mehr anspringen sollte, und wir könnten nicht mehr in die Gegenwart zurück: Wen würdest du dort heiraten?“
So unbeschwert, wie Liz lacht, scheint sie diese Aussicht wenig zu schrecken. „Heiraten? Mich will doch sowieso keiner dort. Zu alt, zu groß, zu heidnisch.“ –
„Das ist wohl wahr. Die meisten anderen Kriterien erfüllst du auch nicht.“ –
„Welche denn?“ –
„Sanft und fügsam müsstest du sein. Vorzeigbare Brüder wären hilfreich, und du solltest nachweisen können, dass du keine Epilepsie- oder Leprafälle in deiner Familie hast. Beides hält man für erblich.“ –
„Wie soll ich das denn nachweisen. Also vergiss es.“ –
„Du hast wohl recht. Trotzdem, ein paar Kerls würde ich dir dort schon gern vorstellen.“ –
„Wen denn?“ –
„Ich nenn dir jetzt ein paar. Du entscheidest dann, wen wir zuerst besuchen.“ –
„Schieß los.“
Dorfhandwerker
(bü01 29, ow 78ff, st 67, j62 338.344)
In Nazareth machen die Leute fast alles selbst – aber eben nur fast: Ein paar Dinge gibt es schon, für die man den Dorfhandwerker Joses braucht.
Wer einen neuen Pflug will oder einen Dreschschlitten, einen Vorratskasten oder auch ein Joch für sein Ochsengespann, geht zu Joses. Der tut sich mit der Materialbeschaffung nicht immer leicht: In der Gegend um Nazareth gibt es wenig brauchbares Holz, und Metall ist teure Importware. Wenigstens an Gestein ist kein Mangel. Joses macht daraus Mühlensteine, aber auch Sarkophage, Kästen für die Gebeine der Toten und Trinkgefäße für die besonders Frommen, die Wert darauf legen, ihre Becher nach einer Verunreinigung wieder kultisch rein zu bekommen.
Alle Hände voll zu tun hat Joses, wenn er zum Hausbau hinzugezogen wird. Dann zimmert er die Türe, haut Dachbalken zurecht und rührt Mörtel an, mit dem die Lehmschicht über dem Dachreisig übergossen wird. In Wohnhöhlen vergrößert er die Grotten, um mehr Lagerraum für Lebensmittel zu schaffen. Ansonsten ist an der Inneneinrichtung nicht viel verdient: Tische, Betten, Schränke oder Stühle bestellt kein Mensch.
Übers Jahr gesehen, ist Joses in Nazareth nicht voll ausgelastet. Da zudem seine armen Verwandten häufig nur einen Freundschaftspreis zahlen, nimmt er gerne auch aus den umliegenden Dörfern Aufträge an. Dann kommt er manchmal für mehrere Tage nicht nach Hause. Ist er erst einmal in einem Dorf angeheuert, so tragen ihm die Bewohner oft weitere Arbeiten an. So hilft er ihnen beim Ausbessern ihrer Dächer, dichtet ihre Trinkwasserzisternen ab und schärft ihre Handmühlensteine.
Seit Joses einmal an der Errichtung einer Synagoge mitgewirkt hat, kann er sich auch als Bauhandwerker für städtische Projekte anbieten. Wenn ihn der Ehrgeiz packt, zieht er vielleicht eines Tages in die gut 20 Meilen (ca. 30 km) entfernt gelegene Hauptstadt Tiberias. Aber Vorsicht – man sagt, die Kriminalitätsrate sei hier besonders hoch: Um die bei den Frommen verpönte Stadt überhaupt bevölkern zu können, hat Herodes allerlei zwielichtige Gestalten angesiedelt.
„Und, willst du Joses kennen lernen, Liz?“ –
„Wie alt ist er denn?“ –
„Ende 30.“ –
„Einen jüngeren hast du nicht?“ –
„Der nächste ist 18.“
Töpfer
(tö 33.152ff, dr 33f, 235f.239, bö 178f, wu 3/98 64, j62 5)
Als Töpfer hat Jason viel zu tun. Die Liste der Gegenstände, die er aus Ton fertigt, ist lang. Fässer, Krüge, Kannen, Becher, Behälter für Schriftrollen und Dokumente, Kochherde, Backöfen, Öllampen, Spielzeug, Schreibtafeln und anderes mehr.
Mit welcher Konkurrenz hat Jason zu rechnen? Zunächst mit allen Heimwerkern, die ihre Tongefäße selbst herstellen. Glücklicherweise sind die wenigsten in der Lage, ein elegantes Gefäß nach der neuesten Mode herzustellen. Zudem hat nicht jeder Zugang zu guter Tonerde. Der weiße Ton von Bethlehem etwa hält nicht viel aus. Besonders geschätzt ist dagegen schwarzer Ton aus Sichin bei Sepphoris. Hier hat Jason eine Tongrube gepachtet.
Von seiner Frau würde Jason erwarten, dass sie zwei Mal die Woche die Tongefäße für ihn auf dem Töpfermarkt von Sepphoris verkauft. Er könnte ihr nicht garantieren, dass alles so bleibt wie es ist: Irgendwann wird seine Tongrube ausgebeutet sein. Dann muss Jason eine neue suchen – und wo die sein wird, weiß er noch nicht. Vielleicht wird die Familie umziehen müssen, vielleicht wird er auch nicht mehr jeden Abend zu Hause sein.
„Sollen wir Jason zuerst ansteuern, Liz?“ – „Am See Genesareth kennst du wohl niemand?“
Fischer
(bü 51.62.67ff.87, bö 42, 175ff, hd 107)
Simon bar Jona lebt in Kafarnaum, einem Fischerdorf am See Genesareth mit nicht mal 1000 Einwohnern.
„Mann Alex, nicht schon wieder so ein Provinzkaff. Kennst du denn niemanden in der Hauptstadt Tiberias? Die ist doch auch am See.“ – „Ich weiß, Kafarnaum klingt provinziell. Aber der Eindruck täuscht.“
Kafarnaum ist Teil eines ziemlich dicht besiedelten Gebiets. Gerade mal 10 bis 15 römische Stadien, also zwei bis drei Kilometer südwestlich sind die heilkräftigen Quellen von Tabgha. Hierher werden Kranke und Körperbehinderte aus der ganzen Gegend gebracht. Geht man fünf Meilen – etwa 7,5 Kilometer – weiter am See entlang, ist man schon in Magdala, dem Zentrum der Fischindustrie. Nach Tiberias sind es dann gerade mal noch vier Meilen.
Spazieren Sie von Kafarnaum aus in die andere Richtung, stehen Sie schon nach etwa 27 bis 28 Stadien, also etwa fünf Kilimetern, am Mündungsdelta des nördlichen Jordan. Hier verläuft die Grenze zwischen zwei Herrschaftsbereichen: Sie verlassen das Galiläa des Herodes Antipas und kommen in die Gaulanitis, sprich das Golan-Gebiet, über das sein Halbbruder Philippus regiert. Auf beiden Seiten der Grenze liegt die stark griechisch geprägte Stadt Bethsaida.
Aber zurück nach Kafarnaum: Hier ist mit gutem Grund eine römische Garnison stationiert. Nicht, weil die Bürger von Kafarnaum besonders aufsässig wären, sondern weil es hier um viel Geld geht. Denn in Kafarnaum befindet sich eine Zollstation. Da wird der Zoll erhoben für den Warenaustausch mit der Gaulanitis und für den Transitverkehr auf der Via Maris. Diese große Handelsstraße zwischen Syrien und Ägypten führt direkt an Kafarnaum vorbei. Von wegen Provinzkaff!
„Warum haben die ihre Zollstation nicht direkt an die Grenze zum Golan gelegt?“ –
„Vielleicht, weil sie in Kafarnaum den Fischfang besser kontrollieren können, Liz. Die warmen Quellen von Tabgha sind nicht weit. Alle Fische, die es wärmer mögen, zieht es hierher, besonders den sehr leckeren Fisch, den wir heute Petrusfisch nennen.“ –
„Warum verlegen sie ihre Zollstation dann nicht gleich nach Tabgha?“ –
„Das ist nicht nötig. Die ergiebigen Fischgründe von Tabgha gehören zum Revier der Fischer von Kafarnaum.“ Kafarnaum eignet sich also ideal, um neben dem Zoll für den Grenzverkehr auch gleich noch die Steuer für den Fischfang einzukassieren.
„Wenn ich mich recht entsinne, Alex, wolltest du mir keinen Vortrag über Grenzkontrollen und Fischsorten und Transitstraßen halten, sondern etwas von einem Fischer namens Simon erzählen.“
Reden wir also über Simon. Er hat einen harten Job. Meistens arbeitet er in der Nacht. Wenn er auf den See hinaus fährt, weiß er vorher nicht, ob sich die Netze füllen werden. Und sein Job ist gefährlich. Auch der geübte Simon kann die von Westen und Nordwesten herabfallenden Winde nicht vorhersagen, die die eben noch spiegelglatte Seeoberfläche urplötzlich zu haushohen Wellen aufwühlen.
Als Einzelkämpfer würde es Simon nicht weit bringen. Natürlich könnte er einen Angelhaken an einer Schnur mit oder ohne Angelrute auswerfen und warten, bis sich ein Fisch erbarmt. Aber seine Familie kriegt er so nicht satt. Das Wurfnetz taugt da schon etwas mehr. Damit sieht man ihn manchmal im Wasser waten, die Kleidung hüfthoch geschürzt. Erblickt er einen Schwarm Fische, nähert er sich vorsichtig. Bevor die Fische fliehen, muss er das Netz so geschickt schleudern, dass es sich zu seiner vollen Größe aufbläht – ein Rund von sechs bis zehn Ellen, also etwa drei bis fünf Meter Durchmesser – und direkt über dem Schwarm niedergeht. Wenn die Fische nicht doch noch entwischen, bevor die Bleigewichte an den Rändern das Netz nach unten gezogen haben, hat er vielleicht einen ordentlichen Fang gemacht.
Das Wurfnetz funktioniert nur in Ufernähe. Schon deshalb reicht es Simon nicht: Wenn er über den See blickt, reizt es ihn, dort draußen einen richtig großen Fang zu tun. Deshalb hat er vor Jahren mit vier anderen Fischern ein Boot gekauft und eine etwa 30 Ellen, also fünfzehn Meter lange Netzanlage. Sie besteht aus drei parallel verlaufenden, verschiedenmaschigen Netzen. Die werden oben durch Holzstücke an der Wasseroberfläche gehalten und unten durch Steine in die Tiefe gezogen.
Dieses Auslegenetz lassen die Männer weit draußen in den See. Sobald sie meinen, dass sich genügend Fische zwischen den Netzwänden verfangen haben, beginnen sie, kräftig zu rudern. Das Netz bildet nun einen wandernden Bogen, der sich hoffentlich weiter mit Fischen füllt. Wenn sie erfolgreich waren, können sie ihn nur mit vereinten Kräften an Bord ziehen.
Aber auch das ist noch nicht die richtig große Nummer. Deshalb hat sich Saul im vergangenen Jahr mit weiteren Fischern zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie ein Netz angeschafft, wie es sich nur größere, genossenschaftlich organisierte Fischergruppen leisten können: Ein 300 Ellen, also etwa 150 Meter langes und in der Mitte zehn Ellen, also fünf Meter breites Schleppnetz.
300 Ellen – das ist stattlich, aber keineswegs das längste Netz, das im See eingesetzt wird. Simons Nachbar protzt mit einem Netz, das 400 Ellen lang ist, also mehr als 200 Meter.
In der Nacht fahren die Männer weit hinaus in den See. Draußen liegen die beiden Boote zunächst dicht an dicht. Das Netz liegt wohlgeordnet im ersten Boot. Simon erhebt sich und reicht seinem stehenden Gegenüber im zweiten Boot ein Ende des Netzes. Dann rudern die Männer, bis die beiden Boote so weit auseinander liegen, dass das Netz ganz ausgespannt ist. Hoffentlich rudern die Trampel im anderen Boot nicht wieder so weit, dass es Simon das Netz aus der Hand reißt.
Auch das Schleppnetz wird von Holzstücken nach oben und von Steinen nach unten gezogen. Wenn es sich in der richtigen Lage befindet, verharren die Männer noch eine Weile. Schließlich verständigen sie sich mit Handzeichen, dass es so weit ist: In beiden Booten werfen sich die Männer in die Ruder und steuern auf das Ufer zu.
Am Strand angekommen, springen sie aus ihren Booten, packen das Netz an den Zugseilen zu beiden Seiten und ziehen es ans Trockene. Am Strand warten bereits die ersten Kunden und die Familien der Fischer. Wenn es ein guter Fang ist, gibt es nun viel zu tun: Zunächst müssen alle unreinen Tiere aussortiert werden. Unrein sind Schalentiere und alle Fische ohne Flossen und Schuppen, beispielsweise Welse, Aale, Rochen oder Neunaugen. Sie werden zurück ins Wasser geworfen. Der eine oder andere Fischer mag sie auch zur Seite legen, um sie an heidnische Kunden zu verkaufen, die es oft gerade darauf abgesehen haben. Sardinen, Karpfen, Barben und Chromiden landen in Körben, um rasch ausgenommen, zum Trocknen am Strand ausgelegt oder in Salzlauge eingepökelt zu werden.
Der Fang ist noch nicht versorgt, da wird auch schon das kostbare Schleppnetz sorgfältig auf Schadstellen untersucht. Die Konservierung der Fische und die Pflege des Netzes wird die Fischerfamilien noch den ganzen Tag beschäftigen.
„Und, Alex, lohnt sich das Ganze?“ –
„Für viel mehr als das Allernötigste reicht es kaum, Liz.“ –
„Gibt es wohl zu wenig Fische?“ –
„Daran liegt es nicht. Der See ist zwar launisch, aber alles in allem doch recht freigiebig. Nein, es sind die hohen Steuern und die Lizenzgebühren, die den Fischern zu schaffen machen. Außerdem sind die staatlich kontrollierten Preise alles andere als üppig.“
* * *
Was gibt also ein Fischer schon auf, wenn er seine Arbeit verlässt, um mit einem Wanderprediger wie Jesus von Dorf zu Dorf zu tingeln? Ach ja, richtig, fast hätte ich es vergessen: Seine Familie gibt er auf.